Artgutachten Bachmuschel 2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
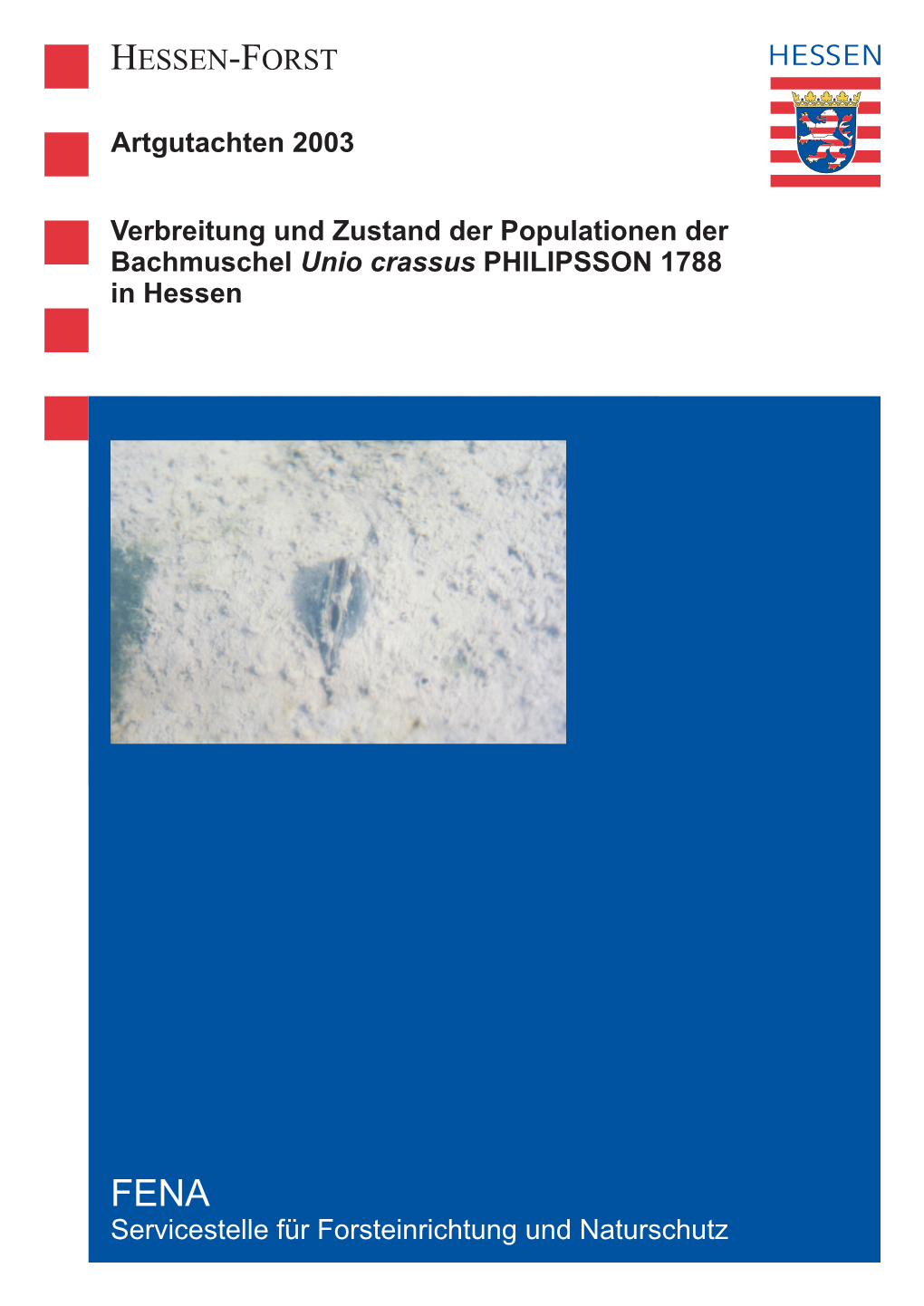
Load more
Recommended publications
-

Hochwasser Januar, Februar 2021 in Hessen
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Hydrologie in Hessen, Heft 22 Hochwasser Januar, Februar 2021 in Hessen 1 Impressum Hydrologie in Hessen, Heft 22 ISSN 1438-7859 ISBN 978-3-89026-722-7 Autorin: Cornelia Löns-Hanna Hochwasser Januar, Februar 2021 Titelbilder: Kisselbach im Taunus, 30.1.2021, Foto: Th. Hanna Nidder, Glauberg, OT Stockheim, 29.1.2021, Foto: H. Gerds verschneiter Taunuswald, 18.1.2021, Foto: M. Hergesell Hochwasserschild am Rhein, 3.2.2021, Foto: N. Poppendick 2 Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung 4 2 Hessische Hochwassermeldestufen 4 3 Witterung 6 4 Allgemeine Übersicht über den Hochwasserverlauf 12 5 Hochwasserverläufe in den hessischen Flussgebieten 14 5.1 Südhessen 14 5.1.1 Nidda und Nidda-Einzugsgebiet 14 5.1.2 Kinzig und Kinzig-Einzugsgebiet 18 5.1.3 Kleinere Gewässer im Rhein- und im Main-Einzugsgebiet 21 5.2 Fulda und Fulda-Einzugsgebiet 23 5.3 Lahn und Lahn-Einzugsgebiet 28 5.4 Werra und Werra-Einzugsgebiet und Weser 31 6 Rhein, Main, Neckar 33 7 Einordnung der Hochwasserereignisse vom 18. Januar bis zum 11.Februar 2021 35 8 Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken 37 9. Einsatz der Hochwasservorhersagezentrale 38 9.1 Aufbau und Einsatz der Hochwasservorhersagezentrale 38 9.2 Datenflüsse und Vorhersagemodelle 39 9.3 WEB-Darstellungen, mobile Anwendungen 40 10. Literatur, Quellen 40 3 1 Zusammenfassung Nachdem das Jahr 2021 in den ersten zwei Wochen relativ trocken war, begann in der dritten Woche eine Serie von Tiefdruckgebieten, die erhebliche Niederschläge brachten. In den Mittelgebirgen fie- len diese als Schnee. Hohe Niederschläge gab es im Vogelsberggebiet und im Westerwald. In der vierten Januarwoche wurde es wärmer und die Regenfälle führten mit dem tauenden Schnee zu stei- genden Wasserständen in den oberirdischen Gewässern. -

Wasserinsekten Im Hyporhithral Und Epipotamal Der Ful Da
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Lauterbornia Jahr/Year: 1998 Band/Volume: 1998_33 Autor(en)/Author(s): Siebert Matthias Artikel/Article: Wasserinsekten im Hyporhithral und Epipotamal der Fulda, einst und jetzt. 53-83 ©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland,53 Download unter www.biologiezentrum.at Lauterbornia H. 33: 53-83, Dinkelscherben, September 1998 Wasserinsekten im Hyporhithral und Epipotamal der Ful da, einst und jetzt [Aquatic insects in the hyporhithal and epipotamal zones of the river Fulda, present and past] Matthias Siebert Mit 3 Abbildungen und 5 Tabellen Schlagwörter: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Insecta, Fulda, Weser, Hessen, Deutsch land, Fluß, Phosphor, Gewässergüte, Biozönotik, Bewertung, Faunistik, Wiederbesiedlung Die Wiederbesiedlung von Hyporhitrhal und Epipotamal der Fulda im Gefolge der Phosphat fällung im Klärwerk Fulda-Gläserzell seit 1986 durch Ephemeroptera (36 Arten), Plecoptera (12 Arten), Trichoptera (53 Arten) und Aphelocheirus (Heteroptera) wird dokumentiert. Trotz der verbesserten Wasserqualität der Fulda, vor allem im ehemals verödeten Bereich zwischen Gläserzell und Hutzdorf, scheint für einige Arten die punktuelle Belastung durch das Abwas ser der Kläranlage immer noch eine Ausbreitungsgrenze darzustellen. Die Fulda gehört in ih rem Epipotamal zu den wenigen größeren deutschen Flüssen mit einer typischen und artenrei chen Insektenfauna. The recolonisation of the -

Report 2016/2017
SUSTAINABILITY REPORT 2016 / 2017 CONTENTS OUR COMPANY 3 Our company 14 Sustainable products 26 Employees burgbad AG is a leading manufactu- burgbad submits a declaration of rer of premium furniture and system conformity with the German Sustain- 4 For us, sustainability starts Innovation management Training and development solutions for the bathroom based in ability Code (DNK) and a progress right on our doorstep Bad Fredeburg. The company was report in compliance with the UN Concepts and designs Equal opportunity 8 Statement by the executive founded in 1946. At the time, its Global Compact. board 17 Breakdown of Health activities focused on the production raw materials of wooden construction kits and 9 Sustainability strategy Shared values shelves. burgbad quickly specialised 18 Responsibility in the in manufacturing bathroom furniture Action areas and goals supply chain 29 Code of conduct and was soon targeting the expan- 12 Action areas and goals 19 Emissions and 30 Social responsibility sion of its portfolio and expertise in consumption this direction. 24 Breakdown of waste dis The internationally operating posed of and recyclable company has three locations in waste Germany – Bad Fredeburg, Greding and Lauterbach-Allmenrod – which together make up burgbad GmbH, as well as a French subsidiary – burgbad France S.A.S – in Nogent- le-Roi. Since 2010, burgbad has been a wholly owned subsidiary of the Turkish Eczacibasi Holding. In 2017, a workforce of 722 staff was employed at burgbad’s locations, 610 of them in Germany and 112 in France. Cover photo: the River Lenne 2 www.burgbad.com www.burgbad.com 3 The HOCHSAUERLAND region For us, sustainability starts right on our doorstep Schmallenberg in the Hoch- Grafenberg forms part of Greding The Eure is one of the two rivers sauerland region, Grafen- in the district of Roth, Bavaria. -

Die Najaden Des Vogelsbergesjürgen H. Jungbluth, Hans
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel Jahr/Year: 1970-1973 Band/Volume: 1 Autor(en)/Author(s): Jungbluth Jürgen H., Schmidt Hans-Eckart Artikel/Article: Die Najaden des Vogelsberges 149-165 PHILIPPIA 1/3: 149-165 1972 JÜRGEN H. JUNGBLUTH und HANS-ECKART SCHMIDT Die Najaden des Vogelsberges Abstract Only some details are known about the distribution of molluscs in the Vogelsberg region (East Hesse, West Germany). This survey, the first to include most of the streams and pools of this area, shows that Anodonta cygnea (L.) and Unio crassus RETZ. are widely distributed, whereasUnio pictorum (L.), Unio tumidus RETZ. and Margaritifera margaritifera (L.) are less common. In comparison with collections from 1920 and 1950 the number of individuals of the species is reduced.Pseudanodonta eiongata (HOL.) was not recorded previously. The species of the family Sphaeriidae are listed for the first time. A. Einleitung Die Hinweise über das Vorkommen und die Verbreitung der Najaden im Vogelsberg sind in der Literatur spärlich. ECKSTEIN (1883) erwähnt die FlußperlmuschelMargaritifera mar garitifera (L.) aus dem Altefeldbach bei Altenschlirf, deren genaue Verbreitung später von SEIDLER (1922) untersucht wurde. SEIDLER weist hierbei darauf hin, daß die Vergesell schaftung der Flußperlmuschel mitUnio crassus RETZ, sowie Anodonta cygnea (L.) als Ausnahme anzusehen