221 Wang Xiaosong. Unkontrollierte Ameisen / Unruly Ants. Ausst.-Kat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Singapore Contemporary Opens January 21St
SINGAPORE CONTEMPORARY OPENS JANUARY 21ST featuring a rich program of complimentary special events, art tours, artist demonstrations, children’s activities and more "Persimmon Harvest" by San Zi Singapore, Tuesday November 24th: The inaugural edition of Singapore Contemporary will be held from January 21st to 24th, 2016, at the Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre. The Show’s theme is ‘A World of Art,’ with exhibitors and artworks from Singapore, most Asian countries, Australia and Europe. Singapore Contemporary presents a wide selection of interesting artworks from some of the world’s most recognized and successful contemporary artists with strong track records at auction, and a presence in notable private and public collections. The focus carries through to emerging and mid-career artists who are achieving a following on the international scene, and many with investment potential for the future. “As well as the Show itself, with it’s unique presentations of ‘China Encounters,’ ‘Artist Dialogues,’ an impressive Indonesian Pavilion and some exceptional installation art, we are delighted to present an enriching program of events and activities at the inaugural edition,” noted Show Director, Douwe Cramer. “Our comprehensive art tour program, live painting demonstrations and events for children, offer accessible, educational and fun activities designed to interest both adults and children, and experienced collectors through to newer art buyers.” Special features at Singapore Contemporary: CHINA ENCOUNTERS: Visitors are invited to browse and buy from a selection of more than 400 Chinese contemporary artworks – from emerging, mid-career, and already successful and collectable Chinese artists, including Wang Xiaosong, Su Xiaobai, Zhang Qing and Wang Min. -

The Image of the 2010 World Expo: Residents' Perspective
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, 28(2), 207–214 The Image of the 2010 World Expo: Residents’ Perspective Kangjuan LV1, Gyula Mosoni2, Mengyi Wang3, Xiaosong Zheng4*, Yan Sun5 1,3,4,5 SILC Business School, Shanghai University 20 Chengzhong Road, JiaDing District, Shanghai, 201800, P.R.China E-mail. [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2 School of Economics, Shanghai University 99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai E-mail. [email protected] http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.28.2.3048 Hosting mega-events has been regarded as an effective catalyst for city branding. But increasing environmental cost of mega- events has been highlighted recently, which affected local residents’ actual perception. The inconsistence between governments propagandizing benefits from holding mega-events and citizens’ real experience will decrease the real effect of the events. This paper demonstrates the inconsistence by Shanghai example, which is a support to the theory of mega-event impact on city. Shanghai 2010 World Expo officially aimed to improve the quality of life and building a harmonious society, while there are fewer studies focusing on whether the proposed vision is accepted by citizens. This paper explored the influences with a particular focus on residents’ attitudinal survey after the event from December 2010 to February 2011 and 148 respondents were collected. Using structural equation model, the results illustrated that surveyed residents recognized more with 4 dimensions (culture, environment, economic and technology), which reflected the harmony between man and nature, as well as harmony between spiritual and material content. -

China Will Invade Ibirapuera Park: from April 10 to May 18, the Exhibit Chinaartebrasil Will Be Featuring a Unique Overview of Contemporary Chinese Art in Oca
CHINA WILL INVADE IBIRAPUERA PARK: FROM APRIL 10 TO MAY 18, THE EXHIBIT CHINAARTEBRASIL WILL BE FEATURING A UNIQUE OVERVIEW OF CONTEMPORARY CHINESE ART IN OCA Curators Ma Lin and Tereza de Arruda organized the exibit that gathers more than 110 works by 62 artists, including important names in the international scene like Ai Weiwei, Luo Brothers, Ma Liuming, Miao Xiaochum, Song Gang, and Yin Xiuzhen, in addition to a selection of ancient art and textile art Wang Qingsong, Wang Shugang, Xiong Yu and the pair Rong Rong & Inri have developed pieces especially for this event, and Lu Song and Yuang Gong are coming to São Paulo to produce their work Ai Weiwei’s and Miao Xiaochum’s works displayed in the exhibit (Ai Weiwei - Very Yao, 2008, Installation - 46 bicycles. | Miao Xiaochun - Restart, 2008-2010, 3D computer animation, 14’22”) HSBC Bank Brasil presents the exhibit ChinaArteBrasil from April 10 through May 18 at Oca, in Ibirapuera Park, São Paulo. Organized by G11 and Brazil’s Ministry of Culture, the exhibit will be showing for the first time in Brazil a unique overview of contemporary Chinese art, gathering more than 110 works by 62 artists, which have never been shown in São Paulo. The selection includes renowned artists present in the international scene since the 1990’s, including the highlights Ai Weiwei, Luo Brothers, Ma Liuming, Miao Xiaochum, Ni Weihua, Qu Yan, Yin Xiuzhen, and also representatives of the youngest generation. Having as curators the art historians Ma Lin, from Shanghai, and Tereza de Arruda, Brazilian based in Berlin, ChinaArteBrasil proposes intensifying the cultural interaction between Brazil and China, countries with widely different traditions and contexts, but which many times walk side by side. -
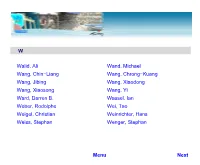
W Walid, Ali Wand, Michael Wang, Chin−Liang Wang, Chrong
W Walid, Ali Wand, Michael Wang, Chin−Liang Wang, Chrong−Kuang Wang, Jibing Wang, Xiaodong Wang, Xiaosong Wang, Yi Ward, Darren B. Wassel, Ian Weber, Rodolphe Wei, Tao Weigel, Christian Weinrichter, Hans Weiss, Stephan Wenger, Stephan Menu Next W Wenndt, Stanley Werner, Stefan Whyte, Kevin R. L. Wiegand, Thomas Willink, Tricia Willsky, Alan S. Wilzeck, Andreas Windisch, Marcus Woodruff, Pascale Woods, Roger Wu, Chih−Feng Wu, Dapeng Wu, Ping−Hao Wu, Xiaolin Wu, Ye Wymeersch, Henk Prev Menu Next W Wölfel, Matthias Prev Menu Ali Walid Organization : Intel Corporation, United States Paper(s) : CLOSED−LOOP VIDEO PROCESSING FOR OBJECTIVE QUALITY OPTIMIZATION (Abstract) Letter−W Menu Michael Wand Organization : University of Tübingen, WSI/GRIS, Germany Paper(s) : 3D MODELING OF INDOOR ENVIRONMENTS BY A MOBILE PLATFORM WITH A LASER SCANNER AND PANORAMIC CAMERA (Abstract) Letter−W Menu Chin−Liang Wang Organization : National Tsing Hua University, Taiwan Paper(s) : A DESIGN METHODOLOGY OF BUFFER−MEMORY ARCHITECTURES FOR FFT COMPUTATION (Abstract) Letter−W Menu Chrong−Kuang Wang Organization : National Taiwan University, Taiwan Paper(s) : DHT−BASED FREQUENCY−DOMAIN EQUALIZER FOR DMT SYSTEMS (Abstract) Letter−W Menu Jibing Wang Organization : Qualcomm Inc., United States Paper(s) : OPTIMAL DESIGN OF NONCOHERENT CAYLEY UNITARY SPACE−TIME CODES (Abstract) Letter−W Menu Xiaodong Wang Organization : Columbia University, United States Paper(s) : OPTIMAL DESIGN OF NONCOHERENT CAYLEY UNITARY SPACE−TIME CODES (Abstract) Letter−W Menu Xiaosong Wang Organization : Santa Clara University, United States Paper(s) : ERROR RESILIENT MULTIPLEXED CODING WITH RVLC (Abstract) Letter−W Menu Yi Wang Organization : North Carolina State University, United States Paper(s) : CHARACTERIZATION, ESTIMATION AND DETECTION OF NETWORK APPLICATION TRAFFIC (Abstract) Letter−W Menu Darren B. -

Suga Kishio 2020
Kishio Suga 1944 Born in Morioka, Japan 1968 Graduated from Tama Art University (Tokyo, Japan) Selected Solo Exhibitions 2020 Gallery Cocon, Tokyo, Japan Released Scenic Space, Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan 2019 Each Modern, Taipei eN arts, Kyoto, Japan Gallery Saiensu, Morioka, Japan Gallery Shilla, Daegu, Korea Measured Divisional Entities, Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan Tokyo Gallery + BTAP, Tokyo, Japan 2018 Blum & Poe, New York, USA Expanded Self-Space, Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan Mendes Wood DM, Sao Paulo, Brazil Released Existence on Edges, The Club, Tokyo, Japan 2017 Blum & Poe, Los Angeles, USA Divided Orientation of Space, Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan Itamuro Onsen Daikokuya, Itamuro, Tochigi, Japan Mendes Wood DM, Brussels, Belgium Tokyo Gallery + BTAP, Beijing, China 2016 Dia: Chelsea, New York, USA Gallery Shilla, Daegu, Korea Situations, Hangar Bicocca Foundation, Milan, Italy 2015 Blum & Poe, New York, USA Kishio Suga: New Works, Itamuro Onsen Daikokuya, Itamuro, Tochigi, Japan Kishio Suga: Situated Latency, Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan Kishio Suga: 1980s, Gallery Cocon, Tokyo, Japan Perimeter (Entai), 1985, Blain | Southern, London, UK Shane Campbell Gallery, Chicago, USA Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan 8/ Art Gallery/ Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan 2014 Itamuro Onsen Daikokuya, Itamuro, Tochigi, Japan Kishio Suga: Situated Underlying Existence, Le Corps de Garde, Colmar, France The “Origin of Situation” as Disclosed by “Things”, Vangi Sculpture Garden Muse- um, Shizuoka, Japan -

5Th Oct : 10:30 UTC Histopathology Image Analysis A
5th Oct : 10:30 UTC Histopathology Image Analysis A Pairwise Relation Learning for Semi-supervised Gland Segmentation Xie, Yutong; Zhang, Jianpeng; Liao, Zhibin; Verjans, Johan; Shen, Chunhua; Xia, Yong Northwestern Polytechnical University Ranking-Based Survival Prediction on Histopathological Whole-Slide Images Di, Donglin; Li, Shengrui; Zhang, Jun; Gao, Yue Tsinghua University Renal Cell Carcinoma Detection and Subtyping with Minimal Point-Based Annotation in Whole-Slide Images Gao, Zeyu; Puttapirat, Pargorn; Shi, Jiangbo; Li, Chen Xi'an Jiao tong University Censoring-Aware Deep Ordinal Regression for Survival Prediction from Pathological Images Xiao, Lichao; Yu, Jin-Gang; Liu, Zhifeng; Ou, Jiarong; Deng, Shule; Yang, Zhenhua; Li, Yuanqing South China University of Technology Tracing Diagnosis Paths on Histopathology WSIs for Diagnostically Relevant Case Recommendation Zheng, Yushan; Jiang, Zhiguo; Zhang, Haopeng; Xie, Fengying; Shi, Jun Beihang University Weakly supervised multiple instance learning histopathological tumor segmentation Lerousseau, Marvin; Vakalopoulou, Maria; Classe, Marion; Adam, Julien; Battistella, Enzo; Carré, Alexandre; Estienne, Théo; Henry, Théophraste; Deutsch, Eric; Paragios, Nikos CentraleSupélec 5th Oct : 11:00 UTC Histopathology Image Analysis B Divide-and-Rule: Self-Supervised Learning for Survival Analysis in Colorectal Cancer Abbet, Christian; Zlobec, Inti; Bozorgtabar, Behzad; Thiran, Jean-Philippe EPFL Microscopic fine-grained instance classification through deep attention Fan, Mengran; Chakraborti, -
ICNS-13 Program by Day (PDF)
As of June 6, 2019 (subject to change) 3:30 PM A01.06 Microscopic Nonuniform Structure of AlGaN-Based 260 and 285 nm MONDAY Light-Emitting Multiple Quantum Wells Grown on AlN Templates with Dense Macrosteps Analyzed by Cathodoluminescence Spectroscopy Yosuke Nagasawa1, Ryuichi Sugie2, Kazunobu Kojima3, Akira Hirano1, Masamichi PRESENTATIONS Ipponmatsu1, Yoshio Honda4, Hiroshi Amano4, 5, 6, Isamu Akasaki6, 7 and Shigefusa F. Chichibu3, 4; 1UV Craftory Co. Ltd., Japan; 2Toray Research * Invited Paper Center, Inc., Japan; 3Tohoku University, Japan; 4Nagoya University, Japan; 5Nagoya University, Japan; 6Nagoya University, Japan; 7Meijo University, Japan. SESSION PL01: Plenary Session I Session Chairs: Stacia Keller and Christian Wetzel Monday Morning, July 8, 2019 3:45 PM BREAK Evergreen Ballroom E-I, Lobby Level SESSION A02: Vertical Cavity Lasers Session Chairs: Theeradetch Detchprohm and Sven Einfeld 8:45 AM Monday Afternoon, July 8, 2019 Welcome / Opening Ceremony by W. Alan Doolittle, Georgia Institute of Evergreen Ballroom E-F, Lobby Level Technology 9:00 AM *PL01.01 4:15 PM *A02.01 Developments of Nonpolar/Semipolar Edge Emitting Laser Diodes and Epitaxy and Performance of VCSEL Structures Tetsuya Takeuchi1, Satoshi VCSELs Shuji Nakamura; University of California Santa Barbara, United Kamiyama1, Motoaki Iwaya1 and Isamu Akasaki1, 2; 1Meijo University, States. Japan; 2Nagoya University, Japan. 9:45 AM *PL01.02 4:45 PM A02.02 Jun Suda; Nagoya University, Development of Vertical GaN Power Devices Blue-Geen GaN-Based VCSEL with a Monolithic Curved Mirror Japan. Fabricated on a Free Standing Semi-Polar {20-21} GaN Substrate Tatsuya Matou, Tatsushi Hamaguchi, Kentaro Hayashi, Tatsuro Jyokawa, 10:30 AM BREAK Hiroshi Nakajima, Masayuki Tanaka, Noriko Kobayashi, Masamichi Ito, Maho Ohara, Hideki Watanabe, Rintaro Koda and Katsunori Yanashima; 11:00 AM *PL01.03 Sony Corporation, Japan. -

Wang Xiaosong Unkontrollierte Ameisen
Wang Xiaosong Unkontrollierte Ameisen Eröffnung: 23. August 2013, 18 Uhr 24. August bis 15. September 2013 Künstlerhaus, Obergeschoß Mit der von SCHÜTZ FINE ART organisierten Ausstellung “Unkontrollierte Ameisen” zeigt das Künstlerhaus zum ersten Mal in Österreich Werke des bedeutenden chinesischen Malers Wang Xiaosong, welche – erstmalig in Europa – auch zum Verkauf stehen. Der 1964 in Wuhan geborene Künstler Xiaosong studierte in Peking und Berlin, woraus das Zusammenfließen von chinesischer und westlicher Kunst in seinem Werk resultiert. Neben seiner Tätigkeit als Maler ist Wang Xiaosong seit 2003 Professor und Dekan an der Fakultät für Design der Zhejiang-Universität in Hangzhou. Mediales Aufsehen erregte Xiaosong 2011 mit seiner auf der Biennale in Venedig gezeigten systemkritischen Arbeit „Making Life (Das Schaffen des Lebens)“, welche als Gegenposition zu der vom offiziellen China gezeigten Kunst konzipiert war. Die meisten von Xiaosongs Gemälden kommen aufgrund ihrer reliefartigen Oberflächenstruktur Objekten sehr nahe, ein Eindruck, welcher in früheren Werken durch Untermalungen noch verstärkt wird. Viele seiner Gemälde wirken auf den ersten Blick wie monochrome Farbflächen, wobei in den neuesten Werken auch geringfügig Zweit- und Drittfarben zum Einsatz gelangen. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass die Oberfläche meist aus kleinen Menschenfiguren oder Ameisen besteht, welche vom Künstler in tagelanger Arbeit reliefartig auf die Leinwand aufgetragen werden. Diese in Massen auftretenden Menschlein und Ameisen symbolisieren die Macht des Volkes, welche dem kommunistischen Regime auf Dauer gefährlich werden könnte. Auf vielen seiner Gemälde bringt Xiaosong senkrechte, an weibliche Geschlechtsorgane erinnernde Öffnungen an, welche - je nach Sichtweise - Höllenschlund oder „L'Origine du monde (Ursprung der Welt)“ sein können. Wang Xiaosong, der in seinem Werk große Kunst mit Gesellschaftskritik zu vermengen versteht, ist einer der spannendsten Gegenwartskünstler Chinas. -

2017 IPR Newsletter
February 2018 INSTITUTE FOR POLYMER RESEARCH (IPR) UNIVERSITY OF WATERLOO WATERLOO, ONTARIO N2L 3G1 NEWSLETTER 2017 1. NOTE FROM PROFESSOR JEAN DUHAMEL, IPR DIRECTOR 2018 marks an important date for the IPR as the first annual IPR Symposium was held in 1978, 40 years ago! As we enter this new year, it is worth appreciating the remarkable foresight of the IPR founders, Profs. Kenneth O’Driscoll from Chemical Engineering and Alfred Rudin from Chemistry, who created at UW an institution that after 40 years of activity, continues to promote polymer research at an impressive pace and scale. With 15 members all active in polymer research, the IPR remains one of the most “polymer active” center in North America. In 2017, the IPR as a whole, published 39 papers in high ranking journals. Another indication of the dynamism of the IPR is the addition of another faculty member, bringing the IPR membership to 16. Prof. Derek Schipper from the Department of Chemistry has joined the IPR in November 2017. His research interests are in organic and material chemistry with a focus on the preparation of conjugated materials. The IPR is delighted to welcome him and his group. The place where the research activity generated by the IPR comes into full force is, of course, the annual IPR Symposium which was held on May 3rd, 2017. Nimer Murshid and Jesse Quinn from the laboratories of Profs. Wang (Chemistry) and Li (Chem. Eng.) were the 2017 IPR awardees. They gave two well‐received presentations on the associations generated by building blocks containing metal‐carbonyl motives and on sensors working with organic thin‐film transistors. -

Profiles of Directors, Supervisors and Senior Management
Profiles of Directors, Supervisors and Senior Management Directors Li Xiaopeng Mr. Li is Vice President of State Power Corporation, Chairman of the Company, Chairman and President of HIPDC, as well as President of China Huaneng Group. From June 1994 to December 2002, Mr. Li was Vice President, President and Vice Chairman of the Company as well as Vice President, President and Vice Chairman of HIPDC and Chairman of Huaneng Group. Before joining HIPDC, he had successively served as Engineer of the Power System Research Division, as Deputy Division Chief of the Planning and Operations Division, and as General Manager of the Power Technology and Economic Research Division, Electric Power Research Institute. Mr. Li is a senior engineer and graduated from the North China Institute of Electric Power specializing in power plants and power systems. Wang Xiaosong Mr. Wang is Vice Chairman of the Company, Director and Vice President of HIPDC, and Vice President of Huaneng Group. From June 1994 to December 2002, he was General Manager of the Capital Market Department of the Company, Vice President of the Company, Vice President of HIPDC and Director of Huaneng Group. Before joining the Company, he had served as Deputy General Manager of Fushun Power Plant, General Manager of Yuanbaoshan Power Plant and Chief of the Labour and Wages Division of Northeast Power Administration. Mr. Wang is a senior engineer and graduated from Beijing Institute of Electric Power specializing in thermal power engineering. Ye Daji Mr. Ye is Director and President of the Company. After joining the Company, he has been Deputy General Manager of Huaneng Shanghai Branch and General Manager of Huaneng Shanghai Shidongkou Second Power Plant. -

Table of Contents
TABLE OF CONTENTS 1. FALUN GONG PRACTITIONERS WHO HAVE REPORTEDLY RECEIVED PRISON SENTENCES OR ADMINISTRATIVE SENTENCES .................................................................................................................................................. 3 2. FALUN GONG PRACTITIONERS WHO MAY REMAIN IN DETENTION ................................................................... 27 3. FALUN GONG PRACTITIONERS REPORTED TO HAVE BEEN DETAINED WHOSE SUBSEQUENT FATE IS UNKNOWN ................................................................................................................................................................. 51 2 List of sentences, administrative sentences and those detained PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Falun Gong practitioners: list of sentences, administrative sentences and those detained Sources : this information has been compiled from Falun Gong sources, news releases from the Information Centre for Human Rights and Democractic Movement in China, Reuters, AFP, AP and other press agencies and newspapers published prior to 18 March 2000. KEY: D = district C = city Co = county 1. FALUN GONG PRACTITIONERS WHO HAVE REPORTEDLY RECEIVED PRISON SENTENCES OR ADMINISTRATIVE SENTENCES NAME OCCUPATION PLACE OF DETENTION TRIAL/ SENTENCING CHARGE AND/OR SENTENCE NOTES ORIGIN DATE RE-EDUCAT BODY ACCUSATION ION DATE BEIJING MUNICIPALITY Ji Liewu, 36 Manager of a Hong 20/07/99 26/12/99 Beijing No.1 charged on 19/10/99 12 years’ Accused of holding a position of Kong subsidiary of a Intermediate with "illegal obtaining -

455911 1 En Bookfrontmatter 1..22
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 209 Editorial Board Ozgur Akan Middle East Technical University, Ankara, Turkey Paolo Bellavista University of Bologna, Bologna, Italy Jiannong Cao Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong Geoffrey Coulson Lancaster University, Lancaster, UK Falko Dressler University of Erlangen, Erlangen, Germany Domenico Ferrari Università Cattolica Piacenza, Piacenza, Italy Mario Gerla UCLA, Los Angeles, USA Hisashi Kobayashi Princeton University, Princeton, USA Sergio Palazzo University of Catania, Catania, Italy Sartaj Sahni University of Florida, Florida, USA Xuemin Sherman Shen University of Waterloo, Waterloo, Canada Mircea Stan University of Virginia, Charlottesville, USA Jia Xiaohua City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong Albert Y. Zomaya University of Sydney, Sydney, Australia More information about this series at http://www.springer.com/series/8197 Qianbin Chen • Weixiao Meng Liqiang Zhao (Eds.) Communications and Networking 11th EAI International Conference, ChinaCom 2016 Chongqing, China, September 24–26, 2016 Proceedings, Part I 123 Editors Qianbin Chen Liqiang Zhao Post and Telecommunications Xidian University Chongqing University Xi’an Chongqing China China Weixiao Meng Harbin Institute of Technology (HIT) Harbin China ISSN 1867-8211 ISSN 1867-822X (electronic) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering ISBN 978-3-319-66624-2 ISBN 978-3-319-66625-9