Vorwort Heft 4-09
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
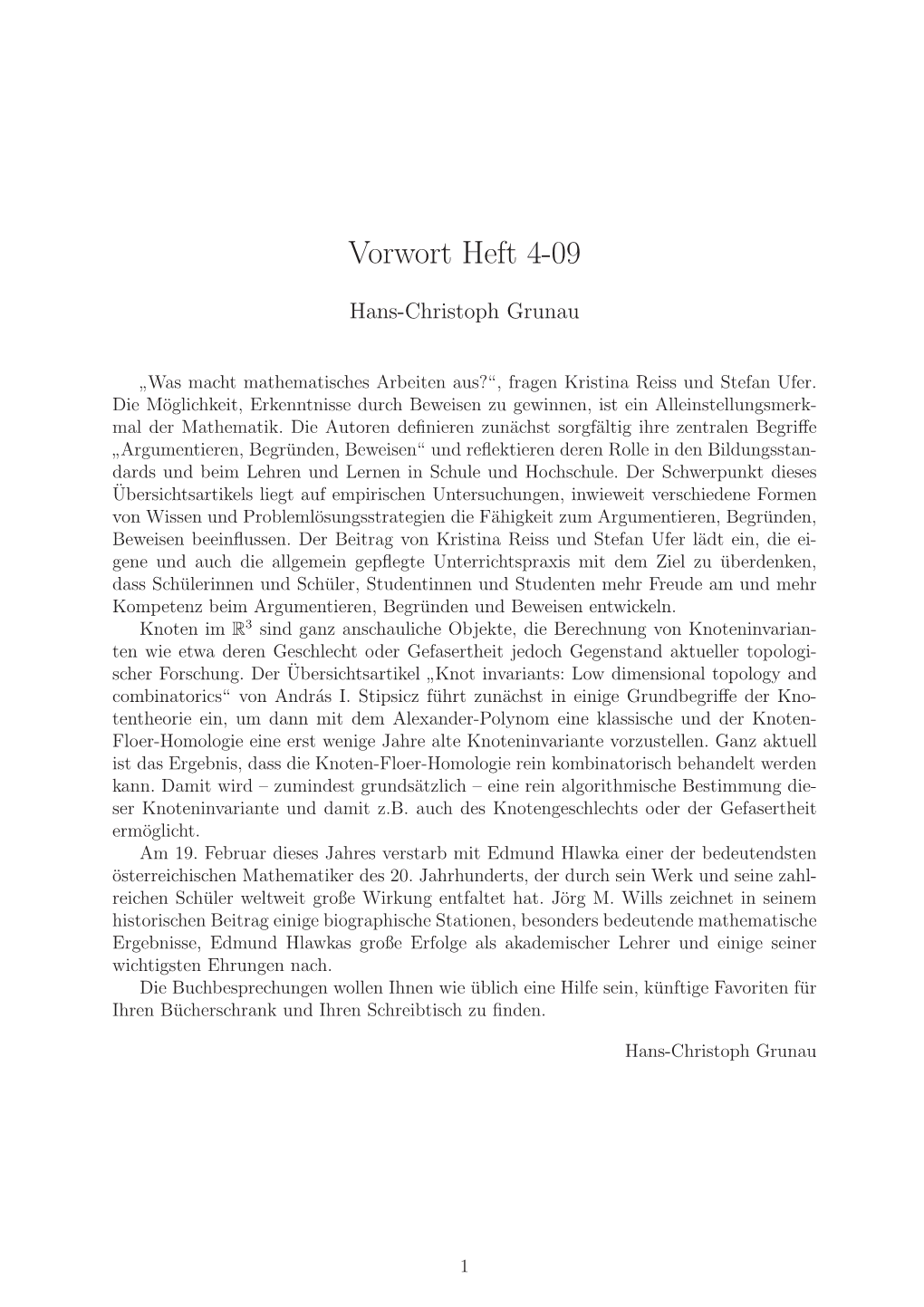
Load more
Recommended publications
-

Doctoral Program DISCRETE MATHEMATICS Supplement 1
Doctoral Program DISCRETE MATHEMATICS Supplement 1 Speaker: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Woess Institut für Mathematische Strukturthorie, TU Graz Steyrergasse 30 / III, A-8010 GRAZ, AUSTRIA Tel.: ++43 316 873 7130, Fax.: ++43 316 873 4507 email: [email protected] Deputy Speaker: Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr. Alfred Geroldinger Institut für Mathematik und Wissenschafliches Rechnen, Universität Graz Heinrichstraße 36, A-8010 GRAZ, AUSTRIA Tel.: ++43 316 380 5154 , Fax.: ++43 316 380 9815 email: [email protected] Deputy Speaker: Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Jörg Thuswaldner Institut für Mathematik und Informationstechnologie, Montanuniversität Leoben Franz-Josef-Strasse 18, A-8700 Leoben, AUSTRIA Tel.: ++43 3842 402 3805, Fax.: ++43 3842 402 3802 email: [email protected] Secretary of the Speaker: Christine Stelzer Institut für Mathematische Strukturthorie, Technische Universität Graz Steyrergasse 30 / III, A-8010 GRAZ, AUSTRIA Tel.: ++43 316 873 7131, Fax.: ++43 316 873 4507 email: [email protected] 57 Supplement 1 (Beilage 1) Description of the Achievements and Goals of the Researchers Contents 1. Project 01: Random walk models on graphs and groups 59 2. Project 02: Probabilistic methods in combinatorial number theory 70 3. Project 03: Additive group theory, zero-sum theory and non-unique factorizations 77 4. Project 04: Fractal analysis and combinatorics of digital expansions 83 5. Project 05: Digital expansions with applications in cryptography 90 6. Project 06: Polynomial diophantine equations - combinatorial and number theoretic aspects 97 7. Project 07: Structural investigations on combinatorial optimization problems 104 8. Project 08: Number systems and fractal structures 115 9. -

Uniform Distribution Theory 5 (2010), No.1, 1–12 Distribution Theory
uniform Uniform Distribution Theory 5 (2010), no.1, 1–12 distribution theory EDMUND HLAWKA (1916 - 2009) The eminent Austrian mathematician Edmund Hlawka passed away on Feb- ruary 19, 2009. He was born in 1916 in Bruck an der Mur (Styria) and obtained his complete education in Vienna. Edmund Hlawka was a student at the mathe- matics department of the university of Vienna in the thirties of the last century. This department was very famous in the period 1918 – 1938: Hahn, Wirtinger, Furtw¨angler, G¨odel, Menger and many other mathematicians worked there. Edmund Hlawka wrote his first papers as a student, and they were devoted to the asymptotic analysis of special functions, see [Top 151 in the enclosed list of publications which was taken from Mathematical Reviews]. He received his PhD in 1938 (supervisor: N. Hofreiter) with a remarkable result on the diophantine approximation of complex linear forms, see [Top 149]. Edmund Hlawka became famous all over the world after the publication of his habilitation thesis (see Top 146), where he solved an old problem of Minkowski in the geometry of numbers. After the war he became a full professor of mathematics at the University of Vienna where he remained until 1981. Then he moved to Vienna University of Technology. This position he held until his retirement in 1987. There are several results which are connected with the name of Edmund Hlawka, and for which he is widely known: i) The Hornich-Hlawka inequality in Euclidean vector spaces: ∣∣a∣∣ + ∣∣b∣∣ + ∣∣c∣∣ + ∣∣a + b + c∣∣ ≥ ∣∣a∣∣ + ∣∣b∣∣ + ∣∣c∣∣ + ∣∣b + c∣∣ The original proof is due to H. -
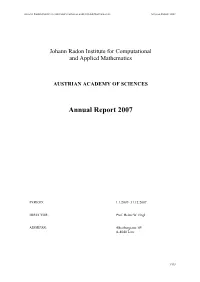
Austrian Academy of Sciences
JOHANN RADON INSTITUTE FOR COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS ANNUAL REPORT 2007 Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES Annual Report 2007 PERIOD: 1.1.2007- 31.12.2007 DIRECTOR: Prof. Heinz W. Engl ADDRESS: Altenbergerstr. 69 A-4040 Linz 1/193 JOHANN RADON INSTITUTE FOR COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS ANNUAL REPORT 2007 C o n t e n t 1. INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 2. THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE IN GENERAL.............................................................. 4 2.1 THE MISSION ................................................................................................................................................ 4 2.2 THE RESEARCH GROUPS: DEVELOPMENT, PLANS......................................................................................... 5 2.3 SCIENTIFIC PERSONNEL................................................................................................................................ 7 2.4 THE ADVISORY BOARDS............................................................................................................................. 10 2.5 AWARDS, PUBLICITY .................................................................................................................................. 11 2.6 RICAM AND MATHEMATICAL SCIENCES IN LINZ...................................................................................... 12 2.7 -

Scientific Report for 2003
The Erwin Schr¨odinger International Boltzmanngasse 9/2 ESI Institute for Mathematical Physics A-1090 Vienna, Austria Scientific Report for 2003 Impressum: Eigent¨umer, Verleger, Herausgeber: The Erwin Schr¨odinger International Institute for Math- ematical Physics, Boltzmanngasse 9, A-1090 Vienna. Redaktion: Joachim Schwermer, Jakob Yngvason Supported by the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. A PREFACE BY THE PRESIDENT 1 A preface by the President The Erwin Schr¨odinger International Institute for Mathematical Physics (ESI) was officially opened in April 1983 and is now in its 11th year of operation. Within these eleven years the ESI has established itself as a research centre of international excellence in the mathematical sciences. To date well over 2400 scientists have visited the Institute, many of them repeatedly, and most of the leading researchers in mathematics and mathematical physics have worked here at some stage during this period. The research activities of the ESI are documented in almost 1500 ESI preprints, the overwhelming majority of which were subsequently published in leading international journals. Far from having been a routine year for the Institute, 2003 saw some important developments and changes at the ESI. The first and most alarming of these was a significant cut in the basic funding of ESI (and of practically all comparable Austrian research institutions) by the Ministry of Science: in June 2003 we were notified of a 14.3% reduction in our recurrent grant for 2003. Since our recurring costs are fairly constant, this meant an effective reduction of our scientific budget by well over 25%. Although this forced us to take quite harsh emergency measures we were able to maintain all our scientific activities, albeit at a somewhat reduced level, by using reserves. -

The Mathematical Work of Walter Philipp (1936 – 2006)
Dependence in probability, analysis and number theory: The mathematical work of Walter Philipp (1936–2006) Istv´an Berkes and Herold Dehling Introduction On July 19, 2006, Professor Walter Philipp passed away during a hike in the Aus- trian Alps as a result of a sudden heart attack. By the time of his death, Walter Philipp had been for almost 40 years on the faculty of the University of Illinois at Urbana-Champaign, for the last couple of years as professor emeritus. He is sur- vived by his wife Ariane and his four children, Petra, Robert, Anthony and Andr´e. Walter Philipp is sorely missed by his family, but also by his many colleagues, coau- thors and former students all over the world, to whom he was a loyal and caring friend for a long time, in some cases for several decades. Walter Philipp was born on December 14, 1936 in Vienna, Austria, where he grew up and lived for most of the first 30 years of his life. He studied mathematics and physics at the University of Vienna, where he obtained hisPh.D. in 1960and his habilitation in 1967, both in mathematics. From 1961 until 1967 he was scientific assistant at the University of Vienna. During this period, Walter Philipp spent two years as a postdoc in the US, at the University of Montana in Missoula and at the University of Illinois. In the fall of 1967 he joined the faculty of the University of Illinois at Urbana-Champaign, where he would stay for the rest of his life. Initially, Walter Philipp was on the faculty of the Mathematics Department, but in 1984 he joined the newly created Department of Statistics at the University of Illinois. -

Avstrijski Simpoziji O Zgodovini Matematike
Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Marko in Nada Razpet Univerza v Ljubljani, Pedagoˇska fakulteta Ljubljana, 18. oktober 2010 Marko in Nada Razpet Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Avstrija Marko in Nada Razpet Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Christa Binder Marko in Nada Razpet Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Edmund Hlawka (1916{2009) Marko in Nada Razpet Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Edmund Hlawka { doktorandi { 1. del Matthias Baaz, Universit¨at Wien 1984, 6 Christa Binder, Universit¨at Wien 1971 Norbert Brunner, Universit¨atWien 1980 Rainer Burkard, Universit¨atWien 1967, 67 Johann Cigler, Universit¨atWien 1959, 127 Willibald D¨orfler,Universit¨atWien 1967 Dietmar Dorninger, Universit¨atWien 1969, 2 Rudolf Einhorn, Technische Universit¨atWien 1984 Gustav Feichtinger, Universit¨atWien 1963, 6 Herbert Fleischner, Universit¨atWien 1968, 2 Peter Flor, Universit¨atWien 1958, 6 Peter Gerl, Universit¨atWien 1962, 11 Marko in Nada Razpet Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike Edmund Hlawka { doktorandi { 2. del Wilfried Grossmann, Universit¨atWien 1974, 5 Peter Gruber, Universit¨atWien 1966, 17 Wilfried Hazod, Universit¨atWien 1967, 20 Gilbert Helmberg, Universit¨atWien 1950, 22 Wolfgang Herfort, Universit¨atWien 1972, 4 Wilfried Imrich, Universit¨atWien 1965, 34 Peter Kirschenhofer, Universit¨atWien 1979, 8 Walter Kn¨odel,Universit¨atWien 1948, 147 Werner Kuich, Universit¨atWien 1965, 12 Franz Liebmann, Universit¨atWien 1971 Hermann Maurer, Technische Universit¨atWien 1965, 148 -

Nachruf Auf Edmund Hlawka
Monatsh Math (2009) 158:107–120 DOI 10.1007/s00605-009-0143-x Nachruf auf Edmund Hlawka Robert F. Tichy Received: 16 June 2009 / Accepted: 30 June 2009 / Published online: 1 September 2009 © Springer-Verlag 2009 Edmund Hlawka, 1916–2009 Am 19. Februar 2009 ist der bedeutende Mathematiker Edmund Hlawka in seiner Wohnung in Wien verstorben. Er war viele Jahrzehnte lang ein weltweit sichtbares Wahrzeichen der österreichischen Mathematik mit hervorragenden Ergebnissen in der Forschung und einem sehr großen Schülerkreis. Am 5. November 1916 in Bruck an der Mur geboren, übersiedelte Hlawka mit seinen Eltern bald nach Wien, wo er die Volksschule und das Realgymnasium im 3. Bezirk absolvierte. Schon als Schüler (angeregt durch seinen Lehrer) beschäftigte er sich intensiv mit Mathematik, und nach der Matura inskribierte er an der Universität R. F. Tichy (B) Institut für Mathematik, TU Graz, Steyrergasse 30, 8010 Graz, Austria e-mail: [email protected] 123 108 R. F. Tichy Wien, wo er Mathematik, Physik und Astronomie studierte. Zu dieser Zeit wirkten dort am Mathematischen Institut berühmte Gelehrte wie z.B. Hahn, Gödel, Furtwängler und Wirtinger. Noch als Student publizierte er seine erste Arbeit in den Monatshef- ten über Laguerresche Polynome, promoviert hat er allerdings 1938 mit einer Arbeit über diophantische Approximation im Komplexen. Weltruhm erlangte er wenige Jahre später durch seine Habilitationsschrift (1944), in der er eine alte Vermutung von Minkowski aus der Geometrie der Zahlen bewiesen hat. Im Jahr 1947 kam ein Ruf an die Technische Hochschule in Graz, und im Jahr 1948 wurde er zum ordent- lichen Professor an der Universität Wien ernannt, wo er zweimal Dekan war und bis 1981 blieb. -

The Mathematical Work of Walter Philipp (1936 - 2006)
Dependence in Probability, Analysis and Number Theory: The Mathematical Work of Walter Philipp (1936 - 2006) Istvan´ Berkes and Herold Dehling Introduction On July 19, 2006, Professor Walter Philipp passed away during a hike in the Austrian Alps as a result of a sudden heart attack. By the time of his death, Walter Philipp had been for almost 40 years on the faculty of the University of Illinois at Urbana-Champaign, for the last couple of years as professor emeritus. He is survived by his wife Ariane and his four children, Petra, Robert, Anthony and Andr´e.Walter Philipp is sorely missed by his family, but also by his many colleagues, coauthors and former students all over the world, to whom he was a loyal and caring friend for a long time, in some cases for several decades. Walter Philipp was born on December 14, 1936 in Vienna, Austria, where he grew up and lived for most of the first 30 years of his life. He studied mathematics and physics at the University of Vienna, where he obtained his Ph.D. in 1960 and his habilitation in 1967, both in mathematics. From 1961 until 1967 he was scientific assistant at the University of Vienna. During this period, Walter Philipp spent two years as a postdoc in the US, at the University of Montana in Missoula and at the University of Illinois. In the fall of 1967 he joined the faculty of the University of Illinois at Urbana-Champaign, where he would stay for the rest of his life. Initially, Walter Philipp was on the faculty of the Mathematics Department, but in 1984 he joined the newly created Department of Statistics at the University of Illinois. -

Robert F. Tichy: 50 Years — the Unreasonable Effectiveness of a Number Theorist
ROBERT F. TICHY: 50 YEARS | THE UNREASONABLE EFFECTIVENESS OF A NUMBER THEORIST HANSJORÄ G ALBRECHER, MICHAEL DRMOTA, MARTIN GOLDSTERN, PETER J. GRABNER, AND REINHARD WINKLER Figure 1. Climbing in the GesÄause. The present volume of UDT is devoted to Robert F. Tichy on the occasion of his 50th birthday. We cordially congratulate him on this occasion and wish him the best for the future. In this short note we collect highlights of his scienti¯c work. Together with more than 70 coauthors he has written over 200 papers so far, with topics that range from number theory to applications in actuarial mathematics and also mathematical chemistry. But, of course, the scienti¯c work is only one facet of Robert Tichy's person- ality. It is remarkable how many students graduated under his supervision since 1984. At least 25 PhD students are known to us, including the ¯ve authors of the yThe title alludes to E. Wigner's 1960 article \The unreasonable e®ectiveness of mathematics in the natural sciences", and to S. A. Burr's 1992 book \The unreasonable e®ectiveness of number theory". Both touch aspects of mathematics and number theory which are in Robert Tichy's spirit. 1 2 H. ALBRECHER, M. DRMOTA, M. GOLDSTERN, P. GRABNER, AND R. WINKLER present article. The majority of his former students are still active researchers in mathematics, 9 with habilitation, three of them in the position of a full professor. Such quantities, though very impressive, do not explain the individuality of an academic personality. We remember the time when we were students and Robert Tichy was a very young docent of less than 30 years in Vienna and then, with 33, professor in Graz.