Nietzsches Begriff Der Decadence: Kritik Und Analyse Der Moderne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
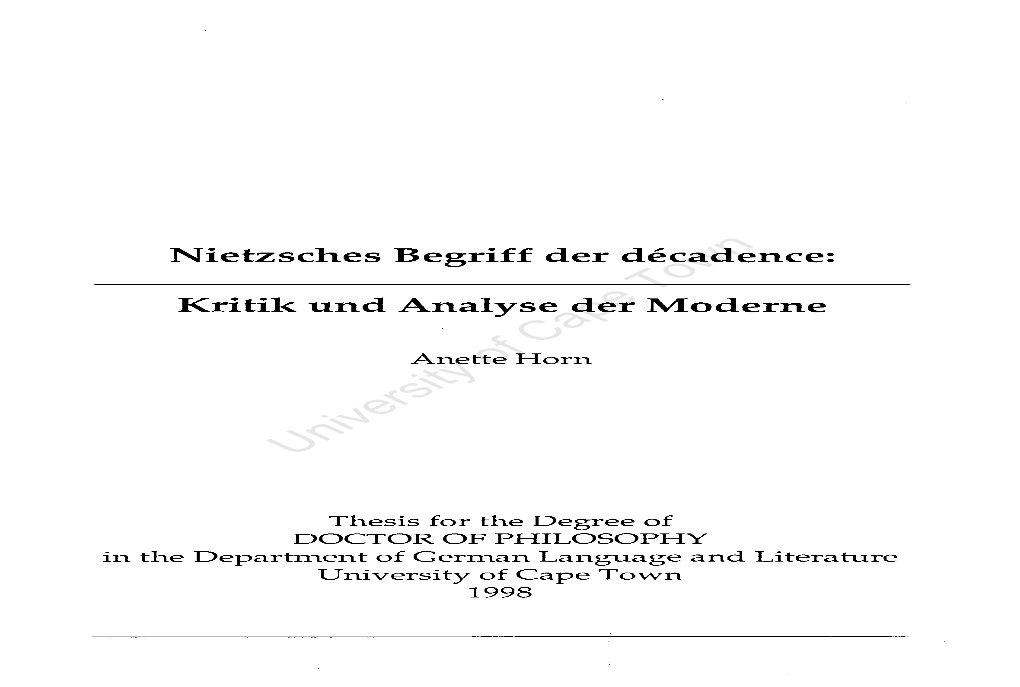
Load more
Recommended publications
-

Radical Theology and the Death of God by Thomas Altizer and William Hamilton
Radical Theology and the Death of God return to religion-online Radical Theology and the Death of God by Thomas Altizer and William Hamilton Thomas J.J. Altizer is a native of Charleston, West Virginia. He attended St. John’s College, Annapolis, Maryland, and received his degrees of A.B., A.M., and Ph.D. at the University of Chicago. He was Associate Professor of Bible and Religion at Emory University, Atlanta Georgia. William Hamilton is a graduate of Oberlin and Union Theological School. He received his Ph.D. degree from St. Andrews in Scotland in 1953. He is Professor and Dean at the College of Arts and Sciences, Oregon State University, in Portland. Published by The Bobbs-Merrill Company, Inc. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co. This material was prepared for Religion Online by Ted & Winnie Brock. The aim of the new theology is not simply to seek relevance or contemporaneity for its own sake but to strive for a whole new way of theological understanding. Thus it is a theological venture in the strict sense, but it is no less a pastoral response hoping to give support to those who have chosen to live as Christian atheists. Preface Radical theology is peculiarly a product of the mid-twentieth century; it has been initiated by Barth and neo-orthodoxy into a form of theology which can exist in the midst of the collapse of Christendom and the advent of secular atheism. Part 1: Introductions to the Radical Theology American Theology, Radicalism and the Death of God by William Hamilton There is an experience of loss among the radical death of God theologians. -

Franz Kafka and Maurice Blanchot
Writing and the Other: Franz Kafka and Maurice Blanchot A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy In the Faculty of Humanities 2011 Hossein Moradi School of Arts, Histories and Cultures 1 Content Abstract 3 Declaration and Copyright Statement 4 Acknowledgment 5 Introduction: Franz Kafka and Maurice Blanchot: The Space for the Other in Writing 6 Chapter 1: Literature in Blanchot: Worklessness as Spacing between Word and Its Referent 30 Chapter 2: What is Worklessness in Kafka? 50 Chapter 3: The Act of Writing Part I: The Disappearance of Self 67 Chapter 4: The Act of Writing Part II: Self and the Impossibility of Death 86 Chapter 5: Memory and Récit in Blanchot 111 Chapter 6: The Primal Scene and Récit in Blanchot 132 Chapter 7: Kafka's Fictions and the Impossibility of Narration as Récit 155 Conclusion 176 General Bibliography 191 Final word count, including footnotes: 77095 words 2 Abstract The University of Manchester Hossein Moradi Doctor of Philosophy May 2011 Writing and the Other: Franz Kafka and Maurice Blanchot This thesis attempts to explore what occurs in the act of writing; arguing that the act of writing opens a space for 'the other.' For this argument, I bring Franz Kafka who has remained unthought in terms of the act of writing in the deconstructive thinking close to Maurice Blanchot who writes both theoretical discussion and fiction specifically on the act of writing. Blanchot has written extensively on Kafka; his récits also are influenced by Kafka. In the introduction, I argue through Borges and Benjamin that Kafka and Blanchot create their past and future, so that we understand any text in the past or the future differently if we know them. -

A Philosophical Poetic Recourse Into Sameness
1 Poetics of the Same: A Philosophical Poetic Recourse into Sameness Astghik Simonyan Submitted for PhD Degree Queen Mary, University of London December 2010 2 Abstract This study endeavours to investigate the philosophical and poetological dimensions, the philological origins, and significant philosophical-literary representations of the Same. It also assesses sameness as a philosophical and poetological modus operandi; that is to say, it analyzes the ways in which the Same operates in different types of discourses both as an object of investigation and as an agent of (poetic) thought. The concept of the Same or the operation of sameness as the philosophical question par excellence will be considered in the development of Continental philosophy and philosophical poetics from classical antiquity to Postmodernism, and its transposition into poetry. The elaboration of the issue of sameness encompasses any philosophical inquiry which seeks to establish the essence of Being and make it susceptible to a general, unifying principle: as a search for an underlying element; for a metaphysical unity or universal, preceding division or difference and amounting to the harmony in the Universe; or for a transcendental absolute totality. Postulations of the pure conceptual difference are likewise examined as part of the elaboration of sameness, and will be viewed as indispensable for revealing the genuine plenitude of sameness. Part One traces the inception of sameness as a concept of pure identity, amounting to the harmony of the Universe by virtue of the operations of belonging (Presocratics), participation (Plato), and emanation (Plotinus), anchored in the relationships between the One and the many, between the Whole and its parts, between the Original and the copy. -

Wittgenstein and Nietzsche: Two Critics of Philosophy
Wittgenstein and Nietzsche: Two Critics of Philosophy by Anu Koshal Graduate Program in Literature Duke University Date: July 23, 2010 Approved: ___________________________ Toril Moi, Supervisor __________________________ Richard Fleming __________________________ V.Y. Mudimbe __________________________ Michael Hardt Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate Program in Literature in the Graduate School of Duke University 2010 ABSTRACT Wittgenstein and Nietzsche: Two Critics of Philosophy by Anu Koshal Graduate Program in Literature Duke University Date: July 23, 2010 Approved: ___________________________ Toril Moi, Supervisor __________________________ Richard Fleming __________________________ V.Y. Mudimbe __________________________ Michael Hardt An abstract submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate Program in Literature in the Graduate School of Duke University 2010 ii Copyright by Anu Koshal 2010 iii ABSTRACT Few philosophers have been more critical of the Western philosophical tradition than Friedrich Nietzsche and Ludwig Wittgenstein. Nietzsche and Wittgenstein did not just reject the conclusions of their philosophical predecessors; they rejected their most basic assumptions. They rejected the very idea of philosophy as the attempt to rationally develop objective theories of the world. And yet Wittgenstein and Nietzsche have now been absorbed into the discipline they wanted to abolish. This dissertation attempts to recapture the force and extent of their respective criticisms of philosophy, and evaluate their conceptions of what philosophy should be. I begin by examining Wittgenstein’s claim that philosophical problems rest on a misunderstanding of language. I show that this claim does not entail a quietist refusal to engage in philosophical problems, as many have argued. -

Franz Kafka's
Kafka and the Universal Interdisciplinary German Cultural Studies Edited by Irene Kacandes Volume 21 Kafka and the Universal Edited by Arthur Cools and Vivian Liska An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. ISBN 978-3-11-045532-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-045811-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-045743-8 ISSN 1861-8030 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Franz Kafka, 1917. © akg-images / Archiv K. Wagenbach Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Table of Contents Arthur Cools and Vivian Liska Kafka and the Universal: Introduction 1 Section 1: The Ambiguity of the Singular Stanley Corngold The Singular Accident in a Universe of Risk: An Approach to Kafka and the Paradox of the Universal 13 Brendan Moran Philosophy and Ambiguity in Benjamin’s Kafka 43 Søren Rosendal The Logic of the “Swamp World”: Hegel with Kafka on the Contradiction of Freedom 66 Arnaud Villani The Necessary Revision of the Concept of the Universal: Kafka’s “Singularity” 90 Section 2: Before the Law Eli Schonfeld Am-ha’aretz: The Law of the Singular. -

Genealogie Bei Nietzsche
Genealogie bei Nietzsche Zur Logik des Genetischen bei Nietzsche Wissenschaftliche Hausarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magister Artium dem Philosophischen Seminar des Fachbereichs Philosophie und Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg vorgelegt von Heiko Wichmann Erstgutachter: Dr. Bernhard H. F. Taureck Zweitgutachter: Prof. Dr. Wolfgang Bartuschat Hamburg, 1995 1. Zur Problemstellung: der Begriff der Genealogie ....... 3 a) die Problemstellung der Arbeit ................. 3 b) Diskussion und Forschungssituation ............ 10 c) vom Réealismus zur Genealogie ................. 27 2. Genealogie als Etymologie der Wertbegriffe und als Typologie der Kräfte ................................. 37 3. Asketisches Ideal und Ressentiment in genealogischer Perspektive .......................................... 55 4. Exkurs: Genealogie und die klassische Geschichtswissenschaft ............................... 69 5. Zusammenfassung ...................................... 77 Literatur ............................................... 80 Erklärung ............................................... 86 Lebenslauf .............................................. 87 1.! Zur Problemstellung: der Begriff der Genealogie 3 ! a) die Problemstellung der Arbeit Genus "Art, Gattung; grammatisches Geschlecht". Das Fremdwort ist eine nhd. Entlehnung aus lat. genus "Geschlecht; Gesamtheit der Nachkommenschaft; Art, Gattung", das identisch ist mit griech. génos. Beide sind Nominalbildungen zu dem idg. Verbalstamm *gen-^ "gebären, erzeugen", der -
Nietzsche's Works and Their Themes Pp
Cambridge Companions Online http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions/ The Cambridge Companion to Nietzsche Edited by Bernd Magnus, Kathleen Higgins Book DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CCOL0521365864 Online ISBN: 9781139000604 Hardback ISBN: 9780521365864 Paperback ISBN: 9780521367677 Chapter 1 - Nietzsche's works and their themes pp. 21-68 Chapter DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CCOL0521365864.002 Cambridge University Press BERND MAGNUS AND KATHLEEN M. HIGGINS 1 Nietzsche's works and their themes Interpretation of Nietzsche's thought is a complex enterprise. Be- cause of his avoidance of any conventional philosophical system and his many experiments with styles and genres, Nietzsche's writings seem to demand a sense of active reading. The "Nietzsche" that emerges from scholarly discussion typically depends on the interests of the interpreter and especially often those of the interpreter's disci- pline. Themes which are taken to be most central to Nietzsche's philosophy often depend on which works are regarded as most impor- tant or most accessible; but the relative importance which attaches to each of Nietzsche's works is by no means obvious. Indeed, Nietz- sche scholarship has experienced fads with regard to given points of interest. As we will consider below, Thus Spoke Zaiathustia's celeb- rity outside of Germany declined after the Nazis invoked it for propa- gandistic purposes, while Nietzsche's early essay "On Truth and Lies in a Nonmoral Sense" has assumed new importance in recent literary-critical discussion, in part because it suggests that all lan- guage is metaphoric. In what follows, we shall trace the chronology of Nietzsche's writ- ings, mentioning themes that are prominent in each work. -

Modernism After Nietzsche: Art, Ethics, and the Forms of the Everyday
Modernism after Nietzsche: Art, Ethics, and the Forms of the Everyday by Brian C. Valentyn Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Michael Moses, Supervisor ___________________________ Toril Moi ___________________________ Thomas Pfau ___________________________ Thomas Ferraro Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2012 ABSTRACT Modernism after Nietzsche: Art, Ethics, and the Forms of the Everyday by Brian C. Valentyn Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Michael Moses, Supervisor ___________________________ Toril Moi ___________________________ Thomas Pfau ___________________________ Thomas Ferraro An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2012 Copyright by Brian C. Valentyn 2012 Abstract This dissertation uses Nietzsche‟s writings on truth and metaphor as a lens through which to reconsider the contribution that modernist art sought to make to both the understanding and, ultimately, the reconstruction of everyday life. It begins with a consideration of the sentiment, first articulated on a wide scale by the artists and philosophers of the romantic era, that something essential to the cohesion of individual and social experience has been lost during the turbulent transition to modernity. By situating Nietzsche‟s thought vis-à-vis the decline of nineteenth-century idealism in both its Continental and Victorian forms, I demonstrate how his principal texts brought to an advanced stage of philosophical expression a set of distinctly post-romantic concerns about the role of mind and language in the construction of reality that would soon come to define the practice of modernism in philosophy and the arts. -
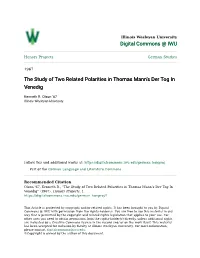
The Study of Two Related Polarities in Thomas Mann's Der Tog in Venedig
Illinois Wesleyan University Digital Commons @ IWU Honors Projects German Studies 1967 The Study of Two Related Polarities in Thomas Mann's Der Tog In Venedig Kenneth R. Olson '67 Illinois Wesleyan University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.iwu.edu/german_honproj Part of the German Language and Literature Commons Recommended Citation Olson '67, Kenneth R., "The Study of Two Related Polarities in Thomas Mann's Der Tog In Venedig" (1967). Honors Projects. 1. https://digitalcommons.iwu.edu/german_honproj/1 This Article is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Commons @ IWU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this material in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This material has been accepted for inclusion by faculty at Illinois Wesleyan University. For more information, please contact [email protected]. ©Copyright is owned by the author of this document. A Study of Two Related / Sets of Polarities in Thomas Mann' s � Tod In Venedig By Kenneth R. Olson Jj ARCHIVES f?33 ;11 Submitted for Honors OSc2...- Work in the Department of German Illinois Wesleyan University Bloomington, Illinois 1967 Libraries Illinols Wesleyan Univ. TJ'1 ___ -4...... '""+n1"l Tl1_ fi17011 Accepted by the Department of German of Illinois Wesleyan University in fulfillment of the Requirement for Departmental Honors. -

The Penn State Series in German Literature the Penn State Series in German Literature
The Penn State Series in German Literature The Penn State Series in German Literature General Editor Joseph P. Strelka, State University of New York at Albany Editorial Board Stuart Atkins, University of California at Santa Barbara Peter Demetz, Yale University Reinhold Grimm, University of Wisconsin Karl Guthke, Harvard University Erich Heller, Northwestern University Victor Lange, Princeton University Rio Preisner, The Pennsylvania State University Henry Remak, Indiana University Oskar Seidlin, Indiana University Walter Sokel, University of Virginia Blake Lee Spahr, University of California at Berkeley Wilhelm Miiller, The Poet of the Schubert Song Cycles: His Life and Works, by Cecilia C. Baumann German Baroque Poetry, 1618-1723, by Robert M. Browning German Poetry in the Age of the Enlightenment, by Robert M. Browning Georg Trakl's Poetry: Toward a Union of Opposites, by Richard Detsch Kafka's Narrative Theater, by James Rolleston War, Weimar, and Literature: The Story of the New Merkur, 1914-1925, by Guy Stern The Leitword in Minnesang: A New Approach to Stylistic Analysis and Textual Criticism, by Vickie L. Ziegler Richard Beer-Hofmann: His Life and Work, by Esther N. Elstun Figures of Identity "Man erinnere sich, was wir oben von der Lehre des Roger Baco mitge- teilt . , daR sich namlich jede Tugend, jede Kraft, jede Tiichtigkeit, alles dem man ein Wesen, ein Dasein zuschreiben kann, ins Unendliche verviel- faltigt und zwar dadurch, daR immerfort Gleichbilder, Gleichnisse, Abbil- dungen als zweite Selbstheiten von ihm ausgehen, dergestalt, daR diese Ab- bilder sich wieder darstellen, wirksam werden, und indem sie immer fort und fort reflektieren, diese Welt der Erscheinungen ausmachen." Goethe's Schriften zur Farbenlehre, "Intentionelle Farben" Figures of Identity Goethe's Novels and the Enigmatic Self Clark S. -

AN INTERPRETATION of Niefzsche's POLITICAL EDUCATION a DISSERTATION SUBMITTED to the GRADUATE DIVISION OF
THE UNTIMELY EDUCATOR: AN INTERPRETATION OF NIEfZSCHE'S POLITICAL EDUCATION A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI'I IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL FOUNDATIONS AUGUST 2005 By Richard Anton St. Onge Dissertation Committee: David Ericson, Chairperson Graham Parkes Stacy Roberts Hunter McEwan Thomas Jackson Acknowledgments My good friend Peter Maguire helped me improve the content as well as the form ofthe dissertation. His patience, generosity, and counselwas invaluable. My father, Richard Arthur St. Onge, is rightly owed thanks. He is a physician and educator in the fullest and, often, the finest sense. I benefitted from our conversations about nature, health, education, and politics. His criticisms afforded constructive insights. To the members ofmy dissertation committee, I expressmy gratitude, most especially to David Ericson and Graham Parkes for their guidance and support over the years. Their encouragement was much appreciated, as was their advice-despite my not always seeming to follow it. Among my friends, I should like to mention Craig Chapman, Dean Dampney, Eric Haas, and the late Edis Begovic, whose memory abides me. Whether they are aware ofit or not, I am in indebted to each for contributions great and small. I am also grateful to the Emily Margaret White Education Trustfor its financial support for the duration ofmy graduate education. Finally, Bruna Brown St. Onge, my lovely daughter, was extremely patient and generous these past few years as her father devoted the bulk ofhis energies to a project that took longer than planned to complete. -
Why Nietzsche?
Nietzsche & Asian Philosophy Introduction Why Nietzsche? Why is it important to read Nietzsche today? On the one hand it might seem strange to even ask this question since Nietzsche has had such a pervasive influence in late modern culture. Nietzsche is certainly one of the most well known philosophers of late modernity. More people have probably at least heard of Nietzsche than of Wittgenstein , Heidegger, Sartre or any other philosopher since Nietzsche. But that, of course, could be said to be an indictment, ironically, of the very culture of modernity that Nietzsche criticized. Who knows anything of philosophy today, especially here in the “land of the free”? Americans already have their freedom and don’t need philosophy. One certainly doesn’t need philosophy to be successful in the world today. One certainly doesn’t need to have read any philosophy at all to make a lot of money, or to be a successful journalist, a religious leader, or radio talk show host, or, obviously, a politician today. One doesn’t even need to have read any philosophy to be considered highly educated today. Its possible to earn a Ph.D. in diverse fields of study, especially in the sciences, and never have taken a course in philosophy or even have read one single philosophical text. The reason for Nietzsche’s popularity among the masses, such as it is, the reason for example there are probably more of Nietzsche’s books than any other philosopher in Borders’ tiny Western Philosophy section, is surely Nietzsche’s brilliance at one-liners, such as the now familiar, so often quoted line: “Out of life's school of war: What does not destroy me, makes me stronger” (Twilight of the Idols, Maxims and Arrows, §8).