Kinky Friedman
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UTEX0010 2 CODEBOOK.Txt 11/2
UTEX0010_2_CODEBOOK.txt 11/2/2009 ================================================================================ Project Code: UTEX0010 Project Name: Texas Tribune Series, Pt 1 Prepared for: Daron Shaw and Jim Henson Interviews: 800 Field Period: October 20-27, 2009 Project Manager: Sam Luks - 650.462.8009 ================================================================================ Matching and Weighting ================================================================================ Polimetrix interviewed 1152 respondents who were then matched down to a sample of 800 to produce the final dataset. The respondents were matched on gender, age, race, education, party identification, ideology and political interest. Polimetrix then weighted the matched set of survey respondents to known marginals for the registered voters of Texas from the 2008 Current Population Survey. Those marginals are shown below. ================================================================================ Age: 18-34: 27.0% 35-54: 38.3% 55+: 34.7% Gender: Male: 46.4% Female: 53.6% Race: White/Other: 66.2% Black: 13.8% Hispanic: 20.0% Education: HS or less: 37.2% Some College: 33.6% College Graduate: 20.9% Post-graduate: 8.2% Variable List ================================================================================ Name Description ---- ----------- caseid Case ID weight Case Weight stateres State of residence langpref Would you prefer to take this survey in English or Spanish? Q1 Texas vote registration Q2 Political interest Q3 Most important problem facing -

The Blastoff;
The Blastoff Rotary Club of Space Center • P. O. Box 58862 • Houston, TX. 77258 www.spacecenterrotary.org • Chartered August 1964 • Rotary District 5890 Meetings: Mondays at noon • Brentwood Inn •1300 Nasa Parkway Clear Lake, Texas • Volume 43. No. 5 • Aug. 7, 2006 AgendaĐ •Đ Luncheon Begins.......................11:45Đ Outrageous and irreverent but always thought- •Đ Call to Order............................12:00Đ provoking, Kinky Friedman wrote and performed • Song...........................Debby McBrideĐ satirical country songs during the 1970s and has been hailed as the Frank Zappa of country music. The son •Đ Invocation...............Carlos VillagomezĐ of University of Texas professor, S. Thomas Friedman; Kinky studied psychology at Texas and founded his •Đ Pledge........................Tony BloomfieldĐ first band while there. King Arthur & the Carrots , a Four-Way-Test............Mark HumphreyĐ group that poked fun at surf music, recorded only one •Đ single in 1966. (The group included his friend, who •Đ Introductions of Guests & VisitingĐ would metamorphose, into Little Jewford in his next Rotarians....................Bill GeisslerĐ band.) After graduation, Friedman served three years in the Peace Corps; he was stationed in Borneo, where •Đ Announcements.........................12:10Đ he was an agricultural extension worker. • Program....................................12:30Đ By 1971 he had founded his band, Kinky Friedman & Kinky FriedmanĐ the Texas Jewboys . During the life of the band, in keeping with the group's satirical songs, some •Đ Adjourn.....................................1:00Đ members had colorful or politically incorrect names: Little Jewford, Wichita Culpepper, Rainbow Colors, Sky Cap, Panama Red, and Snakebite Jacobs. Friedman got his break in 1973 thanks to Commander Cody, who contacted Vanguard Music on behalf of the acerbic young performer. -

Weird City: Sense of Place and Creative Resistance in Austin, Texas
Weird City: Sense of Place and Creative Resistance in Austin, Texas BY Joshua Long 2008 Submitted to the graduate degree program in Geography and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Human Geography __________________________________ Dr. Garth Andrew Myers, Chairperson __________________________________ Dr. Jane Gibson __________________________________ Dr. Brent Metz __________________________________ Dr. J. Christopher Brown __________________________________ Dr. Shannon O’Lear Date Defended: June 5, 2008. The Dissertation Committee for Joshua Long certifies that this is the approved version of the following dissertation: Weird City: Sense of Place and Creative Resistance in Austin, Texas ___________________________________ Dr. Garth Andrew Myers, Chairperson Date Approved: June 10, 2008 ii Acknowledgments This page does not begin to represent the number of people who helped with this dissertation, but there are a few who must be recognized for their contributions. Red, this dissertation might have never materialized if you hadn’t answered a random email from a KU graduate student. Thank you for all your help and continuing advice. Eddie, you revealed pieces of Austin that I had only read about in books. Thank you. Betty, thank you for providing such a fair-minded perspective on city planning in Austin. It is easy to see why so many Austinites respect you. Richard, thank you for answering all my emails. Seriously, when do you sleep? Ricky, thanks for providing a great place to crash and for being a great guide. Mycha, thanks for all the insider info and for introducing me to RARE and Mean-Eyed Chris. -

Shopping Map of Salado on Page 4B-5B This Edition Salado Illageillage Oiceoice Vol
Shopping Map of Salado on page 4B-5B this edition Salado illageillage oiceoice VOL. XXXIV, NUMBER V28V THUrsDAY, OCTOBER 27, 2011 254/947-5321 FAX 254/947-9479 V V WWW.SALADOVILLAGEVOICE.COM 50¢ Group told to clear F RIGHTFULLY FUN E VENTS OCTOBER 27 gravel from stream Thank You Salado Day The “View from the tion of the creek by lining The Salado Patio Bridge” committee will it with the anchored lime- apply for a permit from stone rocks, landscap- OCTOBER 28 Texas Parks and Wildlife ing the approaches to the to do work in and around banks with native plants Kinky Friedman’s Salado Creek, including and recasting the Sirena Monster Ball lining the banks of the sculpture by artist Troy at The Springs creek with large limestone Kelley. 7 p.m. - 2 a.m. rocks. In the 25 years that Si- Live Music, Costume The work was shut rena sat in the creek and Contest down this month by springs, she has been dam- ~ TP&W when gravel from aged by gravel and debris Live music the banks was piled in the during major flood events. at The Lounge stream of the creek. But Kelley says the damage is upstairs at The Range this week, the committee too extensive at this point Fighting for one of their own 6 p.m. was given authorization to try to repair. The cost Salado Firefighters have come to the aid of Saladoans for decades and are now asking OCTOBER 29 from TP&W to remove for recasting the mermaid local citizens to come to the aid of one of their own. -

KEEPING TEXAS WEIRD OCTOBER UPDATE Total Gubernatorial Money Raised by Sept
KEEPING TEXAS WEIRD OCTOBER UPDATE Total Gubernatorial Money Raised By Sept. 28, 2006: $49,862,939 (Period Covered: Jan. 2003 - Sept. 2006) No. of Itemized Gubernatorial Candidate Affiliation Total Raised Contributions Rick Perry Republican $27,392,375 25,395 Carole Keeton Strayhorn Independent $13,927,433 5,191 Chris Bell Democrat $3,628,391 3,522 Kinky Friedman Independent $4,911,835 14,608 James Werner Libertarian $2,905 21 TOTAL: $49,862,939 48,733 Campaign Cash on Hand as of Sept. 28, 2006 Cash On Gubernatorial Candidate Hand Rick Perry $9,230,812 Carole Keeton Strayhorn $5,016,543 Chris Bell $197,718 Kinky Friedman $827,830 James Werner $ 1,997 TOTAL: $15,274,900 Chris Bell’s Top Donors January 2003 - September 2006 NOTE: After Bell filed the Oct. 10, 2006 report covered here, media reported that Houston trial lawyer John O’Quinn has made $3.5 million in pledges to the Bell campaign (including $2 million in contributions and $1.5 million in loans). This would far surpass the $690,000 that home-builder Bob Perry had given to Governor Perry by Sept. 28. Amount Contributor Employer City $424,329 Ricardo Weitz Auto dealer & real estate Houston $250,000 Harold W. Nix Nix Patterson & Roach attorney Daingerfield $170,000 Terralynn Swift Swift Energy Co. owner Houston $110,000 Thomas W. Pirtle O’Quinn Laminack & Pirtle attorney Houston $101,000 Lee Fikes Bonanza Oil, Inc. president Dallas $100,000 Good Government PAC Trial lawyer PAC Corpus Christi $92,500 Robert Turner Wentwood Capital Advisors (real estate) Austin $80,000 Robert Patton, Jr. -

{Download PDF} Cowboy Logic : the Wit and Wisdom of Kinky Friedman (And Some of His Friends) Pdf Free Download
COWBOY LOGIC : THE WIT AND WISDOM OF KINKY FRIEDMAN (AND SOME OF HIS FRIENDS) PDF, EPUB, EBOOK Kinky Friedman | 208 pages | 30 May 2006 | St. Martins Press | 9780312331566 | English | United States Cowboy Logic : The Wit and Wisdom of Kinky Friedman (and Some of His Friends) PDF Book To her the name of father was another name for love. Sharon S. Abortion kills children Because nothing is quite as easy as using words like somebody else. Light rubbing wear to cover, spine and page edges. Trillin, Calvin. I feel a dry wind, dust in my eyes, the arctic cold at night Arnold H. Setbacks come at every turn. He was followed by former US senator Dean Barkley, another Ventura campaign veteran who is now Kinky's campaign manager, and Reid Nelson, a seasoned political fighter whose task is to lick the campaign's many young volunteers into shape and build a viable independent network across Texas. Kinky seems elated, but on the road to another event, in San Antonio, his inner demons resurface: 'Can we take a chance on someone who makes jokes? Arthur, he does as he pleases. Facts were never pleasing to him. Failure is the true test of greatness. And the drinks are passed around. Atticus By Doug Hoekstra. So in , flat broke, Friedman wrote a crime mystery, Greenwich Killing Time, with a detective named Kinky Friedman and characters such as Little Jewford, Cleve and Ratso, band members moonlighting in his imaginative world, much as some now figure in his campaign. Complimenting Kinky's timeless maxims are illustrations by the brilliant Ace Reid. -

Read Ebook {PDF EPUB} Heroes of a Texas Childhood by Kinky Friedman Heroes of a Texas Childhood by Kinky Friedman
Read Ebook {PDF EPUB} Heroes of a Texas Childhood by Kinky Friedman Heroes of a Texas Childhood by Kinky Friedman. "Heroes of A Texas Childhood" by Kinky Friedman Art by Copper Love. Emily Morgan, "The Yellow Rose of Texas" Improving Performance and Building a Connection. Copper Calming Fast Parade during saddling 2006 Keeneland Lexington Stakes. Teaching shoulder relaxation. Copper Painting in Montserrat, West Indies. River's Edge Gallery Kerrville, Texas. Front Street Books Alpine, Texas. Ft. Davis Drugstore Art Gallery Ft. Davis, Texas. Heroes of a Texas Childhood. Literary essays by Kinky Friedman about his childhood heroes, including Barbara Jordan, Willie Nelson, and Davy Crockett. About the Author: Kinky Friedman is an author and entertainer and current candidate for governor of Texas. He lives in a hundred-year-old lodge in the heart of the Texas Hill Country with four old dogs, not counting himself. "About this title" may belong to another edition of this title. We guarantee the condition of every book as it's described on the Abebooks web sites. If you're dissatisfied with your purchase (Incorrect Book/Not as Described/Damaged) or if the order hasn't arrived, you're eligible for a refund within 30 days of the estimated delivery date. If you've changed your mind about a book that you've ordered, please use the Ask bookseller a question link to contact us and we'll respond within 2 business days. Orders usually ship within 2 business days. Shipping costs are based on books weighing 2.2 LB, or 1 KG. If your book order is heavy or over sized, we may contact you to let you know extra shipping is required. -
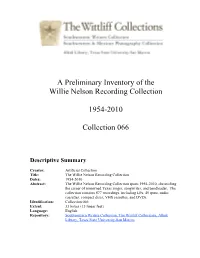
A Preliminary Inventory of the Willie Nelson Recording Collection 1954
A Preliminary Inventory of the Willie Nelson Recording Collection 1954-2010 Collection 066 Descriptive Summary Creator: Artificial Collection Title: The Willie Nelson Recording Collection Dates: 1954-2010 Abstract: The Willie Nelson Recording Collection spans 1954-2010, chronicling the career of renowned Texas singer, songwriter, and bandleader. The collection contains 877 recordings, including LPs, 45 rpms, audio cassettes, compact discs, VHS cassettes, and DVDs. Identification: Collection 066 Extent: 33 boxes (13 linear feet) Language: English. Repository: Southwestern Writers Collection, The Wittliff Collections, Alkek Library, Texas State University-San Marcos Scope and Contents Note The Willie Nelson Recording Collection spans 1954-2010, chronicling the career of renowned Texas singer, songwriter, and bandleader. The collection contains 877 recordings, including LPs, 45 rpms, audio cassettes, compact discs, VHS cassettes, and DVDs. Included in the collection are recordings under Nelson’s leadership as well as recordings on which he is a guest musician, producer, or songwriter. Highlights from the collection include Nelson’s first 45 rpm record released under his name, “No Place For Me” b/w “Lumberjack” (pictured above), numerous live recordings, studio demos, and deluxe-edition CDs with rare and previously unreleased material. Some of Nelson’s earliest recordings as a guest musician and songwriter are featured in the collection that represents the bulk of Nelson’s official discography. The collection is arranged chronologically by publication date. Not every recording is dated, and some are listed with an approximate date of release. Some recordings are listed by their original release date, not the date of production of that particular disc, cassette, etc. For example, The Troublemaker was originally released on LP in 1976. -

I T's the Weirdest Governor's Race in Modern Texas History. Three
t’s the weirdest governor’s race in modern Texas history. Three out of four funded candidates started their political careers as Democrats. Yet the one surviving Democrat has placed fourth Iin fundraising and struggles for the attention that all major-party nominees once received. Instead, some wealthy trial lawyers are backing an ex-Democrat who entered this race as a Republican—only to declare herself Independent shortly before the primary. This candidate—who soon will appear on the ballot under the third surname of her political career—recently lost her bid to be called “Grandma” on this ballot. Yet another Independent will appear on the ballot as “Kinky.” This country-western humorist was the race’s most entertaining candidate—at least until he tried to articulate a platform. His campaign-merchandising model has broken the campaign-finance mold. Yet it remains to be seen if people who advocate legalized pot or who buy Kinky paraphernalia will vote for anyone at all. Are people sporting “Why not Kinky?” bumper stickers themselves wrestling with this question? Finally the ex-Democrat now occupying the Governor’s Mansion leads the fundraising race—as expected of a big-business incumbent. By late June the governor already came close to matching the $25 million that George W. Bush raised by the end of his 1998 gubernatorial reelection campaign. Yet this governor enjoys none of the comfort with which his predecessor brushed off challenger Garry Mauro. This has less to do with this governor’s under-whelming track record than the fact that the victor in this wild, four-way race need not garner anywhere near 51 percent of the vote. -

Il «Caso» Friedman Dal Country Ebreo Al Thriller Comico
30CUL02A3012 ZALLCALL 12 20:12:05 12/29/97 CULTURA E SOCIETÀ l’Unità2 3 Martedì 30 dicembre 1997 Un cantante Usa scrive libri «Elvis Gesù e Coca Cola» E i suoi dischi e diventa tutti assieme a New York parlano più popolare persino Un regista-attore morto e un film su Elvis perduto. Il detective di Bill Clinton Kinky Friedman ha per le mani un caso «facile facile» che diventerà sospetto e lo porterà fin nel cuore della mafia. della Shoah Così gli autori Scenario: la Grande Mela, un affresco enorme di luoghi e facce (alcune riconoscibili, come quelle di Paul Simon e Joe Di Maggio Fa un certo effetto ritrovare «irregolari» tra i tanti, altre anonime) nella quale l’ebreo texano ex musicista il suo nome sulla copertina country, detective quasi per caso, abita insieme agli altri di un libro di Feltrinelli. «Ma arricchiscono Irregolari del Village, a una Judy «di sopra» e una Judy «di sotto». non è quel tipo Inizia così una delle indagini più divertenti della storia della completamente fuori di la letteratura letteratura. È quella di «Elvis, Gesù e Coca-Cola», il primo giallo di testa di cui ho un paio di Kinky Friedman scrittore tradotto in Italia. Vita vera dell’autore e dischi?», mi chiedo amici veri dello stesso vengono buttati in pasto alle pagine e alla sorpreso. Ebbene sì, è Una foto storia in maniera mirabile, con un senso dell’umorismo che proprio lui: Mr. Kinky di William Klein avvicina Friedman a un Groucho Marx molto più strafattoeauna Friedman, il primo dalla mostra versione fricchettona di «Una pallottola spuntata». -

Texas Authors Sampler
A Sampler of Books by Texas Authors Texas has a variety of writers of fiction and nonfiction. They write in many genres including drama, satire, history, commentary, short story, and novels of mystery, romance, and westerns. This sampler includes books by people who were born in Texas, lived in Texas, as well as some who say they came to Texas, “as fast I could.” Collision DB/RC 67269 by Jeff Abbott Military consultant Ben Frostberg’s bride is shot dead on their honeymoon. Two years later an assassin is murdered – and Ben’s card is found in the victim’s pocket. As Ben tries to convince Homeland Security agents he’s being framed, a deep-cover government agent violently rescues him. Violence and strong language. Holly Blues: A China Bayles Mystery LB 06437 by Susan Wittig Albert China Bayles is fit to spit when her husband’s troubled ex-wife, Sally, shows up at her herb shop, claiming to be broke with nowhere else to turn. When she invites Sally to stay, China starts receiving menacing calls from an “ex” of Sally’s, who seems to have a connection to the murder of China’s parents. Strong language. Yokota Officers Club RC 54726 by Sarah Bird Okinawa, 1960s. Hippie Bernadette Root returns to her large, nomadic, Air Force family after a year stateside at college. She wins a dance contest then performs on tour through Japan, looks up her family’s former maid, and discovers past secrets. Strong language. First American: The Life and Times of Benjamin Franklin RC 50878 by H.W. -

Hilltopics: Volume 3, Issue 9 Hilltopics Staff
Southern Methodist University SMU Scholar Hilltopics University Honors Program 11-6-2006 Hilltopics: Volume 3, Issue 9 Hilltopics Staff Follow this and additional works at: https://scholar.smu.edu/hilltopics Recommended Citation Hilltopics Staff, "Hilltopics: Volume 3, Issue 9" (2006). Hilltopics. 55. https://scholar.smu.edu/hilltopics/55 This document is brought to you for free and open access by the University Honors Program at SMU Scholar. It has been accepted for inclusion in Hilltopics by an authorized administrator of SMU Scholar. For more information, please visit http://digitalrepository.smu.edu. EXTENDED ELECTION SPECIAL volume three, issue nine www.smu.edu/honors/hilltopics week of november 06, 2006 ‘If we can keep it’: have we really earned our democracy? by Dr. Dayna Oscherwitz This election season, the AARP (As- at the decision to cast their vote for the Presi- sociation for the Advancement of Retired dent? Probably in the same way that many Persons) has been running a television ad Americans do. That is, they vote for a candi- entitled “Donʼt Vote.” The ad features an date because their friends, their family, their Endorsements: impeccably dressed pastor, a political par- Fellow Mus- politician who chops ty, or a television com- tangs endorse their favorite wood, drives a tractor, mercial tells them to, or candidates in the gover- and serves apple pie, they decide (rightly or nors race. Andrea Allen on but who categorically wrongly) that a candi- Carole Keeton Strayhorn and refuses to address any date agrees with them Samantha Urban on Chris serious political is- on a single issue, and Bell, page 3.