Espero, Nr. 3 (Juli 2021)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2015-08-06 *** ISBD LIJST *** Pagina 1 ______Monografie Ni Dieu Ni Maître : Anthologie De L'anarchisme / Daniel Guérin
________________________________________________________________________________ 2015-08-06 *** ISBD LIJST *** Pagina 1 ________________________________________________________________________________ monografie Ni Dieu ni Maître : anthologie de l'anarchisme / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1973-1976 monografie Vol. 4: Dl.4: Makhno ; Cronstadt ; Les anarchistes russes en prison ; L'anarchisme dans la guerre d'Espagne / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1973. - 196 p. monografie Vol. 3: Dl.3: Malatesta ; Emile Henry ; Les anarchistes français dans les syndicats ; Les collectivités espagnoles ; Voline / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1976. - 157 p. monografie De Mechelse anarchisten (1893-1914) in het kader van de opkomst van het socialisme / Dirk Wouters. - [S.l.] : Dirk Wouters, 1981. - 144 p. meerdelige publicatie Hem Day - Marcel Dieu : een leven in dienst van het anarchisme en het pacifisme; een politieke biografie van de periode 1902-1940 / Raoul Van der Borght. - Brussel : Raoul Van der Borght, 1973. - 2 dl. (ongenummerd) Licentiaatsverhandeling VUB. - Met algemene bibliografie van Hem Day Bestaat uit 2 delen monografie De vervloekte staat : anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914 / Jan Moulaert. - Berchem : EPO, 1981. - 208 p. : ill. Archief Wouter Dambre monografie The floodgates of anarchy / Stuart Christie, Albert Meltzer. - London : Sphere books, 1972. - 160 p. monografie L' anarchisme : de la doctrine à l'action / Daniel Guerin. - Paris : Gallimard, 1965. - 192 p. - (Idées) Bibliotheek Maurice Vande Steen monografie Het sociaal-anarchisme / Alexander Berkman. - Amsterdam : Vereniging Anarchistische uitgeverij, 1935. - 292 p. : ill. monografie Anarchism and other essays / Emma Goldman ; introduction Richard Drinnon. - New York : Dover Public., [1969?]. - 271 p. monografie Leven in de anarchie / Luc Vanheerentals. - Leuven : Luc Vanheerentals, 1981. - 187 p. monografie Kunst en anarchie / met bijdragen van Wim Van Dooren, Machteld Bakker, Herbert Marcuse. -
The Extremes of French Anarchism Disruptive Elements
Disruptive Elements The Extremes of French Anarchism Disruptive Elements Ardent Press Disruptive Elements This work is licensed under the Creative Commons Attribution- Noncommercial 3.0 Unported License. https://creativecommons.org Ardent Press, 2014 Table of Contents Translator's Introduction — vincent stone i Bonjour — Le Voyeur ii The Philosophy of Defiance — Felix P. viii section 1 Ernest Coeurderoy (1825-1862) 1 Hurrah!!! or Revolution by the Cossacks (excerpts) 2 Citizen of the World 8 Hurrah!!! Or the Revolution by the Cossacks (excerpt) 11 section 2 Joseph Déjacque (1821-1864) 12 The Revolutionary Question 15 Le Libertaire 17 Scandal 19 The Servile War 21 section 3 Zo d’Axa (1864-1930) 25 Zo d’Axa, Pamphleteer and Libertarian Journalist — Charles Jacquier 28 Any Opportunity 31 On the Street 34 section 4 Georges Darien (1862 – 1921) 36 Le Voleur (excerpts) 40 Enemy of the People 44 Bon Mots 48 The Road to Individualism 49 section 5 Octave Mirbeau (1848-1917) 50 Ravachol 54 Murder Foul and Murder Fair 56 Voters Strike! 57 Moribund Society and Anarchy 60 Octave Mirbeau Obituary 62 section 6 Émile Pouget (1869 - 1931) 64 Boss Assassin 66 In the Meantime, Let’s Castrate Those Frocks! 68 Revolutionary Bread 70 section 7 Albert Libertad (1875-1908) 72 Albert Libertad — anonymous 74 The Patriotic Herd 75 The Greater of Two Thieves 76 To Our Friends Who Stop 78 Individualism 79 To the Resigned 83 Albert Libertad — M.N. 85 section 8 illegalism 88 The “Illegalists” — Doug Imrie 89 An Anarchist on Devil’s Island — Paul Albert 92 Expropriation and the Right to Live — Clement Duval 97 Obituary: Clement Duval — Jules Scarceriaux 99 Why I Became a Burglar — Marius Jacob 101 The Paris Auto-Bandits (The “Bonnot Gang”) — anonymous 104 “Why I Took Part in a Burglary, Why I Committed Murder” — Raymond Callemin 105 Is the Anarchist Illegalist Our Comrade? — É. -
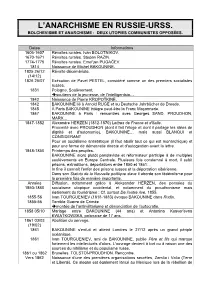
L'anarchisme En Russie-Urss
L’ANARCHISME EN RUSSIE-URSS. BOLCHEVISME ET ANARCHISME : DEUX UTOPIES COMMUNISTES OPPOSÉES. Dates Informations 1606-1607 Révoltes rurales. Ivan BOLOTNIKOV. 1670-1671 Révoltes rurales. Stepan RAZIN. 1774-1775 Révoltes rurales. Emel'jan PUGAČEV. 1814 Naissance de Michel BAKOUNINE. 1825 26/12 Révolte décembriste. (14/12) 1826 25/07 Exécution de Pavel PESTEL, considéré comme un des premiers socialistes russes. 1831 Pologne. Soulèvement. ➔soutiens de la jeunesse, de l'intelligentsia… 1842 Naissance de Pierre KROPOTKINE. 1842 BAKOUNINE lié à Arnold RUGE et au Deutsche Jahrbücher de Dresde. 1845 À Paris BAKOUNINE intègre peut-être la Franc Maçonnerie. 1847 BAKOUNINE à Paris : rencontres avec Georges SAND, PROUDHON, MARX… 1847-1852 Alexandre HERZEN (1812-1870) Lettres de France et d'Italie. Proximité avec PROUDHON (dont il fait l'éloge et dont il partage les idées de dignité et d'autonomie), BAKOUNINE… mais aussi BLANQUI et CONSIDERANT Pour un socialisme antiétatique (il faut abolir tout ce qui est monarchique) et pour une forme de démocratie directe et d'autogestion avant la lettre. 1848-1850 Printemps des peuples. BAKOUNINE alors plutôt panslaviste et réformateur participe à de multiples soulèvements en Europe Centrale. Plusieurs fois condamné à mort, il subit prisons, extraditions, déportations entre 1850 et 1861… In fine il connaît l'enfer des prisons russes et la déportation sibérienne. Dans son Statuts de la Nouvelle politique slave il aborde son fédéralisme pour la première fois de manière importante. Années Diffusion, notamment grâce à Aleksander HERZEN, des pensées du 1850-1860 socialisme utopique occidental, et notamment du proudhonisme mais également du fouriérisme ; Cf. surtout De l'autre rive, 1855. -
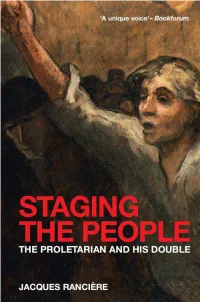
Proletarians and Dictatorships
STAGING THE PEOPLE THE PROLETARIAN AND HIS DOUBLE Jacques Rancière Translated by David Fernbach First published in English by Verso 2011 © Verso 2011 Compiled from articles originally appearing in Les Révoltes logiques © Les Révoltes logiques 1975 to 1981 Translation © David Fernbach 2011 All rights reserved The moral rights of the author have been asserted 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 Verso UK: 6 Meard Street, London W1F 0EG US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201 www.versobooks.com Verso is the imprint of New Left Books Epub ISBN-13: 978-1-84467-805-1 British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the Library of Congress Typeset by Hewer Text UK Ltd, Edinburgh Printed in the US by Maple Vail - 1 - Contents Preface to the English Edition ................................................................................................................ 3 1 .............................................................................................................................................................. 8 The Proletarian and His Double, Or, The Unknown Philosopher ......................................................... 8 2 ............................................................................................................................................................ 14 Heretical Knowledge and the Emancipation of the Poor .................................................................... -

Bulletin N°68
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR Bibliothèque du CIRA, avenue de Beaumont 24, CH – 1012 Lausanne, Suisse L’ANARCHISME, CIRA (métro m2 depuis la gare, arrêt Hôpital CHUV) catalogue, informations : www.cira.ch/ [email protected] BULLETIN DU CIRA 68 ÉTÉ 2012 INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON ANARCHISM CENTRO INTERNAZIONALE DI RICHERCHE SULL’ANARCHISMO INTERNATIONALES ZENTRUM FÜR ANARCHISMUSFORSCHUNG CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE ANARQUISMO La bibliothèque du CIRA est ouverte du mardi au vendredi de 16 h à 19 h., ou sur rendez-vous. Elle fonctionne aussi par correspondance : prêt de livres à l'étranger, photocopies de publications ou d'articles de journaux et revues, renseignements sur des fonds ou des recherches en cours. Elle publie un bulletin annuel. La carte de lecture donnant droit à la consultation, au bulletin et au prêt coûte 40 francs suisses par an, à verser de préférence par la poste: CCP 12-17750-1 40 Euros ou l’équivalent pour l’étranger ; pas de chèques, svp ! L’Hôtel de la Maison de Ville de Saint-Imier (aujourd’hui Hôtel Central), Coordonnées bancaires: où se tint le congrès international anti-autoritaire en septembre 1872. Postfinance, IBAN CH28 0900 0000 1201 7750 1, BIC POFICHBEXXX Soutien : 40 à 100 francs / 40 à 100 euros Abonnement au bulletin pour bibliothèques : 10 francs par an. DANS CE NUMÉRO : Rapport d’activités 2011 Pour les conditions de prêt, voir le mode d’emploi sur notre page Les fonds anciens du CIRA: La Bibliothèque Germinal internet. Au Salon du livre anarchiste de Montréal / Montreal Anarchist Bookfair La bibliothèque est généralement fermée au mois d’août.