Die Tourismus Und Welterbelandschaften – Die
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GMUNDEN - SALT, SPA & STADREGIOTRAM by Mike Bent
Locomotives International August 2017 Nr. 209 GMUNDEN - SALT, SPA & STADREGIOTRAM by Mike Bent Introduction Tram 8 pauses at the Tennisplatz stop in Gmunden. Author Gmunden lies on the northern shore of the Traunsee, to the east of the Salzkammergut district and Salzburg, in the northern to have been in existence by 1210 in Mühlpach (Hallein), to the foothills of the Austrian Alps. In addition to being near the termini south of Salzburg. of the both world’s oldest industrial pipeline and Europe’s second The Archbishop of Salzburg between 1587 and 1612, Wolf oldest public railway, the town, since 1862 a ‘Kurstadt’ (spa Dietrich von Raitenau, encouraged the use of ‘solution mining’ resort), has a 145 year old operational paddle steamer, and one techniques to augment the supply of brine, water being injected of the steepest, shortest urban tramways in Europe, now being into the salt-bearing rock through adits, resulting in the salt expanded into a modern Stadt RegioTram interurban network. being dissolved, and the brine being channelled into salt pans for evaporation. The end result was the production of massive White Alpine Gold quantities of salt. The consequent revival of the salt mining industry and huge sales of the end product resulted in Salzburg Exploitation of the rock salt deposits in and around Salzburg becoming a powerful trading community, the wealth being and the Salzkammergut dates back possibly as far as the 12th displayed in the abundance of Baroque architecture which has century BC at the Hallstatt mine, claimed to be the oldest in the earned the city the status of a UNESCO World Heritage Site. -

Bezirk Gmunden Seite 1 Von 3
Lehrbetriebsübersicht Bezirk Gmunden Seite 1 von 3 ForstfacharbeiterIn Fischthaller Maximilian Österreichische Bundesforste Westumfahrung 38, 4810 Gmunden Forstbetrieb Bad Ischl Wirerstraße 6, 4820 Bad Ischl Kofler Norbert Hüttwinkel 1, 4663 Laakirchen Österreichische Bundesforste Forstbetrieb Traun-Innviertel Neff Claudia und Johann Steinkoglstraße 25, 4802 Ebensee Offenseestraße 10, 4802 Ebensee Österreichische Bundesforste Forsttechnik Steinkoglstraße 25, 4802 Ebensee HolztechnikerIn Löberbauer Christoph Landstraße 74, 4645 Grünau im Almtal ZimmererIn | ZimmereitechnikerIn | FertigteilhausbauerIn Amering Thomas Karl Kieninger Bau GmbH Sonnenweg 1, 4656 Kirchham Sternberg 4, 4812 Pinsdorf Brandl BaugmbH Schiffbänker Klaus Traunkai 18, 4820 Bad Ischl Leherbauernweg 9, 4812 Pinsdorf Herwig Besendorfer GmbH Steinkogler Bau GmbH Edt 57, 4822 Bad Goisern Bahnhofstraße 48, 4802 Ebensee Holzbau Bammer GmbH Stern & Hafferl BaugmbH Obersperr 11, 4644 Scharnstein Kuferzeile 30, 4810 Gmunden Kieninger Bau GmbH Wolf Systembau GmbH Stambach 77, Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein 4822 Bad Goisern am Hallstättersee Zeppetzauer Bau und Zimmerei GmbH Wolfganger Straße 7, 4820 Bad Ischl Lehrbetriebsübersicht Bezirk Gmunden Seite 2 von 3 TischlerIn | TischlereitechnikerIn - Planung/Produktion Baumgartner Andreas Lidauer Tischlerei GmbH Hummelbrunn 30, 4655 Vorchdorf Schloßberg 2, 4644 Scharnstein Feichtinger GmbH Mayr - Schulmöbel GmbH Laudachtal 51, 4816 Gschwandt Mühldorf 2, 4644 Scharnstein Franz Attwenger und Söhne GmbH Möbel-Baumgartner GmbH Guggenberg -
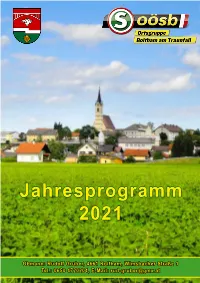
Jahresprogramm 2021
Jahresprogramm 2021 Obmann: Rudolf Gruber, 4661 Roitham, Wimsbacher Straße 1 Tel.: 0650 4720204, E-Mail: [email protected] Jahresprogramm 2021 Liebe Mitglieder! Jedes Jahr bemüht sich der Altbauern- und Seniorenbund für seine Miglie- der ein umfangreiches Programm zu erstellen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste unser Programm im vergan- genen Jahr auf ein Minimum reduziert werden. Ein gemeinsames Treffen war fast nie möglich. Den geplanten 4-Tagesausflug nach Südtirol, ge- meinsam mit dem Seniorenbund Laakirchen, mussten wir auf heuer ver- schieben. Unsere alljährliche Adventfeier konnte ebenfalls nicht abgehal- ten werden. Für das Jahr 2021 hoffen wir, dass wir uns wieder öfter treffen können. Wir haben daher wieder ein Programm für unsere Mitglieder zusammenge- stellt. Ausflüge, die wir 2020 nicht machten konnten, haben wir für heuer vorgesehen. Der im Jahr 2020 geplante Bezirks-Wandertag, der ebenfalls abgesagt werden musste, wird am 2. September 2021 in Roitham abge- halten. Zu den Kegelabenden werden wir kurzfristig einladen. Wir hoffen, dass es im heurigen Jahr wieder möglich sein wird, an ge- meinsamen Aktivitäten des Seniorenbundes teilzunehmen und die Freiheit wieder zu genießen. Der Obmann: Rudolf Gruber 2 Funktionäre Obmann Rudolf Gruber 0650 4720204 1. Obmann Stellvertreterln Inge Ziegler 0677 61350253 2. Obmann Stellvertreter Johann Niederhauser 0664 73450748 Schriftführer Franz Helmberger 0688 8236917 Kassier Hermann Heimberger 0664 3553450 Kulturreferent Elisabeth Auinger 0660 8319905 Sportreferent Georg Schubert 0699 11913329 Beiräte / Sprengelbetreuer Berta Waldl Pfarrhofstraße 9 0664 2200913 Josef Gasser Lindacherstraße 27 0650 4922120 Ernst Stöttinger Wangham 15 07613 5388 Monika Bachmayr Außerroh 4 07613 5208 Anna Hiesmair Deising 4 07613 5216 Franziska Dollberger Vornbuch 7 07613 5506 Franz Quirimayr Palmsdorf 16 0699 17237442 Michael Oder Nöstling 2 07613 5215 Romana Grabner Außerpühret 39 0664 9419460 3 Erlebniswelt KTM Motohall Mattighofen Donnerstag, 22. -

Route Salzkammergut Radweg (Pdf)
Hallstatt AUF EINEN BLICK START UND ZIEL: Rundkurs Länge: 351 km Höchster/tiefster Punkt: 1.014 m (Salzaalm) / 400 m (Bergheim) KURZCHARAKTERISTIK: Überwiegend Rad- wege und verkehrsarme Nebenstraßen. Bei Teilstücken auf Bundesstraßen bieten sich eine Schiff- und Bahnfahrt als Alternative an (Hallstätter See, Traunsee). Die Route ist groß- teils asphaltiert. SALZKAMMERGUT- SCHWIERIGKEITSGRAD: mittel BESCHILDERUNG: R2, R19 ANREISE UND RÜCKTRANSFER: Mit der RADWEG Bahn, ideale Alternativen bei diesem Rundweg, der aus mehreren Schleifen besteht, sind GEMÜTLICH VON SEE ZU SEE auch die Angebote Rad & Schiff – Details auf www.salzkammergut.at Auf den Spuren der Kaiserfamilie geht es, auf zumeist gemütlichen m und asphaltierten Radwanderwegen, durch die malerische Szenerie 1500 der Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und Steiermark, die schon 1200 900 Künstler wie Gustav Klimt zum Schwärmen brachte. 600 300 0 Wird die Festspielstadt Salzburg als Ausgangspunkt gewählt, fährt DIE HIGHLIGHTS DER ROUTE km 50 100 150 200 250 300 350 man zunächst auf der Trasse der historischen Ischlerbahn nach IM ÜBERBLICK Eugendorf und weiter ins Mozartdorf St. Gilgen, nach St. Wolf- • Festspiel- und Mozartstadt gang und schließlich in die berühmte Kaiserstadt Bad Ischl. Der Salzburg Besuch der Kaiservilla im Kaiserpark, des Stadtmuseums, der • Mondsee mit der Stiftskirche Therme oder der legendären Hofkonditorei Zauner sind Fixpunkte. • Mozartdorf St. Gilgen Die Route führt nun weiter südlich in die UNESCO Welterberegion • Wallfahrtsort St. Wolfgang am rund um den Hallstättersee. Einen Abstecher ins Gosautal sollte Wolfgangsee man ebenso wenig versäumen wie einen Besuch von Hallstatt • Kaiserstadt Bad Ischl und den weltberühmten Dachsteinhöhlen. Empfehlenswert ist von • Salzwelten in Bad Aussee und hier eine Bahnfahrt nach Bad Aussee, wo der steirische Salzkam- Hallstadt mergutweg über Bad Mitterndorf eine Verbindung zum Ennsrad- • Therme Narzissen Bad Aussee weg bietet. -

Naturraumkartierung Oberösterreich
Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham natur raum Endbericht Naturraumkartierung Oberösterreich Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Endbericht Kirchdorf an der Krems, Salzburg, 2006 Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich: Mag. Kurt Rußmann Projektbetreuung Biotopkartierung: Mag. Ferdinand Lenglachner, DI Franz Schanda, Mag. Günter Dorninger EDV/GIS-Betreuung Mag. Günter Dorninger Auftragnehmer: REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH Schillerstraße 30 A-5020 Salzburg Tel. +43 / 662 / 45 16 22-0 Fax +43 / 662 / 45 16 22-20 Email [email protected] Internet http://www.regioplan.com Geländearbeiten: Ökokart Gesellschaft für Ökologische Auftragsforschung GbR Wasserburger Landstraße 151 D-81827 München Tel. +49 / 89 / 439 87 435 Fax +43 / 89 / 439 87 436 Email [email protected] Internet http://www.oekokart.de GIS-Bearbeitung: ICRA Dumfarth & Schwap OEG Lilli-Lehmann-Gasse 4 A-5020 Salzburg Tel. +43 / 662 / 62 44 96-0 Fax +43 / 662 / 62 44 96-15 email [email protected] Internet http://www.icra.at natur raum 1 Naturraumkartierung Oberösterreich Biotopkartierung Gemeinde Kirchham Projektleitung: Dipl.-Ing. Andreas Knoll (REGIOPLAN INGENIEURE) Projektteam: Dr. Gabriele Anderlik-Wesinger (Ökokart) Dipl.-Ing. Erich Dumfarth (ICRA) Dipl.-Ing. Herwig Hadatsch (Ökokart) Dipl.-Biol. Monika Hess (Ökokart) Dipl.-Ing. Barbara Rainer (REGIOPLAN INGENIEURE) Dipl.-Ing. Alexander Schwap (ICRA) Dipl.-Ing. Cornelia Siuda (Ökokart) Mag. Stefanie Zobl (REGIOPLAN INGENIEURE) im Auftrag des Landes Oberösterreich, Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ Fotos Titelseite: Foto links: Laudach-Klamm Foto rechts: Orchidee Fotonachweis: alle Fotos Ökokart Redaktion: AG Naturraumkartierung Impressum: Medieninhaber: Land Oberösterreich Herausgeber: Amt der O ö. Landesregierung Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich 4560 Kirchdorf an der Krems Tel.: +43 7582 685 533 Fax: +43 7582 685 399 E-Mail: [email protected] Graphische Gestaltung: Mag. -

Senioren-Sportfest-Gschwandt 2019 ORTSGRUPPEN
Senioren-Sportfest-Gschwandt 2019 ORTSGRUPPEN Ortsgruppe Name Rang Punkte m/w Altmünster Wolfsgruber Karl 3 144 m Altmünster Langer Udo 10 135 m Altmünster Ferstl Heinz 28 124 m Altmünster Voglgruber Josef 35 121 m Altmünster Schögl Matthias 56 112 m Altmünster Schögl Franziska 66 106 w Altmünster Höller Josef 68 105 m Altmünster Thalhamer Johann 71 103 m Altmünster Ferstl Elfriede 75 101 w Altmünster Keinprecht Johann 78 100 m Altmünster Biedermann Käthe 82 97 w Altmünster Almhofer Johann 84 96 m Altmünster Rosenauer Julia 93 93 w Altmünster Schögl Josef 95 92 m Altmünster Altmanninger Ingrid 98 91 w Altmünster Schögl Cilli 98 91 w Altmünster Hitzenberger Brigitte 110 83 w Altmünster Schiffbänker Johann 127 79 m Altmünster Kaiser Erika 134 75 w Altmünster Schiffbänker Walburger 137 74 w Altmünster Wolfsgruber Waltraud 150 65 w Altmünster Zeizer Josef 153 62 m Altmünster Hödl Horst 157 59 m Altmünster Klein Elfi 160 53 w Altmünster Zopf Bettina 164 50 w Altmünster Pesendorfer Theresia 165 49 w Altmünster Voglgruber Ingeborg 168 47 w Altmünster Schweiger Ottilie 169 45 w Altmünster Mühlegger Carina ausser B. 171 43 w Bad Ischl Floss Josef 11 134 m Bad Ischl Taborsky Rosa 115 82 w Bad Ischl Kohlberger Margarethe 141 71 w Bad Ischl Dögl Doriet 153 62 w Bad Ischl Wallner Irmi 155 61 w Bad Ischl Trabesiner Helga 166 48 w Bad Ischl Floss Margarete 175 36 w Bad Ischl Luther Hedwig 177 21 w Bad Ischl Taborski Rosina 179 1 w Gmunden Rapberger Albert 16 130 m Gmunden Pühringer Helmut 23 127 m Goisern Anlanger Elisabeth 45 116 w Goisern Mandlmayr -

Aktuelle Gemeinde
Amtliche MiƩeilung - Zugestellt durch Post.at Gemeindezeitung Grünau im Almtal Grünau im Almtal Folge 2/2018 www.gruenau.at Gemeindezeitung Die Bürgermeister Nabaffa und Bammer feiern Gemeindepartnerscha in Idro Foto: Leo Meiseleder Impressum Aus dem Inhalt Medieninhaber und Herausgeber: Gemeinde Grünau im Almtal i Bericht des Bürgermeisters ............................................ 2 4645 Grünau im Almtal, Im Dorf 17 Tel.-Nr. 07616/8255-0 (Fax-DW 4) i GemeindepartnerschaŌsfest in Idro .............................. 3 Erscheinungsort: 4645 Grünau im Almtal i Verleihung Oberschulrat/Silbernes Verdienstzeichen .... 7 Für den Inhalt verantwortlich: i Grünau golŌ ................................................................ 10 Bürgermeister Wolfgang Bammer Gemeinde Grünau im Almtal i Stockschützen gewinnen MeisterƟtel .......................... 17 Redakon und Layout: Bammer Helga, [email protected] i 5. Biologicum Almtal .................................................... 18 Hersteller/Druckerei: i SelbstschutzƟpp „Kindersicherer Haushalt“.................20 Druckerei Haider, 4274 Schönau Gemeindezeitung Grünau im Almtal besonders, dass so viele Kinder aus unserer Ge- meinde daran teilgenom- men haben. Zubau im Kindergarten Gemeinsam mit der Unter- stützung von Landesrätin Mag. Christine Haberlan- der ist es nun möglich, den vor fast zehn Jahren als Provisorium aufgestellten Containeranbau für die vierte Kindergartengruppe durch einen modernen Zubau zu ersetzen. Der Finanzierungsplan wurde bereits im Gemeinderat beschlossen und -

Zahlen | Daten | Fakten Wirtschaftsregion Gmunden 1
Zahlen | Daten | Fakten Wirtschaftsregion Gmunden 1 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 Wohnbevölkerung 4-5 WKO-Mitglieder 6-7 Neugründungen 8-9 Lehrlinge 10-11 Lehrbetriebe 12 Beschäftigte und Arbeitgeberbetriebe in der gewerblichen Wirtschaft 13-14 Arbeitslosigkeit 15 Tourismus 16 Kommunalsteuer 17-18 Kaufkraft 19-20 WKO Gmunden, Stand 07.08.2018 2 Vorwort Zahlen und Daten sollen kein Selbstzweck sein, sondern den Unternehmen und Entscheidungsträgern der Region eine Unterlage für ihre Arbeit bieten. Darum zielt diese Broschüre nicht auf Menge, sondern konzentriert sich auf die Daten, die für regionale Betriebe relevant sind, Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre eine Hilfestellung für Ihre unternehmerischen Entscheidungen bieten können. Martin Ettinger Robert Oberfrank WKO-Bezirksstellenobmann WKO-Bezirksstellenleiter 3 Wohnbevölkerung Die Wohnbevölkerung im Bezirk Gmunden entwickelt sich ähnlich wie im gesamten Bundesland OÖ. Bis 2050 wird eine leicht steigende Bevölkerungsanzahl prognostiziert (+ 1,2%), wobei der Anstieg durch Zuwanderung erfolgt und sich vor allem auf den nörd- lichen Teil beschränken wird. Die zunehmende Überalterung der Bevölkerung wird eine der großen zukünftigen Herausforderungen sein. 4 Wohnbevölkerung Bad Ischl ist die einwohnerstärkste Gemeinde (13.995) und weist mehr Einwohner auf als die Bezirkshauptstadt Gmunden. Mit der dritten Stadt im Bezirk, Laakirchen, und mit Altmünster liegen zwei weitere Gemeinden nahe der 10.000 Einwohner-Grenze. Speziell im südlichen Teil (Gosau, Hallstatt, Obertraun) kämpft die Region mit der Gefahr einer sinkenden Bevölkerungszahl. Die positivste Bevölkerungsentwicklung ist bei den Umlandgemeinden Gmundens festzustellen. 5 WKO-Mitglieder Der Bezirk Gmunden gehört zu den mitgliederstärksten Bezirken der WKO. Nach Linz, Linz-Land und Vöcklabruck nimmt unser Bezirk den 4. Platz ein. Die Mitgliederanzahl steigt kontinuierlich an und die Steigerung liegt leicht über dem OÖ-Durchschnitt. -

Vorchdorfer Tipp 1 NR
VORchdorfer Tipp 1 NR. 221 - OKTOBEROktober 2017 2017 ÖSTERREICHISCHE POST AG, RM 94A465501 K, 4655 VORCHDORF. AUFLAGE: 17.200 EXEMPLARE VORCHDORF, LAAKIRCHEN, ROITHAM, BAD WIMSBACH-N., STEINERKIRCHEN/TRAUN, EBERSTALZELL, PETTENBACH, SCHARNSTEIN, GRÜNAU, ST. KONRAD, GSCHWANDT, KIRCHHAM BNP Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH [email protected] , www.bnp.at Ihr Spezialist für Eheringe: Ihr Spezialist für Heizung, Bad und Sanitär! Der topaktuelle Steuertipp zum Thema Sozial- Am 11. und 12. 11. bei der Hochzeitsmesse! www.amering.at versicherungs-Zuordnungsgesetz auf Seite 8. Vernetzte Frauenpower! „Die Welt einer Frau“ erstmals in Vorchdorf als Themenherbst und Podiumsdiskussion Foto: vorchdorfmedia e.U. vorchdorfmedia Foto: Mit einem achtteiligen Themenherbst startete der Verein Kitzmantelfabrik mit Kuratorin Mag. Marle- ne Elvira Steinz (zweite von rechts). Unter dem Titel „Die Welt einer Frau“ gliedert sich der Themen- herbst in vier historischen Vorträge, eine Fahrt nach Wien, einem Jazz-Konzert, ein Kabarett und eine Podiumsdiskussion. Für letztere hat die engagierte Vorchdorferin eine hochkarätige Diskussi- onsrunde von erfolgreichen Frauen aller Altersgruppen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusam- mengetrommelt. Jede Rednerin erzählt am 25. Oktober über ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und den erreichten Erfolg. Der Eintritt ist frei, im Anschluss gibt es bei Soul-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten genug Zeit zum Vernetzen und Austauschen. Der Werbering unterstützt die Veran- WOHNWOCHEN ! staltung mit voller Frauenpower durch susanne anziehend (Susanne Maier, rechts) und SchnittVision 12. Okt – 23. Nov! (Lisa Thalinger, zweite von links). Der gesamte Reinerlös geht an den Vorchdorfer Sozialfonds „Wir Helfen“ mit Obfrau Christine Baumgartinger (links). Mehr Informationen erfahren Sie auf Seite 9. www.bam-wohnen.at VORchdorfer Tipp 2 Oktober 2017 AKTUELLES AUS DER 06. -

Zeitung Nr. 111 – September 2019
ZVR: 401710439 . GZ 02 Z 033136 S . P.b.b. Verlagspostamt 4694 Ohlsdorf . Österr. Post AG / Sponsoring Post BADMINTON · BEACHVOLLEYBALL · SKI & SKIHÜTTE · STOCKSPORT aktuellTANZEN · TENNIS · TISCHTENNIS · TRI & BIKE · TURNEN · WANDERN Nr. 111 . SEPTEMBER 2019 Aus dem Inhalt: 50 Vorwort 2 Jahre Turnsektion 3, 4 Tennis Aurachkirchen 5 – 9 Tischtennis 10 50-Jahr-Feier 10 – 15 Kinder- und Jugend-Sportfest 17 jung! Wandern 17 Badminton 18, 19 s. S. 10 – 15 T3 – Triathlon 20, 21 Tanzen 22 Gratulationen, Neumitglieder 24 Impressum 24 Sponsoren 2, 4, 6, 16, 23 AUF IN DIE NEUE TURNSAISON Unsere TURNZEITEN in der Saison 2019 / 2020 im TURNSAAL DER VOLKSSCHULE und am Mittwoch Vormittag im MEZZO: www. sportunion- Geschätzte Mitglieder, TURNEN ohlsdorf. Freunde und Gönner AKTUELLES AUS UNSERER at der Sportunion Ohlsdorf! SEKTION TURNEN Unsere gelungene 50-Jahr-Jubiläumsfeier im Mai und das Mädchen in dieser Stunde darauffolgende Kinder- und Jugendsportfest waren sicherlich Unsere Angebote in der Saison 2019/20! Ich freue mich, hier den bewegen und verschiedene Bewegungsformen auspro- zwei Höhepunkte im Vereinsleben vor dem Sommer. jüngsten "Sportunion- Liebe Turnsportfreunde, Im würdigen Rahmen des Ohlsdorfer MEZZO erlebten wir ein bieren. Die Mädchen erwartet ein abwechslungsreiches Sproß" vorstellen zu wir möchten euch einen kurzen Überblick über das Angebot sehr schönes und buntes Jubiläumsfest. Programm aus Spielen, Gerätelandschaften und Turn- dürfen: Marie Sturm, der kommenden Saison geben. Von den Turnzwergen bis zu Viele Gäste und Mitglieder sind gekommen und wurden mit übungen. Die Verbesserung der Grundvoraussetzungen geb. 27. Mai 2019, kurzweiligen Beiträgen unserer zehn Sektionen und zwei pfiffigen den Senioren – wir können für fast jede Altersgruppe ab Herbst zum Turnen wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, 50cm, 3.360g, Moderatoren durch den Abend geführt. -

Offizielle Ergebnisliste Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Bezirksschulschimeisterschaft 2016 Gen.Nr
Offizielle Ergebnisliste Alpiner Schilauf - Riesentorlauf Bezirksschulschimeisterschaft 2016 Gen.Nr. Schiregion Dachstein West Ausschreibung: Sonstige Rennen Ort und Datum: Gosau Hornspitz, 02.03.2016 Veranstalter: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013) Durchführender Verein: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013) Kampfgericht: Startrichter: EGGER Thomas (AUT) Zielrichter: SCHIFFBÄNKER Peter (AUT) Streckenchef: Putz Anton (AUT) Chef der Zeitmessung: ZEILNER Patrick (AUT) Streckendaten: Durchgang: 1 Startzeit: 10:00 Intervall: 0:30 Kurssetzer: Wallner Christian (AUT) Strecke: Hornspitz Rennpiste Starthöhe: 1405 m Zielhöhe: 1275 m Höhendifferenz: 130 m Anzahl Tore: 20 Gemeldete Starter: 166 In der Wertung: 128 (77,11%) Kinder 4+5 weiblich 1 7 PUTZ Theresa 2005 Welterbe NMS Bad Goisern 48,77 0,00 2 18 POMBERGER Melina 2004 NMS 2 Bad Goisern 49,44 0,67 3 13 REISENBERGER Annika 2004 NMS Neukirchen 52,13 3,36 4 22 WINDISCHBAUER Hannah 2004 Gymnasium ORT 53,38 4,61 5 11 HÖLL Angela 2004 NMS Gosau 53,99 5,22 6 24 KOLLER Marlene 2005 Welterbe NMS Bad Goisern 54,64 5,87 7 17 HEPI Katharina 2004 Welterbe NMS Bad Goisern 55,32 6,55 8 9 HÖLL Fasika 2004 NMS Gosau 56,77 8,00 9 15 MITTENDORFER Julia 2004 NMS Neukirchen 57,38 8,61 10 8 NUSSBAUMER Anna 2004 NMS Neukirchen 1:00,17 11,40 11 2 HAGENEDER Lea 2004 NMS Scharnstein 1:00,43 11,66 12 14 REBHAN Madleen 2004 NMS Neukirchen 1:06,84 18,07 13 20 POSCH Sarah 2005 NMS Gosau 1:07,83 19,06 14 5 AICHER Jasmin 2004 NMS Laakirchen 1:10,20 21,43 15 3 WÖLGER Anna 2004 NMS Neukirchen 1:14,13 25,36 16 4 REITINGER Hannah 2004 SMS Ebensee 1:24,94 36,17 Mittwoch, 02. -

Senioren-Sportfest-Gschwandt 2017 Wertung WEIBLICH
Senioren-Sportfest-Gschwandt 2017 Wertung WEIBLICH Rang Name Ortsgruppe Punkte m/w 1 Riedl Rosi Roitham 148 w 1 Ziegler Inge Roitham 148 w 3 Peiskammer Maria Pinsdorf 143 w 4 Schögl Franziska Altmünster 142 w 5 Waldl Waltraud Roitham 141 w 6 Oppeneder Maria Vorchdorf 139 w 7 Steinhauser Elfriede Traunkirchen 138 w 8 Danner-Gall Elisabeth Traunkirchen 136 w 9 Huemer Veronika Bad Wimsbach 135 w 10 Fürthbauer Maria Pinsdorf 133 w 11 Lohninger Inga Vorchdorf 129 w 12 Kronberger Elfriede Scharnstein 127 w 13 Hofbauer Theresia Vorchdorf 125 w 14 Spitzbart Aloisia Laakirchen 124 w 14 Trawöger Theresia Neukirchen / Altmünster124 w 16 Holzinger Vroni Roitham 122 w 17 Hüttner Rosi Kirchham 120 w 18 Hessenberger Gerti Kirchham 119 w 19 Hitzenberger Marianne Bad Wimsbach 118 w 20 Kogler Mandlmayr Christine Bad Goisern 117 w 21 Schober Anna Pinsdorf 116 w 21 Viechtbauer Maria Vorchdorf 116 w 23 Bachinger Angela Traunkirchen 115 w 23 Voglsam Ursula Steyr Stadt 115 w 25 Biedermann Käthe Altmünster 114 w 25 Redl Theresia Scharnstein 114 w 27 Feichtinger Anna Traunkirchen 113 w 27 Schobesberger Rosina Pinsdorf 113 w 27 Spitzbart Viktoria Gschwandt 113 w 30 SchiffbänkerWalpurga Altmünster 111 w 31 Krummböck Erika Bad Goisern 109 w 31 Forstinger Josefa Vorchdorf 109 w 31 Kettl Theresia Bad Wimsbach 109 w 34 Raffelsberger Eva Scharnstein 108 w 35 Brunner Elisabeth Kirchham 106 w 35 Stibl Christl Bad Ischl 106 w 37 Rampetsreiter Franziska Neukirchen / Altmünster105 w 38 Beiskammer Gertrude Kirchham 104 w 38 Ganglmayr Erika Traunkirchen 104 w 38 Strubreiter