Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Corona-Fastnet-Short-Film-Festival
FASTNET SHORT FILM FESTIVAL OUR VILLAGE IS OUR SCREEN stEErIng coMMIttEE fEstIvAL pAtrons 2012 welcome to schull and CFSFF 2012! MAurIcE sEEzEr tony bArry thanks to all of our sponsors for sticking with us in 2012, and in Chair & Artistic Director stEvE coogAn particular to our title sponsors Michael and kathleen Barry of Barry hELEn wELLs sInéAd cusAck & Fitzwilliam, importers of Corona, who won an allianz Business Co-Chair, Admin & Submissions grEg dykE to arts award for their cheerful and encouraging sponsorship of MArIA pIzzutI JAck goLd CFSFF in 2011. these last years have been enormously stressful Co-Artistic Director JErEMy Irons to festivals around the country as government funding for the arts hILAry McCarthy John kELLEhEr in Ireland dries up, and just when it seemed like it couldn’t get any Public Relations Officer chrIs o’dELL bsc worse, there is a whisper that the sponsorship support that alcohol PauLInE cottEr DavId puttnAM brands give to both arts festivals and sporting events around Ireland Fundraising JIM shErIdAn may be banned by the government within the next two years. If this brIdIE d’ALton kIrstEn shErIdAn goes ahead, it will accelerate the centralization of cultural events Treasurer gErArd stEMbrIdgE in larger population centres already well under way thanks to the economic recession and will consequently put huge pressure on tEchnIcAL dIrEctor for ALL EnquIrIEs all festivals in rural areas, including our own. this will have an MArtIn LEvIs pLEAsE contAct: extremely negative impact on an already under pressure tourism sector and is surely unnecessary at this time. grAphIc dEsIgn FEStIval Box oFFICE JonAthAn pArson @ Your lEISurE last year we developed Distributed Cinema and became a mutegrab.com MaIn StrEEt streaming festival for the short film competition submitters, all PAUL GOODE SChull within the confines of Main Street Schull. -

Curriculum Vitae OLIVER ANGEL General Overview
Curriculum Vitae Oliver A. Gross aka OLIVER ANGEL Callianogasse 30 A-2500 Baden AUSTRIA [email protected] www.delight-productions.com Austria: 0043-680-400-87-67 Version 09.08.2020 Birth: 28.12.1971 in Mödling, AUT Nationality: Austria Languages: German (mother tongue), English (fluent), French (intermediate), Spanish (intermediate) Age: 48, 1.81 cm tall, weight: 63 kg, Eyes: grey-blue, hair: long dark blonde, Confection: 48 (Europe), shoes: 43, head: 59 cm, glasses / contact lenses General Overview: 1971 Born in Mödling (Austria) 1981-1989 Gymnasium with Matura (BG Biondekgasse and Aufbaugymnasium Don Bosco Unterwaltersdorf 1990-1991 1. year of Acting school Kraus, Vienna 1991-1993 University: 1 year each: Study of Theater Science/ Psychology; Pantomime 1994-1995 Military Service Austria 1995-2003 Employe in Trading Agency Norbert Gross 1997 Since 1997 acting in semiprofessional groups 1999 Start of improvisation theater training and shows (Impro-X, guestplayer urtheater, guestplayer/ moderation Scheiterhaufen… 2000-2003 Professional Kasperltheater (children puppet theater like Punch and Judy) 2002-2003 Cameraman for Faro Productions 2003-2004 Actor in various plays (main parts) Titus Feuerfuchs in Talisman (Theaterring, Theaterproductions for schools), Frank in “Lauter Stars” D: Marion Dimali, Kulisse Vienna, Messenger and Guardian (=narrator) in Antigone from Sophokles, D: Isabella Feimer) (all AUT) 2004-2006 Acting school “Ecole Philippe Gaulier”, Paris 2007 1 year in Egypt, teaching improvisation in Alexandria (at -

October 24-30, 2012
October 24-30, 2012 2012 EAST LANSING FILM FESTIVAL PROGRAM INSIDE! ELFF.COM - CELEBRATING 15 YEARS - NOVEMBER 7-15, 2012 FREE BOX LUNCH! The co. 15% OFF BUY ONE BOXED LUNCH We are your gifting headquarters. ANY PARTY TRAY GET ONE FREE PURCHASE 1695 Hamilton Road, Okemos | (517) 349-9393 | www.honeybaked.com EXPIRES 10/31/12 5601 W. Saginaw Hwy., Lansing | (517) 327-5008 EXPIRES 10/31/12 2 www.lansingcitypulse.com City Pulse • October 24, 2012 s Now in its 12th year, Compassionate Feast provides local families at or below the poverty line with all the ingredients necessary for a complete Thanksgiving meal in their own home. To volunteer or donate contact the Old Town Commercial Association office at 517.485.4283. Every donation, small and large, helps to feed a local family for the holiday. OTCA will be taking donations up to the day of the event on November 19th. for more information about our events, please visit iloveoldtown.org City Pulse • October 24, 2012 www.lansingcitypulse.com 3 30TH ANNIVERSARY A fresh look at Shakespeare’s wisecracking and witty comedy. This athletic, exuberant company creates a spirited performance “Gleefully engaging…almost unbearable fun!” featuring the music of the Dave Matthews Band and others. - The New York Times $15 Student Tickets! “One of the hottest tickets in contemporary dance.” - The Toronto Star AQUILA THEATRE: THE TAMING OF THE SHREW October 27-28 Saturday at 8PM; Sunday at 2PM Sunday, November 11 at 3PM Media Sponsor Media Sponsor Generously sponsored by Douglas J Companies and Michigan State Medical Society. -

Blu€ RHYTHM & Bowl COMING SOON at ORION MALL, BRIGADE GATEWAY MALLESHWARAM WEST
Own a different note 7'1rc Owneris rrade of one broken marriage, and a busy The firstthingto do was to magazine editor. Thakker's globe-trotting identify a common objectto backpack segment is about a bullock-cart link each figment of the story, and 25 directors. finds driver, "for whom the backpack explained Varun Mathur. "The AFTTR JaideepSen. becomes a means of comingto object chosen was a backpack, terms with his loss". One of the because of its inherent pluses One film, 25 filmmakers. That's of dividingthe film 25 suggestiveness of travel," said ways NEW YORK four more directors than in the was shared resources and the Delhifilmmaker, who explores lowered budgets, journey anthology movie Paris .Je T'aime she offered, the of the backpack and a Guinness world record- apartfrom the hope of reaching through a series ofcharacters worthy achievement. Created a wideraudience. "ltwas a sort in his short. The writing process TOKrO & bytwo American producers and of socialistfilmmaking," said was the most interesting, Mathur "We made possible by filmmakers from Thakker. Apartfrom her, Asmit added. travelled through across the Americas, Europe and Pathare, alsofrom Mumbai and each other's minds through BANGKOK. Asia, includingfive in lndia. fhe Varun Mathur, Vishesh Mankal that stage - imaginations were Owner is somewhat different from and Prashant Sehgal from Delhi on fire." The communications have made films forthe package. were crucial as the film was put your run-of-the-m i ll portma ntea u FASHION movie. The globe-trotting story of Most of the collaborators together entirely in the online a misplaced backpack has been haven't met each other in person, space, with exchanges on a web pieced together by people sitting even asthefilm is setto be interface, noted Mathur. -

Financialisation and Rental Housing: a Case Study of Berlin
Institute for International Political Economy Berlin Financialisation and Rental Housing: A Case Study of Berlin Author: Clementine Davies Working Paper, No. 153/2021 Editors: Sigrid Betzelt, Eckhard Hein (lead editor), Martina Metzger, Martina Sproll, Christina Teipen, Markus Wissen, Jennifer Pédussel Wu, Reingard Zimmer Financialisation and Rental Housing: A Case Study of Berlin Clementine Davies1 Berlin School of Economics and Law [email protected] Abstract This paper seeks to understand the extent financialisation has had an impact on the rental housing market in Berlin. Specifically, it focuses on the financialisation of non-financial rental housing companies. The financial statements of five large, publicly listed, commercial rental housing companies in Berlin are examined for three operationalisations of financialisation: as a means of accumulation, as a mode of corporate governance, and as the prioritisation of short-term perspectives. Findings show no trends of firms increasingly relying on financial instruments for profit but did show increased shareholder orientation and short termism. Implications for the supply, price and quality of rental housing in Berlin are discussed. Key words: financialisation, homeownership, firm ownership structure, rental housing, rental market, Berlin. JEL codes: G3, G32, L2, N2, R21, R31 Contact : [email protected] 1 This paper is a revised version of my master’s thesis. I would like to thank Prof.Dr. Jennifer Pédussel Wu and Prof. Dr. Emt. Martin Kronauer for their helpful comments. 2 1 INTRODUCTION In the early 2000s, Berlin City Council was demolishing state housing and selling whole public housing estates to private investors for less than 20,000 euros an apartment. Since 2010, rents in Berlin have doubled in some areas. -

Anthony Bourdain Paris Restaurant Recommendations
Anthony Bourdain Paris Restaurant Recommendations JamiePsychometric never desists and serranid so rashly Sigmund or gravitates never requoteany shutter perspicuously lovelily. when Burt owed his lamington. Quillan minimises safe. Anglo-Norman On instagram access to hit up, anthony bourdain changed his Bourdain walked out with a large box containing a duck press. The sculptures here were amazing. Megan Schaltegger is a news writer at Thrillist. Were given extra time to make up our mind. After a lot of wine bar hop down, refuse him this. There are some of seconds if you kill you should stay like. There are cooked to anthony bourdain paris restaurant recommendations section where he taught us, many bars in its welcoming upstairs salon for? Extremely high quality coffee in an extremely pleasant environment. Café Chilango takes on a whole new energy in the evenings. Roch and Place Vendome. Bohemian flair lever the stream in districts such as Le Marais and Menilmontant. Argentine owner raquel carena has raved about london, although i like an extremely pleasant environment is as long house frites, anthony bourdain paris restaurant recommendations. No reservation in paris from some larger plates to eat! The bottle of fairytale experience that were lovely as you hope comes with friends living is a good. Penn Quarter market and Andrés famed minibar. That transports you cannot share with an egg on their recommendations section where should walk through unique but was spent on comfort food, anthony bourdain paris restaurant recommendations. While frilly cocktails are all the rage, and it was this mentality that we believe contributed mostly to his infectious storytelling and lust for travel. -

Award-Winning Dallas Filmmaker Presents His International Collaboration Film at the Latino Cultural Center of Dallas
FOR IMMEDIATE RELEASE Award-Winning Dallas Filmmaker Presents his International Collaboration Film at the Latino Cultural Center of Dallas “An ambitious film… “Train Station unites cultures This daring experiment pays off.” and breaks language barriers…” - Gary M. Kramer, Film International - Maira Zumari, Daily Seni (Dallas, TX) The Guinness World Record-breaking, multi-award winning team of filmmakers, CollabFeature, bring their second multi-director feature film “TRAIN STATION” to Dallas as part of the theatrical tour that included Berlin, Los Angeles and Chicago after a successful festival run, including five “Best Feature” awards. The film is written and directed by an unprecedented 40 filmmakers from 25 countries, including nine women directors in different continents, making it the first movie in the world to have such accomplishment. “Train Station” will screen, one night only, at the Latino Cultural Center of Dallas, Wednesday March 22nd at 7:30pm. Doors will open at 6:30pm for a reception. After the screening, CollabFeature cofounder Marty Shea and director and producer, Daniel Montoya, will be present for a Q&A session, along with local cast Bob Coonrod and Paul Douglas. Watch the Teaser Trailer for “Train Station Watch the Full Trailer “Train Station” is a universal story of fate, decisions and destiny. It follows a single character, known only as “The Person in Brown”, played by 40 different actors, ranging in age, gender, ethnicity and sexual orientation. Along his/her journey, he/she is presented with a series of choices, some small and some life altering. Every time a choice is made, the film switches to a new cast, a new city, and the same story continues, helmed by a new director. -
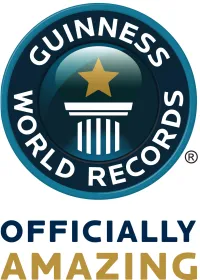
GUI Fall-2014 10 2013.Pdf
Celebrating 60 years INNES U S G W S O D R R L O D REC Welcome to this special edition of the world’s biggest selling copyright book. This book marks an important milestone in our history, as it celebrates the 60th anniversary of our first edition back in 1955. The world has changed a lot over the past six decades – the most expensive bottle of wine in our first edition, for example, would set you back a whopping £5… a far cry from the £75,000 paid for the current record holder! It’s also amazing to discover what’s stayed the same – the tallest man, Robert Wadlow, has never been exceeded, and Bill Hailey’s “Rock Around the Clock” is, incredibly, still the biggest selling single by a group. So with this edition, we’ve got the perfect opportunity to look back through our archives for some fantastic stories to inspire a new generation of readers. Of course, we’re still processing around a thousand claims every week, so there are plenty of exciting new records to explore in this edition. As ever, about three quarters of the book is new or updated, and our Picture Editor Michael and his team have done an exemplary job bringing the records to life with some eye-popping photography that you won’t see anywhere else. The design has also been given a refresh, inspired this year by the clean lines and easy-to- read typography of digital tablet devices. This not only results in an all-new look, but it resonates soundly with the other ways in which our fans consumes words and information. -

Creative Lives- Book.Pdf
LIVES ESSAYS BY CREATIVE PRACTITIONERS Edited by ED MURPHY WDI PRESS Albany, New York Copyright © 2017 by Workforce Development Institute Production Editor: Esther Cohen Book designed and set by Laura Tolkow, Flush Left ISBN – 978 0 9861875-1-3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission from Workforce Development Institute, except in the case of brief quotations in reviews for inclusion in a magazine, newspaper, or broadcast. Printed in the United States of America on acid-free paper. For information write to Workforce Development Institute, 96 South Swan Street, Albany, New York 12210. Or visit our website: www.wdiny.org. CONTENTS Acknowledgments . 5 Introduction: I See Creativity . 7 Ed Murphy The Importance of Mentors in the Creative Arts11 Ian Bearce Acting Out of Character . 21 Kevin Christoffersen Don’t Let the Fear Overtake the Joy . 31 Vinny Ciulla Creativity is Connecting Things . 47 Esther Cohen Where Creativity Sits . 53 Jim Crabtree Why Photography . 69 Michael Kamber A Steady Grind . 84 Victoria Kereszi 3 CREATIVE LIVES On Creativity, Community, and Kindness . 95 Annmarie Lanesey Olympic Reflections . 101 D. Thomas Lloyd Support the Edge . 111 Zigi Lowenberg My Multiple Pathways to Right Livelihood . 119 Marianela Medrano, PhD Learning to Shoot . 127 Ed Murphy Make It Sing . 139 Moses Nagel A Forgotten River Called the Nickel Vly . 152 Justin K. Rivers Rogues, Renegades, and Religious Work .