Bevölkerungsforschung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The M Project Jean-Marie Robine,A Siu Lan K
Common adult longevity and compression of mortality: the M Project Jean-Marie Robine,a Siu Lan K. Cheung, a Shiro Horiuchi,b and A. Roger Thatcher c aINSERM, Health and Demography, bProgram in Urban Public Health at Hunter College and CUNY Institute for Demographic Research, cFormer Director of the Office of Population Censuses and Surveys, London Correspondence: [email protected] Short abstract (150 words): The M Project - M for Mode - started in 2005 with the aim of studying the adult longevity to better understand the lengthening of adult life duration in contrast with the fall of infant and child mortality and the increase in life expectancy at birth. Specific targets deal with the assessment of the occurrence of the scenario of mortality compression, the shape of the distribution of adult life durations, their dispersion around the modal age at death (M), and the extreme values such as the maximum reported ages at death. Disentangling socio-economic inequalities (SES) in adult longevity from “limit” variability may be an important target in the future of the M-Group. Several papers have already been published; others are in press or in progress. They deal with actual data, formal demography and mechanisms of the compression of mortality. We propose to summarize our results for the general IUSSP conference (150 words). Long abstract (4 pages): The M Project - M for Mode - started in 2005 with the aim of studying the adult longevity to better understand the longevity revolution defined as the lengthening of adult life duration in contrast with the fall of infant and child mortality and the increase in life expectancy at birth. -

Effects of Fertility Decline on Family Well Being: Opportunities for Evaluating Population Programs*
DRAFT: Comment Welcomed [email protected] Effects of Fertility Decline on Family Well Being: Opportunities for Evaluating Population Programs* T. Paul Schultz Yale University March 14, 2005 Abstract The paper considers the association between fertility and family outcomes. Voluntary population programs are supported to help people control their fertility and improve their lives, but just how strong is this link? Evaluations of family planning programs rarely isolate the contribution of policies to fertility reduction and thereby to the long run welfare of families. Many other developments are attributed a role in declining fertility. Do these two distinct sources of fertility variation have different welfare implications? To identify the effect of fertility, such as might be caused by exogenous factors including policies, empirical analysis has focused on the consequences of twins, the sex composition of initial births, and subsidies to local family planning, all of which may impact fertility independently of desired fertility and affect other family outcomes, such as the mother’s market labor supply, and the health and schooling of her children. Instrumental variable estimates of the “cross-effect” of fertility on family welfare tend to be about half as large as the direct OLS estimates. Are quantity and quality of children really substitutes, and are the family benefits of exogenous fertility decline as large as the cross sectional associations would suggest? 193 words Keywords: Population Programs Evaluations, Consequences of Fertility Decline, Demographic Transition JEL classification: J13, J11 , J13 * Support for preparing this paper was provided by the MacArthur Foundation and the discussion of their network and comments of referees on a previous draft are appreciated. -

Population and Development Review Cumulative Index
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW CUMULATIVE CONTENTS VOLUMES 1–35 1975–2009 To use this index, open the bookmarks in this document by clicking the “Bookmarks” tab along the left-hand side of the display window. About the cumulative index The index consists of two major sections. I. Lists of: a. Articles, Notes & Commentary, Data & Perspectives, and Signed Book Reviews b. Archives by original year of publication c. Archives d. Documents e. Books Reviewed II. Table of Contents for all issues in volumes 1 to 35 and Supplements to Population and Development Review. The TOCs include links to PDFs of full text stored on www.JSTOR.org or www.Interscience.Wiley.com. How to use the cumulative index 1. If they are not already displayed, open the bookmarks in this document by clicking the “Bookmarks” tab along the left-hand side of the display window. 2. Click within the bookmarks and select the list you would like to search. 3. Pull-down the “Edit” tab and select “Find” (Ctrl + F). 4. Type your search term and click the “Next” button to find a relevant listing. Note that the “Find” feature will search through the entire cumulative index beginning with the list you select. 5. To read the full article, go to the relevant table of contents using the bookmarks. 6. Click the article title to open the PDF. PDFs of articles are stored on the JSTOR or Wiley Interscience site. The links will automatically direct you to these sites. Accessing PDFs Articles on the JSTOR and Wiley Interscience sites are available only to subscribers, which include many libraries and institutions. -

Living-100-Insights-Challenges.Pdf
Living to 100 Insights on the Challenges and Opportunities of Longevity Literature Review 2002–2017 April 2019 Living to 100 Insights on the Challenges and Opportunities of Longevity SPONSOR Research Expanding Boundaries Pool AUTHORS Sean She, FSA, MAAA Committee on Life Insurance Research Francisco J. Orduña, FSA, MAAA Product Development Section Peter Carlson, FSA, MAA Committee on Knowledge Extension Research 1 | P a g e This publication has been prepared for general informational purposes only; and is not intended to be relied upon as accounting, tax, financial or other professional advice. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgement. Please refer to your advisors for specific advice. Neither Ernst & Young LLP, the authors, nor any other member of Ernst & Young Global Limited can accept any responsibility or liability for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. Neither SOA, the authors nor Ernst & Young LLP recommend, encourage or endorse any particular use of the information provided in this publication. Neither SOA, the authors nor Ernst & Young LLP make any warranty, guarantee or representation whatsoever. None of SOA, the authors nor Ernst & Young LLP assume any responsibility or liability to any person or entity with respect to any losses arising in connection with the use or misuse of this publication. The opinions expressed and conclusions reached by the authors are their own and do not represent any official position or opinion of the Society of Actuaries or its members. The Society of Actuaries makes no representation or warranty to the accuracy of the information. -

Population and Family Estimation Methods at Statistics Canada
Catalogue no. 91-528-X ISBN 978-1-100-23160-0 Population and Family Estimation Methods at Statistics Canada by Demography Division Release date: March 3, 2016 How to obtain more information For information about this product or the wide range of services and data available from Statistics Canada, visit our website, www.statcan.gc.ca. You can also contact us by email at [email protected] telephone, from Monday to Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m., at the following toll-free numbers: • Statistical Information Service 1-800-263-1136 • National telecommunications device for the hearing impaired 1-800-363-7629 • Fax line 1-877-287-4369 Depository Services Program • Inquiries line 1-800-635-7943 • Fax line 1-800-565-7757 Standards of service to the public Standard table symbols Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, The following symbols are used in Statistics Canada reliable and courteous manner. To this end, Statistics Canada has publications: developed standards of service that its employees observe. To . not available for any reference period obtain a copy of these service standards, please contact Statistics .. not available for a specific reference period Canada toll-free at 1-800-263-1136. The service standards are ... not applicable also published on www.statcan.gc.ca under “Contact us” > 0 true zero or a value rounded to zero “Standards of service to the public.” 0s value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful distinction between true zero and the value that was rounded p preliminary Note of appreciation r revised Canada owes the success of its statistical system to a x suppressed to meet the confidentiality requirements long-standing partnership between Statistics Canada, the of the Statistics Act citizens of Canada, its businesses, governments and other E use with caution institutions. -

Is the Compression of Morbidity a Universal Phenomenon?
Is There a Limit to the Compression of Mortality? Jean-Marie Robine,1 Siu Lan K. Cheung,2 Shiro Horiuchi3 and A. Roger Thatcher4 Presented at the Living to 100 and Beyond Symposium Orlando, Fla. January 7-9, 2008 Copyright 2008 by the Society of Actuaries. All rights reserved by the Society of Actuaries. Permission is granted to make brief excerpts for a published review. Permission is also granted to make limited numbers of copies of items in this monograph for personal, internal, classroom or other instructional use, on condition that the foregoing copyright notice is used so as to give reasonable notice of the Society's copyright. This consent for free limited copying without prior consent of the Society does not extend to making copies for general distribution, for advertising or promotional purposes, for inclusion in new collective works or for resale. 1INSERM, Health and Demography. Correspondence: [email protected]. 2 Hong Kong University of Science and Technology. 3 Program in Urban Public Health at Hunter College and CUNY Institute for Demographic Research. 4 Former Director of the Office of Population Censuses and Surveys, London. Abstract With the fall of mortality, the frequency distribution of ages at death has been shifting to the right, but it has not retained the same shape over time. The distribution of ages at death has become more compressed around the mode, which is consistent with the prediction of mortality compression proposed by James Fries in 1980. In this paper we investigate trends in the age distribution of deaths at old ages using historical data from European countries (i.e., England and Wales, France, Italy, Sweden and Switzerland), the United States of America and Japan. -
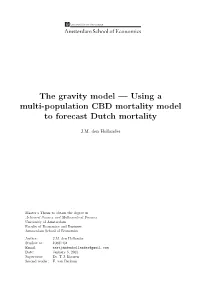
The Gravity Model — Using a Multi-Population CBD Mortality Model to Forecast Dutch Mortality
The gravity model | Using a multi-population CBD mortality model to forecast Dutch mortality J.M. den Hollander Master's Thesis to obtain the degree in Actuarial Science and Mathematical Finance University of Amsterdam Faculty of Economics and Business Amsterdam School of Economics Author: J.M. den Hollander Student nr: 10681434 Email: [email protected] Date: January 5, 2015 Supervisor: Dr. T.J. Boonen Second reader: F. van Berkum The gravity model | J.M. den Hollander iii Abstract In the first decade of the 21st century, the longevity of the Dutch, especially males, experienced a strong boost. This boost, which is largely absent in other popula- tions in Europe, caused Dutch insurers problems when developing a Solvency II internal model for life risk. The longevity boost makes it difficult to fit a stochastic mortality model to Dutch data, as pre-2002 and post-2002 data prescribe different trends. This thesis introduces a term to the Cairns-Blake-Dowd (CBD) mortality model, to couple Dutch mortality to European mortality. This idea was explored before in an APC (Age-Period-Cohort) model. The resulting model was named the gravity model, which is also the name that will be used for the model in this thesis. The rationale behind the gravity model, is that culturally, economically and technologically similar and connected populations, such as the Dutch and the European population, should not exhibit widely different mortality statistics. As no longevity boost is present in other European countries, and the Dutch longevity boost followed a period of relative stagna- tion in mortality improvement, assuming a coupling between Dutch and European data could lead to a better model fit. -

Arthur Roger Thatcher's Contributions to Longevity Research: a Reflexion
Demographic Research: Volume 22, Article 18 Reflexion Arthur Roger Thatcher's contributions to longevity research: A Reflexion Jean-Marie Robine1 Siu Lan K. Cheung2 Shiro Horiuchi3 Arthur Roger Thatcher, CB, died in London on February 13, 2010, at 83 years of age. He was actively engaged in demographic research until his death. One of his last papers, The Compression of Deaths above the Mode, is published in this volume of Demographic Research (Thatcher et al. 2010). Roger signed the copyright agreement for the paper on January 24, just a few weeks before his death. Another contribution will appear in a forthcoming monograph entitled Supercentenarians (Maier et al. 2010). In this note, we, the co-authors of his Demographic Research paper, will briefly review his remarkable research accomplishments. Roger Thatcher was born in Birmingham in 1926. He worked for 26 years as a statistician in several national government offices. Later, he served as Registrar General for England and Wales, and was Director of the Office of Population Censuses and Survey (OPCS) from 1978 to 1986. A short description of his professional career up to his retirement can be found in Population Trends (1986). He had a long-standing affinity for the history of actuarial sciences and statistics in England, taking particular interest in the early years of the Statistical Society of London, and helping to compile extracts from its 1830s Proceedings (see Boreham et al. 1988 and Rosenbaum 2001). He published a historical abstract (1971) of British labour-force statistics back to 1886. Thatcher was also a scientist with broad interests, publishing papers in a wide range of fields, such as archaeology, mathematics (number theory), and cosmology (1976, 1978 and 1982). -

Beyond the Kannisto-Thatcher Database on Old Age Mortality
Mortality at old ages: Evaluation of data quality D.A. Jdanov 1,2 and D. Jasilionis 3 1Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany; [email protected] 2New Economic School, Moscow, Russia; [email protected] 3Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany; [email protected] The old age population in developed countries has increased remarkably. Yet internationally comparable high quality data on oldest-old mortality remain relatively scarce. Our study addresses several data quality issues relevant to population and death statistics above the age 80. Following previous studies by V.Kannisto, we apply the same set of measures and introduce new methods. Using data from the Human Mortality Database, we update prior findings by extending the analyses made so far to thirty five countries and by adding data on longer historical periods. We propose a systematic classification of country- and period-specific data, thus simultaneously accounting for each indicator of data quality. The results show that the data quality varies across countries and time periods. We found that data for some countries such as Chile, Canada, Germany, and the USA, mortality indicators for the most advanced ages should be treated with caution even for the most recent decades. Keywords: old age mortality, quality of statistics, population estimates 1. Introduction The old age population in developed countries has increased very rapidly throughout the second half of the 20th century. Improvements in survival are pushing new limits: today more than half of all males and two thirds of all females born in Western countries may reach their 80 th birthday. -

UC Berkeley CEDA Papers
UC Berkeley CEDA Papers Title Population Forecasting for Fiscal Planning: Issues and Innovations Permalink https://escholarship.org/uc/item/7n02r268 Authors Lee, Ronald D. Tuljapurkar, Shripad Publication Date 2000 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California December 21, 1998 date last saved: 12/21/98 6:01 PM date last printed: 03/24/99 2:43 PM Population Forecasting for Fiscal Planning: Issues and Innovations Ronald Lee Demography and Economics University of California 2232 Piedmont Ave Berkeley, CA 94720 Shripad Tuljapurkar Mountain View Research 2251 Grant Road Mountain View, CA 94024 email: [email protected] We are grateful to Michael Anderson, Timothy Miller, Carl Boe, Ryan Edwards, and Bryan Lincoln for their research contributions to projects on which this paper draws. We have benefited from comments on an earlier draft by Dan McFadden, Jim Smith, and Peter Diamond, as well as by other conference participants. Lee’s research for this paper was funded by a grant from NIA, AG11761. Tuljapurkar’s research for this paper was funded by a grant from NICHD, HD32124. The authors also acknowledge support by Berkeley’s NIA-funded Center for the Economics and Demography of Aging. i I. Abstract This abstract consists of a concise list of conclusions from the analysis in this paper. A. Assessing Recent Official US Vital Rate Forecasts • In retrospect, it appears that over the last fifty years, the Census and Social Security forecasters attached too much importance to the most recently observed levels of fertility and mortality. • Recent Census Bureau projections of US fertility, based on race/ethnic disaggregation, appear to be too high. -
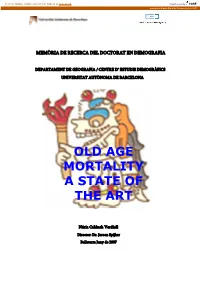
Old Age Mortality a State of the Art
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Diposit Digital de Documents de la UAB MEMÒRIA DE RECERCA DEL DOCTORAT EN DEMOGRAFIA DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA / CENTRE D’ ESTUDIS DEMOGRÀFICS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA OLD AGE MORTALITY A STATE OF THE ART Núria Calduch Verdiell Director: Dr. Jeroen Spijker Bellaterra Juny de 2007 2 MEMÒRIA DE RECERCA DEL DOCTORAT EN DEMOGRAFIA DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA / CENTRE D’ ESTUDIS DEMOGRÀFICS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA OLD AGE MORTALITY A STATE OF THE ART Núria Calduch Verdiell Director : Dr. Jeroen Spijker Bellaterra Juny de 2007 3 Cover image: Ah Puch (The God of Death of the Maya People) 4 Agraïments No puc dir que la redacció d’aquesta memòria hagi estat un procès llarg com acostuma a ser si no que tot el contrari, ha estat un procès curt però molt intens i l’he pogut dur a terme gràcies a l’ajut i recolzament que he rebut per part de tantes persones. Voldria començar els meus agraïments per a la Dra. Anna Cabré, directora del Centre d’ Estudis Demogràfics per haver-me donat l’oportunitat de realitzar aquesta memòria. Per a mi a significat molt més que un treball de recerca m’ha fet entrar en un nou mon, el de la investigació. Al Jeroen Spijker el director d’aquesta memòria, per tota la seva inesgotable dedicació, estic segura que sense el seu ajut el resultat d’ aquesta memòria hagués estat un altre. Agrair també a l’Amand Blanes, ja que d’ ell vaig rebre els primers consells per a dur a terme aquesta memòria, al Daniel Devolder per facilitar-me tants articles que em van servir per fer madurar el tema d’investigació, a la Candi Abella qui sempre ha tingut a mà qualsevol dels llibres que he necessitat i a tots els companys del CED que em preguntaven constantment com anava aquesta tesina. -
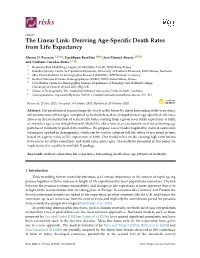
The Linear Link: Deriving Age-Specific Death Rates from Life Expectancy
risks Article The Linear Link: Deriving Age-Specific Death Rates from Life Expectancy Marius D. Pascariu 1,2,∗ , Ugofilippo Basellini 3,4 , José Manuel Aburto 2,3,5 and Vladimir Canudas-Romo 6,∗ 1 Biometric Risk Modelling Chapter, SCOR Global Life SE, 75795 Paris, France 2 Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, University of Southern Denmark, 5000 Odense, Denmark 3 Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), 18057 Rostock, Germany 4 Institut National D’études Démographiques (INED), 93300 Aubervilliers, France 5 Leverhulme Centre for Demographic Science, Department of Sociology and Nuffield College, University of Oxford, Oxford OX1 2BQ, UK 6 School of Demography, The Australian National University, Canberra 2600, Australia * Correspondence: [email protected] (M.D.P.); [email protected] (V.C.-R.) Received: 27 July 2020; Accepted: 14 October 2020; Published: 20 October 2020 Abstract: The prediction of human longevity levels in the future by direct forecasting of life expectancy offers numerous advantages, compared to methods based on extrapolation of age-specific death rates. However, the reconstruction of accurate life tables starting from a given level of life expectancy at birth, or any other age, is not straightforward. Model life tables have been extensively used for estimating age patterns of mortality in poor-data countries. We propose a new model inspired by indirect estimation techniques applied in demography, which can be used to estimate full life tables at any point in time, based on a given value of life expectancy at birth. Our model relies on the existing high correlations between levels of life expectancy and death rates across ages.