Institutioneller Wandel Im Globalen Klimaschutz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Uncaria Gambier Roxb) from Southeast Aceh As Antidiabetes
-Glucosidase Inhibitory Activity of Ethanolic Extract Gambier (Uncaria gambier Roxb) From Southeast Aceh As Antidiabetes Vera Viena1,2 and Muhammad Nizar2 {[email protected]} 1Laboratory of Chemical and Environmental Engineering, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia 2Department of Environmental Engineering, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia Abstract. Plants continue to play an important role in the treatment of diabetes. Gambier (Uncaria gambier Roxb) is one of the plants used for commercial product as a betel meal for the Acehnese. In this research we studied the inhibition activity of α-glucosidase enzyme toward gambier ethanolic extract as antidiabetes. The extraction of leaves, twigs and commercial gambier were performed by maceration method using ethanol solvent for 3 x 24 hour. Analysis of inhibition activity of α-glucosidase enzyme from each extract was done using microplate-96 well method, then the IC50 value was determined. The results showed that the inhibition activity of alpha glucosidase enzyme against gambier ethanolic extract was giving positive result, in delaying the glucose adsorption, while the highest activity was found in gambier leaves of 96,446%. The IC50 values of gambier leaves extract were compared to positive control of acarbose (Glucobay®) atwith ratio of 35,532 ppm which equal to 0,262 ppm. In conclusion, the gambier ethanolic extract has the best inhibitory activity against the alpha glucosidase enzyme to inhibite the blood sugar level, which can be used as one of traditional herbal medicine (THM) product. Keywords: α-Glukosidase, Inhibitory Activity, Gambier, Antidiabetes. 1 INTRODUCTION Metabolic disorder diseases such as Diabetes Mellitus (DM) was characterised by high blood glucose level or hyperglycemia because of insulin insufficiency and/or insulin resistance. -

Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni in Nagan Raya and Central Aceh Regency
Society, 8 (2), 529-545, 2020 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni in Nagan Raya and Central Aceh Regency Dharma Kelana Putra 1,* Wahyu Wiji Astuti 2, and Muhammad Hafidz Assalam 2 1 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 23123, Banda Aceh, Indonesia 2 Department of Indonesian Literature, Faculty of Language and Art, Universitas Negeri Medan, 20222, Medan, North Sumatra, Indonesia * Corresponding Author: [email protected] ARTICLE INFO ABSTRACT Publication Info: This research describes how the mining conflicts in Nagan Literature Review Raya and Central Aceh Regency between the local community and PT Emas Mineral Murni (PT EMM). This research uses a How to cite: descriptive qualitative method with a literature study as a data Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). Conflict collection technique by searching literature through online Analysis of PT Emas Mineral news pages on the internet using the search keyword “Aceh Murni in Nagan Raya and Central Conflict PT EMM”. Content analysis uses Occam’s razor Aceh Regency. Society, 8(2), 529- logical principle to read and interpret data to explain a 545. complete picture of the conflict situation without involving unnecessary assumptions. This research found many DOI: 10.33019/society.v8i2.193 stakeholders involved in the conflict aside from the local Copyright © 2020. Owned by community and PT EMM. Besides, the conflict is focused not Author(s), published by Society only on competition to seize natural resources but also on overlapping legal authority. Low interaction between stakeholders causes conflict to grow and develop. -

Optimization of Special Autonomy Funds Allocation to Alleviate Poverty in Aceh (A Case Study in Districts/Cities)
International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 9, Issue 4, 2019 Optimization of Special Autonomy Funds Allocation to Alleviate Poverty in Aceh (A Case Study in Districts/Cities) Husni Jalil,a Teuku Ahmad Yani,b Andri Kurniawan,c Professor at Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh Indonesia,a Lecturer at Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh Indonesia,b,c Email: [email protected],a [email protected],b [email protected] Aceh Province is a region with special autonomy. In addition to having income sourced from the fiscal balance fund from the central government, it is also granted a Special Autonomy Fund. The fund is not only intended to carry out provincial government affairs but also district/city affairs. One aspect of the use of Special Autonomy Funds, as mandated by law, is to reduce poverty. However, the Special Autonomy Fund has been granted for 12 years and the poverty rate in Aceh is still high above the national average, even if identified as misdirected. Thus, this study aims to find the reasons why Special Autonomy Funds are not significantly reducing poverty in Aceh. It will also investigate a model to overcome the problem. This is a legal study because the legal aspect, namely the Aceh Qanun as a legal umbrella term, is the basis of the use of Special Autonomy Funds. The results showed that Special Autonomy Funds are misused, misdirected, and mostly dominated by province. Moreover, the use of the fund is heavily influenced by political interests. -

Unraveling the Complexity of Human–Tiger Conflicts in the Leuser
Animal Conservation. Print ISSN 1367-9430 Unraveling the complexity of human–tiger conflicts in the Leuser Ecosystem, Sumatra M. I. Lubis1,2 , W. Pusparini1,4, S. A. Prabowo3, W. Marthy1, Tarmizi1, N. Andayani1 & M. Linkie1 1 Wildlife Conservation Society, Indonesia Program, Bogor, Indonesia 2 Asian School of the Environment,Nanyang Technological University, Singapore, Singapore 3 Natural Resource Conservation Agencies (BKSDA), Banda Aceh, Aceh Province, Indonesia 4 Wildlife Conservation Research Unit and Interdisciplinary Center for Conservation Science (ICCS), Department of Zoology, University of Oxford, Oxford, UK Keywords Abstract human–tiger conflict; large carnivore; livestock; Panthera; poaching; research- Conserving large carnivores that live in close proximity to people depends on a implementation gap; retaliatory killing. variety of socio-economic, political and biological factors. These include local tol- erance toward potentially dangerous animals, efficacy of human–carnivore conflict Correspondence mitigation schemes, and identifying and then addressing the underlying causes of Muhammad I. Lubis, Asian School of the conflict. The Leuser Ecosystem is the largest contiguous forest habitat for the criti- Environment, Nanyang Technological cally endangered Sumatran tiger. Its extensive forest edge is abutted by farming University, Singapore. communities and we predict that spatial variation in human–tiger conflict (HTC) Email: [email protected] would be a function of habitat conversion, livestock abundance, and poaching of tiger and its wild prey. To investigate which of these potential drivers of conflict, Editor: Julie Young as well as other biophysical factors, best explain the observed patterns, we used Associate Editor: Zhongqiu Li resource selection function (RSF) technique to develop a predictive spatially expli- cit model of HTC. -

Uji Efikasi Dua Herbisida Pada Pengendalian Gulma Di Lahan Sederhana
Jurnal Pertanian ISSN 2087-4936 e-ISSN 2550-0244 61 Volume 10 Nomor 2, Oktober 2019 UJI EFIKASI DUA HERBISIDA PADA PENGENDALIAN GULMA DI LAHAN SEDERHANA EFFICACY TEST OF TWO HERBICIDES IN CONTROL WEEDS IN SIMPLE LAND PROCESSING D S P S Sembiring1, N S Sebayang2a 1 Program Study Agrotektologi, Universitas Sains Cut Nyak Din Langsa, Jl Jenderal Ahmad Yani No. 8-9, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, 24354 1 Program Study Agrotektologi, Universitas Gunung Leuser Aceh, Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, 24651 a Korespondensi: Nico Sebayang, E-mail: [email protected] (Diterima: 30-07-2019; Ditelaah: 31-07-2019; Disetujui: 29-08-2019) ABSTRACT Residents of agrarian areas are residents who depend their livelihood to agricultural products, but the production of community plantations is often not as desired. Our research aims to know influence the physiological response of weeds to glyphosate herbicide and paraquat herbicide. This experiment was conducted at the UGL Kutacane Faculty of Agriculture experimental garden, Babussalam Subdistrict, Southeast Aceh Regency, which ran from January to February 2018. This study used a non-factorial Randomized Block Design (RBD) consisting of 4 treatment levels: H1: Glyphosate Herbicide = 300 ml/4 L water; H2: Glyphosate herbicide = 1000 ml/13 L water; H3: Herbicide Paraquat = 300 ml/4 L water; H4: Herbicide Paraquat = 1000 ml/13 L of water. The results of Glyphosate Herbicide 1000 ml / 13 L of water effectively control total weeds up to 14 HSA. Glyphosate herbicide is able to inhibit the 5- enolpiruvil-shikimat-3-phosphate synthase (EPSPS) enzyme which plays a role in the formation of aromatic amino acids. -
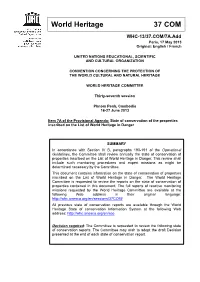
State of Conservation of the Properties Inscribed on the List of World Heritage in Danger
World Heritage 37 COM WHC-13/37.COM/7A.Add Paris, 17 May 2013 Original: English / French UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE WORLD HERITAGE COMMITTEE Thirty-seventh session Phnom Penh, Cambodia 16-27 June 2013 Item 7A of the Provisional Agenda: State of conservation of the properties inscribed on the List of World Heritage in Danger SUMMARY In accordance with Section IV B, paragraphs 190-191 of the Operational Guidelines, the Committee shall review annually the state of conservation of properties inscribed on the List of World Heritage in Danger. This review shall include such monitoring procedures and expert missions as might be determined necessary by the Committee. This document contains information on the state of conservation of properties inscribed on the List of World Heritage in Danger. The World Heritage Committee is requested to review the reports on the state of conservation of properties contained in this document. The full reports of reactive monitoring missions requested by the World Heritage Committee are available at the following Web address in their original language: http://whc.unesco.org/en/sessions/37COM/ All previous state of conservation reports are available through the World Heritage State of conservation Information System at the following Web address: http://whc.unesco.org/en/soc Decision required: The Committee is requested to review the following state of conservation reports. The Committee may wish to adopt the draft Decision presented at the end of each state of conservation report. TABLE OF CONTENT I. STATE OF CONSERVATION REPORTS ......................................................................... -

Factors Influencing Intention to Stop Smoking in Community in Nagan Raya Aceh, Indonesia
Advances in Health Sciences Research, volume 22 4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019) Factors Influencing Intention to Stop Smoking in Community in Nagan Raya Aceh, Indonesia Vera Nazhira Arifin1*, Eva Nursatika1, Intan Liana1, Febbyola Presilawati1, Meutia Zahara2,3, Ramadhaniah1 1Faculty of Public Health, University Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia 2Postgraduate Program of Public Health, University Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia 3Department of Biology, Islamic Faculty, University Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia * Corresponding author. Email: [email protected] ABSTRACT One of the health effort in terms of reducing deaths from cigarettes each year is to limit smoking consumption through increased intention to quit smoking. Basic Health Research Data 2013 shows that the current proportion of smokers in Aceh province is (29.3%) and the proportion according to smoking habit in Nagan Raya is (21.7%) consisting of every day smokers (17.3%) and periodically smokers (4.4%). This study aims to determine the factors that affect the intention to stop smoking in Gampong Kuta Paya Seunagan District Nagan Raya District Year 2015. This research is analytical descriptive with cross sectional design. The data were collected by interview using questionnaire. The population in this study was the entire head of the family who smoked as many as 63 people (Total Sampling). This research was conducted from 27 October to 10 November 2015. Data analysis with Chi Square Test and Logistic Regression. The result of the research shows that the respondent age is less productive (38.1%), respondents work as self-employed (34,9%), respondent earn over UMP (76.2%), respondents smoke filter cigarettes (68.3%) .Respondents had no intention (68.3%), respondents behave negatively (58.7%), respondents with negative normative belief (65.1%), and respondents with no motivation (63.5%). -
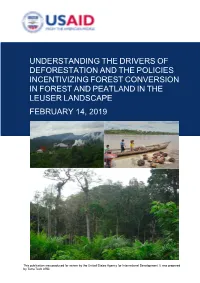
Understanding the Drivers of Deforestation and the Policies Incentivizing Forest Conversion in Forest and Peatland in The
UNDERSTANDING THE DRIVERS OF DEFORESTATION AND THE POLICIES INCENTIVIZING FOREST CONVERSION IN FOREST AND PEATLAND IN THE LEUSER LANDSCAPE FEBRUARY 14, 2019 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Tetra Tech ARD. This publication was prepared for review by the United States Agency for International Development under Contract # AID-497-TO-15-00005. The period of this contract is from July 2015 to July 2020. Implemented by: Tetra Tech P.O. Box 1397 Burlington, VT 05402 Tetra Tech Contacts: Reed Merrill, Chief of Party [email protected] Rod Snider, Project Manager [email protected] Cover: Palm oil plantation at the border of Rawa Singkil Wildlife Reserve in Le Meudama Village, Trumon, Aceh Selatan. USAID LESTARI Understanding the Drivers of Deforestation and the Policies Incentivizing Forest Conversion in Forest and Peatland in the Leuser Landscape Page | ii UNDERSTANDING THE DRIVERS OF DEFORESTATION AND THE POLICIES INCENTIVIZING FOREST CONVERSION IN FOREST AND PEATLAND IN THE LEUSER LANDSCAPE FEBRUARY 14, 2019 DISCLAIMER This publication is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this publication are the sole responsibility of Tetra Tech ARD and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. USAID LESTARI Understanding the Drivers of Deforestation and the Policies Incentivizing Forest Conversion in Forest and Peatland in the Leuser Landscape Page | 1 TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES AND TABLES .......................................................................................... 3 LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ..................................................................... 4 EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................ -
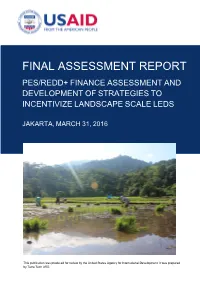
Final Assessment Report
FINAL ASSESSMENT REPORT PES/REDD+ FINANCE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF STRATEGIES TO INCENTIVIZE LANDSCAPE SCALE LEDS JAKARTA, MARCH 31, 2016 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Tetra Tech ARD. This publication was prepared by PT. Hydro Program International and supported by the USAID LESTARI program. This publication was prepared for review by the United States Agency for International Development under Contract # AID-497-TO-15-00005. The period of this contract is from July 2015 to July 2020. Implemented by: Tetra Tech P.O. Box 1397 Burlington, VT 05402 FINAL ASSESSMENT REPORT PES/REDD+ FINANCE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF STRATEGIES TO INCENTIVIZE LANDSCAPE SCALE LEDS JAKARTA, MARCH 31, 2016 DISCLAIMER This publication is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this publication are the sole responsibility of Tetra Tech ARD and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. USAID LESTARI Final Assessment Report - PES/REDD+ Finance Assessment and Development of Strategies to Incentivize Landscape Scale LEDS P a g e | 1 TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES ................................................................................................................. 4 LIST OF FIGURES ............................................................................................................... 5 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ................................................................................. -

Plagiarism Checker X Originality Report
Plagiarism Checking Result for your Document Page 1 of 6 Plagiarism Checker X Originality Report Plagiarism Quantity: 11% Duplicate Sources found: Date Tuesday, February 12, 2019 Click on the highlighted sentence to see sources. Words 280 Plagiarized Words / Total 2549 Words Sources More than 30 Sources Identified. Internet Pages Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Remarks 3% https://www.emeraldinsight.com/doi/full/ Improvement. <1% https://www.researchgate.net/publication <1% https://www.revolvy.com/topic/North%20Ce Effect of Highway Network Connectivity on Regional Development in the North Zone of Aceh H Fithra1, <1% http://jatit.org/volumes/ninetyseven1.ph Sirojuzilam2, S M Saleh3 and Erlina4 1 Doctoral Program of Regional Planning, University of Sumatera Utara, 1% https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfpl Medan, Indonesia, 2Doctoral Program of Regional Planning, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, <1% https://www.sciencedirect.com/science/ar 3 Department of Civil Engineering, University of Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, 4Doctoral Program of Regional Planning, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia ABSTRACT The geographical area of the <1% https://www.fhwa.dot.gov/security/emerge province of Aceh which is bordered by the oceans and only has land connection with the province of North <1% http://ppjpi.unair.ac.id/informasi-scopu Sumatra has made Aceh dependsgreatly on this neighboring province. <1% http://www.emeraldinsight.com/doi/10.110 <1% https://khairoelanwarr.blogspot.com/2015 In fact, -

The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami Disaster Mitigation in Simeulue Regency, Aceh Province
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science PAPER • OPEN ACCESS Related content - Indigenous knowledge management to The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami enhance community resilience to tsunami risk: lessons learned from Smong traditions in Simeulue island, Indonesia Disaster Mitigation in Simeulue Regency, Aceh A Rahman, A Sakurai and K Munadi Province - Spatial analysis on school environment characteristics in mangrove management based on local wisdom (Case study at To cite this article: A N Gadeng et al 2018 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 145 012041 Lhokseumawe, Aceh) Dewi Susiloningtyas, Tuty Handayani, Naila Amalia et al. - Redesign of Denggung Park as Sleman Urban Park based on Local Wisdom in View the article online for updates and enhancements. Yogyakarta I Sanjaya and IS Fatimah This content was downloaded from IP address 118.96.249.42 on 11/05/2018 at 15:31 1st UPI International Geography Seminar 2017 IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science1234567890 145 (2018) ‘’“” 012041 doi :10.1088/1755-1315/145/1/012041 The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami Disaster Mitigation in Simeulue Regency, Aceh Province A N Gadeng*, E Maryani and D Rohmat Department of Geography Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi 229, Bandung 40154, Indonesia *[email protected] Abstract. When tsunami occurred in 26th December 2004, the number of people who died in Aceh Province land were 300.000 people whereas in Simeulue only 7 people who died. It is supposed that there is local wisdom in Simeulue community. The study is aimed to reveal the form of local wisdom smong in Simeulue community. -

Cave Settlement Potential of Caves and Rock Shelters in Aceh Besar Regency
Berkala Arkeologi Volume 40 No. 1, May 2020, 25-44 DOI: 10.30883/jba.v40i1.506 https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id CAVE SETTLEMENT POTENTIAL OF CAVES AND ROCK SHELTERS IN ACEH BESAR REGENCY POTENSI HUNIAN GUA DAN CERUK DI KABUPATEN ACEH BESAR Taufiqurrahman Setiawan Archaeology Research Office of North Sumatera [email protected] ABSTRAK Bukti adanya kehidupan masa prasejarah di Aceh telah dibuktikan dengan hasil penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara. Sampai saat ini penelitian masih terfokus di pesisir timur dan pegunungan tengah Aceh, Pesisir barat Aceh belum pernah diteliti. Pesisir barat Aceh merupakan wilayah yang memiliki bentangalam kars cukup luas, dan memiliki potensi gua yang mungkin digunakan sebagai lokasi hunian pada masa lalu. Salah satu metode yang digunakan adalah memprediksi keberadaan gua dengan peta topografi, peta geologi, serta digital elevation model (DEM). Selain itu, hasil inventarisasi gua yang pernah dilakukan di wilayah pesisir barat Aceh juga digunakan sebagai data awal untuk memperoleh sebaran gua dan ceruk. Pada penelitian ini lingkup wilayah yang disurvei adalah Kabupaten Aceh Besar. Tiga parameter gua hunian, yaitu morfologi dan genesa, lingkungan, serta kandungan arkeologis, digunakan untuk memperoleh gambaran potensi masing-masing gua. Sebelas gua dan ceruk yang telah ditemukan menunjukkan adanya tiga buah gua berpotensi sebagai lokasi hunian dan diteliti lebih lanjut, empat gua berpotensi sebagai lokasi hunian tetapi tidak berpotensi untuk diteliti, dan empat gua berkategori tidak potensial sebagai lokasi hunian. Kata Kunci: Gua; Ceruk; Karst; Pesisir Barat Aceh; Prasejarah ABSTRACT The evidence of prehistoric life in Aceh has been proven by the results of archeological research conducted by the Archaeology Research Office of North Sumatera.