15 08 21 Luecke Promo Vero
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Medieval Art & Architecture
Medieval Art & Architecture The Libraries of Professor Joachim Gaehde, Brandeis University and Dr. Lillian M.C. Randall, Curator of Manuscripts and Rare Books, Walters Art Gallery, Baltimore 1,288 titles in ca. 1,475 physical volumes From Brandeis Universisty website Remembering Joachim Gaehde, professor emeritus of fine arts Joachim Gaehde Nov. 26, 2013 Joachim Gaehde, professor emeritus of fine arts, passed away Nov. 24, of pneumonia. He was 92 and lived in Arlington, Mass. A scholar of Carolingian illuminated manuscripts, Gaehde was the eminence grise of the Department of Fine Arts for most of his long tenure at Brandeis, said his colleague Nancy Scott, associate professor of fine arts. Gaehde was born in Dresden, Germany, in 1921. His mother was Jewish, and he survived most of the war years in Nazi Germany. He emigrated to the United States in 1950 and later earned his doctoral degree from the Institute of Fine Arts at New York University. In 1962, Gaehde joined the Brandeis faculty as an associate professor and was promoted to full professor in 1969. He also served as dean of the faculty in the 1970s under President Marver Bernstein. Scott said that Gaehde defined the field of medieval studies at Brandeis, and became well known for his rigorous course studies; his kindly concern and manner toward students; and his wit, elegance and dedication. “As a colleague, [he] held the department to high standards, and at the same time he enjoyed the pleasures of his American life — he favored a blue Fiat convertible, which he drove with the top down in all kinds of weather; loved his Rhodesian Ridgeback dogs, which were part of his daily constitutionals; and was a gourmet cook,” recalled Scott. -

The Anglo-Saxon Transformations of the Biblical Themes in the Old English Poem the Dream of the Rood
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Nr 8 (1/2014) ALEKSANDRA MRÓWKA (JAGIELLONIAN UNIVERSITY) THE ANGLO-SAXON TRANSFORMATIONS OF THE BIBLICAL THEMES IN THE OLD ENGLISH POEM THE DREAM OF THE ROOD ABSTRACT The main aim of this article is to present the Old English poem The Dream of the Rood as a literary work successfully mingling Christian and Germanic tradi- tions. The poet very skillfully applies the pattern of traditional secular heroic poetry to Christian subject-matter creating a coherent unity. The Biblical themes and motifs are shaped by the Germanic frame of mind because the addressees of the poem were a warrior society with a developed ethos of honour and cour- age, quite likely to identify with a god who professed the same values. Although the Christian story of the Passion is narrated from the Anglo-Saxon point of view, the most fundamental values coming from the suffering of Jesus and his key role in God’s plan to redeem mankind remain unchanged: the universal notions of Redemption, Salvation and Heavenly Kingdom do not lose their pri- mary meaning. KEY WORDS Bible, rood, crucifixion, Anglo-Saxon, transformation ABOUT THE AUTHOR Aleksandra Mrówka The Department of the History of British Literature and Culture Jagiellonian University in Kraków e-mail: [email protected] 125 Aleksandra Mrówka __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ The Dream of the Rood is a masterpiece of Old English religious poetry. Written in alliterative verse and maintained in the convention of dream allegory, this piece of early medieval literature is a mixture of Christian and Anglo-Saxon traditions. Although they seem to be contrasting, they are not antagonistic: these two worlds mingle together creating a coherent unity. -

The Instrumental Cross and the Use of the Gospel Book Troyes, Bibliothèque Municipale MS 960
The Instrumental Cross and the Use of the Gospel Book Troyes, Bibliothèque Municipale MS 960 Beatrice Kitzinger In approximately 909, a Breton named Matian together with his wife Digrenet donated a gospel manuscript to a church called Rosbeith. They intended it should remain there on pain of anathema, never to be taken from the church by force but provided with a dispensation for removal by students for the express purpose of writing or reading. With the exception of the date, which is recorded elsewhere in the manuscript, these specifications all appear in a short text written in distinctive, highlighted script at the close of Luke’s chapter list (f. 71): These little letters recount how Matian, and his wife Digrenet, gave these four books of the gospel as a gift to the church of Rosbeith for their souls. And whosoever should remove this evangelium from that church by force, may he be anathema—excepting a student [in order] to write or to read.1 The location of Rosbeith is unknown, but we may surmise that it was a church attached to a larger abbey in Brittany, according to Breton nomenclature.2 Apart from their Breton origins and evident appreciation for scholarship, the identities of Matian and Digrenet are similarly murky. The particularizing nature of the note extends only to a statement of Matian and Digrenet’s motive for the gift—“for their souls”—and a designation of the contents: “these four books of the gospel.” We know, however, that the couple was anxious Kitzinger – Instrumental Cross about the fate of their souls at judgment, and we know that they thought the gospel manuscript at hand might help. -

Hellenistic and Pharaonic Influences on the Formation of Coptic Identity
Scriptura 85 (2004), pp. 292-301 HELLENISTIC AND PHARAONIC INFLUENCES ON THE FORMATION OF COPTIC IDENTITY Annette Evans Department of Ancient Studies Stellenbosch University Abstract Conflicting descriptions of Coptic identity still exist today. The Copts regard themselves as those descendents of Pharaonic Egyptians who have retained their identity because of their Christian faith, in spite of Egypt having become a predominantly Islamic, Arab country. They claim to have “caught a glimpse of the Light of Christianity” before the birth of Christ. This article offers iconographical evidence to supplement an explanation of how the ancient Egyptian mythopoeic thinking, in combination with the syncretistic cultural environment of Hellenism, mediated this phenomenon. Today the Coptic Orthodox Church of Egypt represents “a return to the apostolic father type leading of the church”. Although pharaonic and gnostic influences appear to have contributed to their remarkable eusebeia, the Copts perceive themselves as having abided by the decisions of the first three Church Councils and have respected and upheld the canon. 1. Introduction The word Copt originated from the ancient Egyptian word for Memphis, Hah-ka-Ptah – the house or temple of the spirit of Ptah. With the suppression of the prefix and the suffix the stem kaPt or gypt remained, which was then corrupted to the Arabic Qibt (Atiya 1968:16). The Hellenes used Aiguptos for both Egypt and the Nile, and Aiguptoi was used by Origen to distinguish Egyptian Christians from Hellenes (Van der Vliet and Zonhoven 1998:117). The Copts have a unique identity: inseparable from their pharaonic past, yet intimately associated with the beginning of Christianity. -

September 2017 N°17
ISSN 2499-1341 EXPRESSION quarterly e-journal of atelier in cooperation with uispp-cisenp. international scientific commission on the intellectual and spiritual expressions of non-literate peoples N°17 September 2017 CULT SITES AND ART Anthropomorphic face on the entrance slab of a circular ceremonial structure from Har Karkom, Negev desert, Israel (Pre-pottery Neolithic site BK 608). EDITORIAL NOTES accompany them. What echoes accompanied CULT SITES the paintings in the prehistoric caves? What performances, if any, were taking place in front AND ART of the decorated rock surfaces? The visual art stresses myths, mythical beings Walking along a narrow trail, on the edge of and/or historical facts, which are related to the a steep valley in the middle of a deep forest, cult and to the sanctity of the site. It is the visual we suddenly heard noises of human presen- memory that justifes the function of the site. ce, voices that were neither speeches nor son- Was it the same in prehistoric times? In front of gs, something in between. We reached a cave where a number of people were assembled in rock art sites, in the Camonica Valley, Italy, or a corner and an old bearded man was standing in Kakadu in Arnhem Land, Australia, or in the on an upper step of the rock talking ... perhaps Drakensberg caves, South Africa, or in the Al- talking, perhaps declaiming, perhaps singing, tamira cave, Spain, the presence of prehistoric but not to the people below. He was talking or art awakens a sense of sacredness, we feel that performing or praying in front of a white rock these were and are special places but .. -

Shifts in the Identity of the Byzantine Croce Degli Zaccaria
Visual and Textual Narratives: Shifts in the Identity of the Byzantine Croce degli Zaccaria Caitlin Mims The True Cross, understood by the Christian faithful as traveled from Byzantium to the west is now known as the the wood on which Christ was crucified, was legendarily Croce degli Zaccaria (Figure 1).5 In the pages that follow I discovered by Helena, the mother of Byzantine Emperor will examine how the Byzantine identity of this reliquary was Constantine I, in 362 CE in Jerusalem.1 This discovery perceived as it moved through the medieval world. established imperial Byzantine control of the Cross and its This staurotheke was commissioned in the ninth cen- relics, limiting their movement out of Byzantium.2 With the tury by one Caesar Bardas to be deposited at the Basilica of Crusader sack of Constantinople in 1204, reliquaries of the Saint John in Ephesus, now modern-day Turkey.6 By 1470 True Cross became more accessible. Many were taken west it was documented as being in Genoa, gifted by a family of into the treasuries of Western European churches, where merchants, and thus had left its Byzantine audience.7 I argue they can still be found today.3 The reception of these objects that the identity of this reliquary underwent two shifts in the varied, but often, western viewers imposed new identities medieval period. First, in Ephesus, the Cross was refashioned on these reliquaries by refashioning them or assigning them in conscious imitation of an earlier Byzantine form. I dem- new narratives.4 One such reliquary of the True Cross that onstrate that this served to evoke an older tradition of cross reliquaries, emphasizing the object’s Greek Orthodox prov- enance and Byzantine history. -

Christian Cruciform Symbols and Magical Charaktères Luc Renaut
Christian Cruciform Symbols and Magical Charaktères Luc Renaut To cite this version: Luc Renaut. Christian Cruciform Symbols and Magical Charaktères. Polytheismus – Monotheismus : Die Pragmatik religiösen Handelns in der Antike, Jun 2005, Erfurt, Germany. hal-00275253 HAL Id: hal-00275253 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00275253 Submitted on 24 Apr 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. CHRISTIAN CRUCIFORM SYMBOLS victory in Milvius Bridge, Constantine « was directed in a dream to cause AND MAGICAL CHARAKTÈRES the heavenly sign of God ( caeleste signum Dei ) to be delineated on the Communication prononcée dans le cadre du Colloque Polytheismus – Mono- shields of his soldiers, and so to proceed to battle. He does as he had been theismus : Die Pragmatik religiösen Handelns in der Antike (Erfurt, Philo- commanded, and he marks on the shields the Christ[’s name] ( Christum in sophische Fakultät, 30/06/05). scutis notat ), the letter X having been rotated ( transversa X littera ) and his top part curved in [half-]circle ( summo capite circumflexo ). »4 This As everyone knows, the gradual political entrance of Christian caeleste signum Dei corresponds to the sign R 5. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

The Sacred City of the Ethiopians, Being a Record of Travel and Research in Abyssinia in 1893
The sacred city of the Ethiopians, being a record of travel and research in Abyssinia in 1893 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.CH.DOCUMENT.sip100052 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org The sacred city of the Ethiopians, being a record of travel and research in Abyssinia in 1893 Author/Creator Bent, J. Theodore Date 1896 Resource type Books Language English Subject Coverage (spatial) Horn of Africa, Ethiopia, Axum, Eritrea Source Smithsonian Institution Libraries, DT379 .B47 1896X/916.3 B475s Description Contents. I: Arrival in Ethiopia. II: Stay at Asmara. III: Expedition to the monastery of Bizen. -

Saint Gayane Church
Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění Saint Gayane Church Bakalárska diplomová práca Autor: Michaela Baraničová Vedúci práce: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres Brno 2020 ii Prehlasujem, že som svoju bakalársku diplomovú prácu vypracovala samostatne a uviedla všetkú použitú literatúru a pramene. .............................................................. Podpis autora práce iii iv On the ancient peak of Ararat The centuries have come like seconds, And passed on. The swords of innumerable lightnings Have broken upon its diamond crest, And passed on. The eyes of generations dreading death Have glanced at its luminuos summit, And passed on. The turn is now yours for a brief while: You, too, look at its lofty brow, And pass on! Avetik Isahakyan, “Mount Ararat”, in Selected Works: Poetry and Prose, ed. M. Kudian, Moscow 1976. v vi My first sincere thanks belong to my thesis’ supervisor, prof. Ivan Foletti, for his observations, talks and patience during this time. Especially, I would like to thank him for introducing me to the art of Caucasus and giving me the opportunity to travel to Armenia for studies, where I spent five exciting months. I would like to thank teachers from Yerevan State Academy of Arts, namely to Gayane Poghosyan and Ani Yenokyan, who were always very kind and helped me with better access of certain Armenian literature. My gratitude also belongs to my friends Susan and colleagues, notably to Veronika, who was with me in Armenia and made the whole experience more entertaining. To Khajag, who helped me with translation of Armenian texts and motivating me during the whole process. It´s hard to express thanks to my amazing parents, who are constantly supporting me in every step of my studies and life, but let me just say: Thank you! vii viii Content Introduction.........................................................................1 I. -
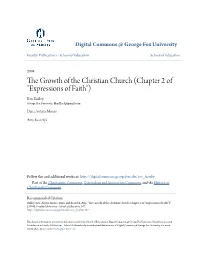
The Growth of the Christian Church (Chapter 2 of "Expressions of Faith") Ken Badley George Fox University, [email protected]
Digital Commons @ George Fox University Faculty Publications - School of Education School of Education 2004 The Growth of the Christian Church (Chapter 2 of "Expressions of Faith") Ken Badley George Fox University, [email protected] Dana Antayá-Moore Amy Kostelyk Follow this and additional works at: http://digitalcommons.georgefox.edu/soe_faculty Part of the Christianity Commons, Curriculum and Instruction Commons, and the History of Christianity Commons Recommended Citation Badley, Ken; Antayá-Moore, Dana; and Kostelyk, Amy, "The Growth of the Christian Church (Chapter 2 of "Expressions of Faith")" (2004). Faculty Publications - School of Education. 167. http://digitalcommons.georgefox.edu/soe_faculty/167 This Article is brought to you for free and open access by the School of Education at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications - School of Education by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. CHAPTER 2 The Growth of the Christian Church No time machine will transport you to faraway places and times, Introduction but through this chapter, you can come to understand something of the history of the Christian Church. In doing so, you will gain a better sense of how there came to be a variety of ways of inter preting this faith, which has had a major impact on Canadian society and on the character of Newfoundland and Labrador. As you explore the five scenarios presented here, you will learn how various Christians struggled to live as persons of faith. This chapter begins about 300 years after Paul wrote his letter to the Galatians, telling them to focus on faith, not rules. -

Chrismon Booklet | East Liberty Presbyterian Church
CHRISMONS East Liberty Presbyterian Church 116 South Highland Avenue Pittsburgh, PA 15206-3985 CHRISMONS The word “Chrismon” is a combination of the words “Christ” and “monogram”. The word Chrismon has been adopted to refer to special Christmas tree ornaments that have been developed to display symbols of Christ. The designs of the Chrismons has over the years been extended to represent symbols of Christianity. All the ornaments are done in white and gold. In 1957 Chrismon ornaments were made and displayed on a Christmas tree at the Lutheran Church of the Ascension in Danville, Virginia. Through this church patterns were made available, and the idea of having a Chrismon tree has spread. Over the years more ornaments have been developed so that now a Chrismon may be a monogram, a sign, a symbol, a type, or a combination of such figures. The only requirement is that it refer primarily to Christ and God. The Eight Pointed Star symbolizes regeneration through Baptism. The Triquetra and Circle. The endless circle suggests eternity. The triquetra—the figure composed of three separate and equal arcs— symbolizes the One God who showed himself to man in three separate and distinct persons. Christogram with Cross, Cho Rho, Triangle and M. The Chi Rho, Cross and Triangle are familiar sym- bols of Christ and the Trinity, M is the monogram for his mother, Mary, which suggests His humanity. The Fleur-De-Lis is the conventionalized form of the lily, the flower of the virgin Mary, and the symbol of the annunciation of Jesus. The Five-Pointed Star is the great symbol of the Epiphany; the star that led the three wise men to the nativity.