Revision Des Silene (Heliosperma) Pusilla Agg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Untangling Phylogenetic Patterns and Taxonomic Confusion in Tribe Caryophylleae (Caryophyllaceae) with Special Focus on Generic
TAXON 67 (1) • February 2018: 83–112 Madhani & al. • Phylogeny and taxonomy of Caryophylleae (Caryophyllaceae) Untangling phylogenetic patterns and taxonomic confusion in tribe Caryophylleae (Caryophyllaceae) with special focus on generic boundaries Hossein Madhani,1 Richard Rabeler,2 Atefeh Pirani,3 Bengt Oxelman,4 Guenther Heubl5 & Shahin Zarre1 1 Department of Plant Science, Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, School of Biology, College of Science, University of Tehran, P.O. Box 14155-6455, Tehran, Iran 2 University of Michigan Herbarium-EEB, 3600 Varsity Drive, Ann Arbor, Michigan 48108-2228, U.S.A. 3 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, P.O. Box 91775-1436, Mashhad, Iran 4 Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, 40530 Göteborg, Sweden 5 Biodiversity Research – Systematic Botany, Department of Biology I, Ludwig-Maximilians-Universität München, Menzinger Str. 67, 80638 München, Germany; and GeoBio Center LMU Author for correspondence: Shahin Zarre, [email protected] DOI https://doi.org/10.12705/671.6 Abstract Assigning correct names to taxa is a challenging goal in the taxonomy of many groups within the Caryophyllaceae. This challenge is most serious in tribe Caryophylleae since the supposed genera seem to be highly artificial, and the available morphological evidence cannot effectively be used for delimitation and exact determination of taxa. The main goal of the present study was to re-assess the monophyly of the genera currently recognized in this tribe using molecular phylogenetic data. We used the sequences of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) and the chloroplast gene rps16 for 135 and 94 accessions, respectively, representing all 16 genera currently recognized in the tribe Caryophylleae, with a rich sampling of Gypsophila as one of the most heterogeneous groups in the tribe. -
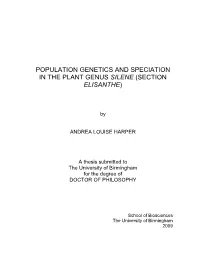
Section Elisanthe)
POPULATION GENETICS AND SPECIATION IN THE PLANT GENUS SILENE (SECTION ELISANTHE) by ANDREA LOUISE HARPER A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Biosciences The University of Birmingham 2009 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This thesis is concerned with speciation and population genetics in the plant genus Silene (section Elisanthe). The introductory chapter is a literature review covering characteristics of the species studied, and the current literature on their evolutionary dynamics and population genetics. The second and third chapters cover techniques used in all experiments, such as DNA extraction, sequencing and genotyping protocols, and explain the rationale behind the initial experimental design. The fourth chapter focuses on the multi-locus analysis of autosomal gene sequences from S. latifolia and S. dioica. The relationship between the two species was investigated using various analyses such as isolation modeling and admixture analysis providing estimates of evolutionary distance and extent of historical gene flow. The maintenance of the species despite frequent hybridization at present-day hybrid zones is discussed. -

Diversity of Sexual Systems Within Different Lineages of the Genus Silene
Research Article Diversity of sexual systems within different lineages of the genus Silene Ine´s Casimiro-Soriguer1,2*, Maria L. Buide1 and Eduardo Narbona1 1 A´ rea de Bota´nica, Departamento de Biologı´a Molecular e Ingenierı´a Bioquı´mica, Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, Spain 2 A´ rea de Bota´nica, Departamento de Biologı´a Vegetal y Ecologı´a, Universidad de Sevilla, Avenida Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla, Spain Received: 16 December 2014; Accepted: 26 March 2015; Published: 10 April 2015 Associate Editor: Diana Wolf Citation: Casimiro-Soriguer I, Buide ML, Narbona E. 2015. Diversity of sexual systems within different lineages of the genus Silene. AoB PLANTS 7: plv037; doi:10.1093/aobpla/plv037 Abstract. Species and populations can be categorized by their sexual systems, depending on the spatial distribu- tion of female and male reproductive structures within and among plants. Although a high diversity of sexual systems exists in Silene, their relative frequency at the genus and infrageneric level is unknown. Here, we carried out an exten- sive literature search for direct or indirect descriptions of sexual systems in Silene species. We found descriptions of sexual systems for 98 Silene species, where 63 and 35 correspond to the phylogenetically supported subgenera Silene and Behenantha, respectively. Hermaphroditism was the commonest sexual system (58.2 %), followed by dioecy (14.3 %), gynodioecy (13.3 %) and gynodioecy–gynomonoecy (i.e. hermaphroditic, female and gynomonoecious plants coexisting in the same population; 12.2 %). The presence of these sexual systems in both subgenera suggests their multiple origins. -

PLANT SCIENCE Bulletin Summer 2013 Volume 59 Number 2
PLANT SCIENCE Bulletin Summer 2013 Volume 59 Number 2 1st Place Triarch Botanical Images Student Travel Awards Ricardo Kriebel The New York Botanical Garden Flower of Miconia arboricola (Melastomataceae: Miconieae) in late anthesis In This Issue.............. Dr. Thomas Ranker and The BSA awards many for their PLANTS Recipients excel in others elected to serve the contributions.....p. 36 botany ......p. 15 BSA.....p. 35 From the Editor PLANT SCIENCE Every year this is one of my favorite issues of BULLETIN Plant Science Bulletin because we get to recognize Editorial Committee the accomplishments of some of our most worthy Volume 59 members. The Merit Awardees have been elected to the most select group of professional botanists in North America. Begun at the Fiftieth Anniversary Elizabeth Schussler (2013) meeting, 55 years ago, the Merit Award recognizes Department of Ecology & individuals for their outstanding contributions to the Evolutionary Biology mission of the Botanical Society. These are people University of Tennessee whose names we recognize from their publications, Knoxville, TN 37996-1610 presentations, and service to the society. They are [email protected] leaders at their own institutions, in the Botanical Society and in other scientific organizations. What I find more interesting, though, are the younger members being recognized for their Christopher Martine potential. These are graduate students beginning (2014) to make their mark in botanical research and being Department of Biology invested with the opportunity to help direct the Bucknell University evolution of the Society. They are also undergraduates Lewisburg, PA 17837 being recognized by their mentors for their initiative, [email protected] enthusiasm and drive to make discoveries and share their love of plants with others. -

Red Campion Date: October 2017 by Misha Norland, Mani Norland & the School of Homeopathy
Orchard Leigh · Rodborough Hill · Stroud · Gloucestershire · England · GL5 3SS T: +44 (0)1453 765 956 · E: [email protected] www.homeopathyschool.com Proving: Red Campion Date: October 2017 By Misha Norland, Mani Norland & The School of Homeopathy. Seven provers (six female, one male). Common name: Red campion Scientific name: Silene dioica Family: Caryophyllaceae Habit: attractive medium to tall perennial plant with a downy stem. Leaves: opposite pairs, with hairs on the leaf. Flowers: pink-red in colour with five petals that are fused at their base forming a tube that is surrounded by a purple-brown calyx. Red campion is dioecious, a botanical term, meaning the male and female flowers grow on separate plants, hence the species name dioica. The flowers of red campion are important for various pollinating insects including bees, butterflies and hover flies. Where: native. Look for this species in lightly shaded areas in woodland, along hedgerows, fields, ditches and roadside verges. This species is an ancient woodland indicator, so may give a clue to the history of a wood. When: a perennial or biennial, it flowers from May to September. Medicinal: traditional medicines used red campion seeds to treat snakebites. Folklore and art: a noticeable flower the red campion has been mentioned in various poems, for example ‘Summer Woods’ by the poet Mary Howitt. Red campion’s genus name Silene probably derives from the Greek word sialon, which means saliva in reference to the gummy exudate occurring on the stems. It may also derive from Silenus, teacher, faithful companion, and foster father of Dionysus (Greek god of wine) who was covered with foam, referencing the gummy exudate commonly found on stems. -

Genomic and Metagenomic Analyses Reveal Parallel Ecological Divergence in Heliosperma Pusillum (Caryophyllaceae)
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/044354; this version posted March 17, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. Genomic and Metagenomic Analyses Reveal Parallel Ecological Divergence in Heliosperma pusillum (Caryophyllaceae) Emiliano Trucchi1*, Božo Frajman2, Thomas H.A. Haverkamp3, Peter Schönswetter2,§, Ovidiu Paun1,§ 1Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Rennweg 14, 1030 Vienna, Austria 2Institute of Botany, University of Innsbruck, Sternwartestraße 15, 6020 Innsbruck, Austria 3Department of Biosciences, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 Oslo, Norway *Corresponding author: [email protected] §Shared last authors. Abstract Cases of parallel ecological divergence in closely related taxa offer an invaluable material to study the processes of ecological speciation. Applying a combination of population genetic and metagenomic tools on a high-coverage RAD sequencing dataset, we test for parallel evolution across six population pairs of Heliosperma pusillum and H. veselskyi (Caryophyllaceae), two plant species found in the south-eastern Alps and characterized by clear morphological (glabrous vs. hairy) and ecological (alpine vs. montane, wet vs. dry) differentiation. Our analyses support a scenario of multiple independent instances of divergence between these species during the last 10,000 years. Structure analyses and simulations show that interspecific gene flow in each population pair is very low. A single locus, annotated as E3 ubiquitin ligase, an enzyme involved in plant innate immunity, shows a pattern of non-random segregation across populations of both species. -

Spatiotemporal Variation in the Role of Hummingbirds As Pollinators of Silene Virginica
Ecology, 82(3), 2001, pp. 844±851 q 2001 by the Ecological Society of America SPATIOTEMPORAL VARIATION IN THE ROLE OF HUMMINGBIRDS AS POLLINATORS OF SILENE VIRGINICA CHARLES B. FENSTER AND MICHELE R. DUDASH Department of Biology, University of Maryland, College Park, Maryland 20742 USA, and Mountain Lake Biological Station, Route 1, Pembroke, Virginia 24136 USA Abstract. Pollination restricted to a guild of visitors is central to the concept of pol- lination syndromes. However, there is limited quantitative evidence that the pollination of plants exhibiting certain pollination syndromes is actually dominated by the expected guild of pollinators. We determined the importance of the sole hummingbird species in eastern North America, the Ruby-throat, Archilochus colubris, and invertebrate visitors as polli- nators of Silene virginica, which exhibits traits commonly associated with hummingbird pollination. We quanti®ed the role of either type of visitor as pollinators by comparing female reproductive success of plants that were allowed free access by all visitors to female reproductive success of caged plants that were restricted to pollination by invertebrates (small bees and ¯ies, and in one year Bombus spp.). Spatial and temporal variation in the role of either type of pollinator was documented by comparing the female reproductive success of caged and control plants in two nearby sites for ®ve years. In general we found that hummingbirds are the predominant pollinator of S. virginica, but there is considerable spatiotemporal variation in their role. We discuss the importance of understanding the role of hummingbirds as potential selective agents of S. virginica ¯oral traits within the greater community context of other potential pollinators. -

Sileneae, Caryophyllaceae)
Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 328 Taxonomy and Reticulate Phylogeny of Heliosperma and Related Genera (Sileneae, Caryophyllaceae) BOžO FRAJMAN ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS ISSN 1651-6214 UPPSALA ISBN 978-91-554-6946-7 2007 urn:nbn:se:uu:diva-8171 Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Lindahlsalen, EBC, Norbyvägeb 18A, Uppsala, Thursday, September 27, 2007 at 10:00 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in English. Abstract Frajman, B. 2007. Taxonomy and Reticulate Phylogeny of Heliosperma and Related Genera (Sileneae, Caryophyllaceae). Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 328. 34 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-6946-7. Heliosperma (nom. cons prop.) comprises 15—20 taxa, most of them endemic to the Balkan Peninsula. DNA sequences from the chloroplast (rps16 intron, psbE-petG spacer) and the nuclear genome (ITS and four putatively unlinked RNA polymerase genes) are used to elucidate phylogenetic relationships within Heliosperma, and its position within Sileneae. Three main lineages are found within Heliosperma: Heliosperma alpestre, H. macranthum and the H. pusillum-clade. The relationships among the lineages differ between the plastid and the nuclear trees. Relative dates are used to discriminate among inter- and intralineage processes causing such incongruences, and ancient homoploid hybridisation is the most likely explanation. The chloroplast data strongly support two, geographically correlated clades in the H. pusillum-group, whereas the relationships appear poorly resolved by the ITS data, when analysed under a phylogenetic tree model. However, a network analysis finds a geographic structuring similar to that in the chloroplast data. -

Abstract an Examination of Possible Carnivory in Silene
ABSTRACT AN EXAMINATION OF POSSIBLE CARNIVORY IN SILENE REGIA, A MEMBER OF THE CARYOPHYLLACEAE by Garrett John Dienno Silene regia, commonly known as Royal Catchfly, a member of the Caryophyllaceae, is known to ensnare small insects with its glandular trichomes. This morphological adaptation is primarily thought to deter herbivory, but it has been speculated that S. regia may also be carnivorous. To demonstrate that S. regia is carnivorous the following objectives must be shown: S. regia can attract, capture, and retain prey; secrete proteinases to facilitate nutrient absorption; and absorb/translocate the resultant nutrients. This study addressed the first two of these objectives through field observations, UV photography, SEM imaging, and a series of experiments designed to examine a capture- induced proteinase response. While S. regia was able to ensnare insects and possessed highly specialized morphological structures for doing so a form of active attractant could not be demonstrated, and as such failed to support the first objective in its entirety. Negative test results for a capture-induced proteinase response failed to support the second objective. As both objectives were unsupported it was concluded that S. regia is not carnivorous. AN EXAMINATION OF POSSIBLE CARNIVORY IN SILENE REGIA, A MEMBER OF THE CARYOHPYLLACEAE A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science by Garrett John Dienno Miami University Oxford, Ohio 2017 Advisor: R. James Hickey Reader: Alfredo J. Huerta Reader: Richard C. Moore Reader: Richard H. Munson ©2017 Garrett John Dienno This thesis titled AN EXAMINATION OF POSSIBLE CARNIVORY IN SILENE REGIA, A MEMBER OF THE CARYOHPYLLACEAE by Garrett John Dienno has been approved for publication by The College of Arts and Science and Department of Biology ____________________________________________________ R. -

The Genetic Basis of Gender in Silene Vulgaris
Heredity (1983), 51(1), 371—376 1983. The Genetical Society of Great Britain THEGENETIC BASIS OF GENDER IN SILENE VULGARIS A. HOROVITZ* AND R. DULBERGERt *Department of Genetics, The Hebrew University, Jerusalem Department of Botany, The George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, Israel Received26.xi.82 SUMMARY Inheritanceof gender was studied in tetraploid Silenevulgaris inIsrael. Three main phenotypes, hermaphrodite, H, female, F, and intermediate HF, were recognized. With the support of data from crosses within and between the phenotypes it is postulated that basic gender is controlled at a single tetrasomic locus AA/aa. Quadruplex and triplex AAAA and AAAa individuals exhibit phenotype H, simplex and nulliplex aaaa and Aaaa individuals phenotype F, and AaAa individuals phenotype HF. Predominantly hermaphrodite or pre- dominantly female subgroups of the HF phenotype are liable to be confused with true H or F types, so that misclassifications may blurr the underlying genetic pattern. In the HF phenotype, in which A is assumed to be incompletely dominant over a, expression of male sterility is confined to single flowers or single anthers in a pattern with the appearance of randomness. The question is asked whether the mosaic pattern of sex expression in heterozygotes may reflect vegetative segregation of dissimilar cytoplasmic male sterility factors which are controlled by nuclear restorer genes. 1. INTRODUCTION The Bladder campion Silene vulgaris (Moench) Garcke, Caryophyllaceae, is polymorphic in gender and often forms mixed populations which comprise hermaphrodite, male sterile, and gynomonoecious individuals. Sex inherit- ance in this species has been investigated in a number of studies over a long span of time (Correns, 1904, 1906; Marsden-Jones and Turrill, 1957); however, no clear pattern has emerged. -

California Fish and Game 100(1):7-8; 2014
Winter 2014 1 CALIFORNIA FISH AND GAME “Conservation of Wild Life Through Education” Volume 100 Winter 2014 Number 1 Special Native Plant Issue Gilia tricolor, CDFW Photo by Jeb Bjerke Gilia tricolor, Forests, water power, and wild game are three of California’s greatest resources. They are ours to use but not to destroy. The United States Department of Agriculture says: “The free marketing of wild game leads swiftly to extermination.” —Yearbook, 1910, page 254 Published Quarterly by the California Department of Fish and Wildlife. CALIFORNIA STATE PRINTING OFFICE 2 CALIFORNIA FISH AND GAME Vol. 100, No. 1 FRONTISPIECE.—The first issue ofCalifornia Fish and Game was published in October, 1914. Volume 1 consisted of a total of 5 issues, four of which were published in 1915. Publication has occurred on a quarterly basis beginning with volume 2 in 1916. Winter 2014 3 VOLUME 100 WINTER 2014 NUMBER 1 Published Quarterly by STATE OF CALIFORNIA CALIFORNIA NATURAL RESOURCES AGENCY DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE ISSN: 0008-1078 (print) ISSN: 2331-0405 (online) --LDA-- 4 CALIFORNIA FISH AND GAME Vol. 100, No. 1 STATE OF CALIFORNIA Jerry Brown, Governor CALIFORNIA NATURAL RESOURCES AGENCY John Laird, Secretary for Natural Resources FISH AND GAME COMMISSION Michael Sutton, President Jack Baylis, Vice President Jim Kellogg, Member Richard B. Rogers, Member Jacque Hostler-Carmesin, Member Sonke Mastrup, Executive Director DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE Charlton “Chuck” Bonham, Director CALIFORNIA FISH AND GAME EDITORIAL STAFF Vern Bleich ........................................................................................Editor-in-Chief Debra Hamilton ............ Office of Communication, Education and Outreach -AVU Jeff Villepique, Steve Parmenter ........................................... Inland Deserts Region Scott Osborn, Laura Patterson, Levi Souza, Joel Trumbo .............. -

Phylogenetic Relationships of Silene Sect. Melandrium and Allied Taxa
! "#! $ %&'(%)($ *++%,-,./,0 *+)%12.,.--0.1-,,. ! 3 4 3 3!!35.,6626 !" # $%&%&&'&'()&* * * + ,- . , / ",%&&',+ / *, " - 0 1 * $ 2 -," , 3)',4& , ,'5!6' 6774657 63, -* *8 0 1 " 9 * : * , * 8 ," . ; * : * , * * 0 1,- * * ,- " ,- ; : * . , < . ** * =>? . 6 +/ ,- ; , " * , ! , $ 8* " ,@ * * ,* ! * , - . * **, "# $= $ = =-"=- " "/" /+"%/+%/+%=> =? <-= @ %&' ( ) *+,-./# A" 8/ %&&' <== 37 63% 4 <='5!6' 6774657 63 ( ((( 6 &&!&30 (BB ,:,B C D ( ((( 6 &&!&31 Cover illustrations: Barry Breckling, Sara Gold, Kjell Lännerholm, Anja Rautenberg and Wiebke Rautenberg. List of Papers This thesis is based on the following papers, which are referred to in the text by their Roman numerals. I Rautenberg, A., Filatov, D., Svennblad, B., Heidari, N., Oxel- man, B. (2008) Conflicting phylogenetic signals in the SlX1/Y1 gene in Silene. BMC Evolutionary Biology, 8:299 II Rautenberg, A., Hathaway, L., Oxelman, B., Prentice, H. C. Phylogenetic relationships of Silene section Elisanthe (Caryo- phyllaceae) as inferred from chloroplast and nuclear DNA se- quences. Manuscript. III Rautenberg, A., Hathaway, L., Prentice, H. C., Oxelman, B. Phylogenetic relationships