Bibliotheken in Singapur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interview NTD Full Transcript.Pdf
INTERVIEW Mr Ngiam Tong Dow Singapore – International Medical Centre: A Missed Opportunity, or Not Too Late? By Dr Toh Han Chong, Editor The Singapore healthcare sector has been in flux and yet also in transformation. While well regarded internationally to be robust and reputable, it will continue to face imminent challenges. The speaker for this year’s SMA Lecture, Mr Ngiam Tong Dow, taps on his deep and wide experience in various ministries to offer insights and wisdom on many issues: Singapore as an international medical centre, the possibility of supplier-induced demand in healthcare, as well as his political vision and opinion on Hainanese chicken rice. This is the full version of the SMA News interview with Mr Ngiam. The contents of this interview are not to be printed in whole or in part without prior approval of the Editor (email [email protected]). (For the version published in our September 2013 issue, please see http://goo.gl/DDAcyd.) SMA Lecture 2013 Dr Toh Han Chong – THC: The upcoming SMA Lecture is titled Developing Singapore as an International Medical Centre. Why did you choose this topic? Mr Ngiam Tong Dow – NTD: In Economics, there are two types of economies – production-based and knowledge-based. The former depends on land, labour and capital, but it is the latter that Singapore really needed. This was clear to me as Chairman of Economic Development Board (EDB) in the 1980s. We could not offer cheap labour and cheap land for long. We needed to have a significant niche. At that time, we identified two key areas. -

World Bank Document
PW -ZM/fl.\-. ' ' ttl'lF. U Y Q I A tt?blsD1^ ffR E ST R IC TE D Report No. DB-55a Public Disclosure Authorized This report was prepared for use within the Bank and its affiliated organizations. They do not accept responsibHftv fnr its ntrorvn r rnmnpltenes The report may not be published nor may it be quoted as representing their views. TMTVPMATT(hNAT&L BANK PC)R RECONSTRUCITION AND DTlVP.T.CPMVNT INTPRNATTCONAT DEVELOPMENT ASSOCTATION Public Disclosure Authorized APPRAISAL OF DEVELOPMENT BANKC OF SINGAPORE LTD. Public Disclosure Authorized December 29, 1969 Public Disclosure Authorized Development Finance Companies Department Currency Equivalents 3$ 1 US$ C).327 US$ 1 ,S$ 3.06 S$ 1 million = US$327,000 APPRAISAL OF DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD. CONTENTS Page Paragrc+h SUTPINARY i - ii i - vi.i I. 2ITRODUCTION 1 - 2 1 - 2 II. ENVEIRONMENT 1 - 5 3 - 21 Recent Economic Growth 2 4 Industrial Expansion 2 - 5 - 8 Industrial Finance 2 - 9 9 - 21 III. ESTABLISHIDENT OF DBS 5 - 9 22 - 38 Formation 5 22 - 24 Scope of Operations 5 - 6 25 - 26 Ownership 6 - 7 27 - 30 Board of. Directors 7 31 Executive Committee 7 - 8 32 - 33 MlaInagement and Staff .8 - , 3) = 3 vT. RESOURCES ldrID PFOOR`TFOLIO -l 1 1 39l GP Resources 9 - 39 - 4 Loan Portfolio taken over from 7B 10 - 11 42 - 46 Undisbursed EDB Commitments 11 47 EDBis Equity Portfolio 11 48 V. POLICIES AhD PROCEDuRES 12 - i4 49 - 58 Policies 12 - 13 49 53 Procedures 13 - 1 5 - 58 VI. DBS'S OPERATIONS l - 18 59 - 67 Summary of Operations 14 59 - 60 Long-term Lending Operations 15 - 16 61 Light lndustries Loans 16 62 Equity Investments 17 63 Conmercial Banlcing Operations 17 6L Guarantees 17 65 Underwriting Activities 17 66 Real Estate Operations 17 - 18 67 Page Paragraph VII. -

Annual Report 2014 3
Corporate Information 2 Notice of Annual General Meeting 3 – 5 Profile of Directors 6 – 7 Letter to Shareholders 8 – 12 Governance Report 13 – 22 Audit Committee Report 23 – 25 Statement on Risk Management and Internal Control 26 Shareholding Statistics 27 – 30 List of Top Ten Major Properties by Value 31 Five-Year Group Financial Highlights 32 Reports and Financial Statements 33 – 130 Proxy Form 2 IGB CorporationCorporation Berhad Corporate Information 19641964 - 20142014 BOARD OF DIRECTORS (”BOARD”) REGISTERED OFFICE Level 32, The Gardens South Tower Independent Non-Executive Chairman Mid Valley City Tan Sri Abu Talib bin Othman Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia Group Managing Director Telephone : 603-2289 8989 Telefax : 603-2289 8802 Dato’ Seri Robert Tan Chung Meng AUDITOR Executive Directors PricewaterhouseCoopers (AF1146) Tan Boon Seng Level 10, 1 Sentral Tan Boon Lee Jalan Travers Kuala Lumpur Sentral Independent Non-Executive Directors 50706 Kuala Lumpur, Malaysia Tan Kai Seng Telephone : 603-2173 1188 Yeoh Chong Swee Telefax : 603-2173 1288 Non-Independent Non-Executive Directors REGISTRAR Tricor Investor Services Sdn Bhd (118401-V) Tan Lei Cheng Level 17, The Gardens North Tower Pauline Tan Suat Ming Mid Valley City Tony Tan @ Choon Keat Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia Alternate Directors Telephone : 603-2264 3883 Chua Seng Yong, alternate to Dato’ Seri Robert Tan Chung Meng Telefax : 603-2282 1886 Daniel Yong Chen-I, alternate to Pauline Tan Suat Ming Tan Yee Seng, alternate to Tan Boon Seng -
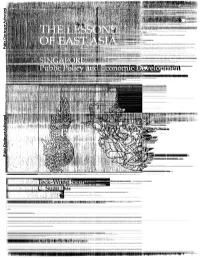
1,L ,, Jxs |.Fix 5!Ii-______=Ie.R
Mil:tlllwxCIf 'IE_'1,l ,, jXS |.fiX 5!ii-__________=ie.r ... .... ... ............... % RMi iJE; _ _____ 1 SE.DI rl n= D~~~~~~~~9 111 Public Disclosure Authorized EaiMi .>~ ~ ~ ~ ~ I'~ ~ GJlN~ l f ______1..MFg EIIn~~~~~g-km. ...... w DI[, t_i _ :... _ _ _,, 3,i,, _i ii_i4i_. Ji T T. Public Disclosure Authorized iS~' ~ ~ I I' ' I A' 4,,,,1,,',I |n~~1 A _ _~ -- =V Public Disclosure Authorized strsjsi li l1le > flill julj 11' ; 1Ci1:llil 3E 81 gt¢W4t jtlu l--:-:------------ .. ~ ~ . = ~1 _ .. _ .. ._ ........................UU....N...IIEIHI. _=__ft!JII!tl lEIIIUh_.,,,_B=I,iJJIIhUEIlJU ,__=IIII3EUIUIIIflII!1I.................................z==_ Public Disclosure Authorized ,~ _.=~ ~ _ _ _== = ,, THE LESSONS OF EAST ASIA Singapore Public Policyand Economic Development Teck-Wong Soon C. Suan Tan The World Bank Washington, D.C. Copyright © 1993 The International Bankfor Reconstruction and Development/THEWORLD BANK 1818H Street, N.W. Washington, D.C 20433,U.S.A. All rights reserved Manufachtred in the United States of America First printing October 1993 The-findings,interpretations, and conclusions expressed in this paper are entirely those of the author(s) and should not be attributed in any manner to the World Bank,to its affiliatedorganizations, or ;,o members of its Board of ExecutiveDirectors or the countries they represent. The World Bank does not guarantee the acCuracyof the data included in this publication and accepts no responsibilitywhatsoever for any consequenceof their use. Ary maps that accompany the text have been prepared solely for the convenienceof readers; the designations and presentation of material in them do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Bank,its affiliates,or its Board or member countries concerng the legal status of any country, tenitory, city, or area or of the authonrtes thereof or concerningthe delimitati of its boundaries or its national affiliation. -

Dialogue with Minister Mentor Lee Kuan
DIALOGUE WITH MINISTER MONTOR LEE KUAN YEW AT THE ASSOCIATION OF BANKS IN SINGAPORE’S 37 TH ANNUAL DINNER TRANSCRIPT OF MINISTER MENTOR LEE KUAN YEW’S DIALOGUE ON 25 JUNE 2010 AT SHANGRI-LA HOTEL Moderator : “Good evening, ladies and gentlemen, friends and colleagues. It is indeed a privilege to have Minister Mentor Lee Kuan Yew join us for a dialogue. I’m pleased to be your moderator. But really, my job is to warm up the Minister Mentor to have a dialogue with you, rather than with me. Not that he needs warming up…actually, you need warming up. So I’ll ask the first few questions. Minister Mentor doesn’t need any introductions so I propose that we get started right away. So please do think of the questions you want to ask. “I should start by saying that I must complement the Minister Mentor for his sartorial elegance. I have not seen Minister Mentor looking so good for a long time. Let me start, Minister Mentor, by taking you back 40 years. The financial sector in Singapore – the audience here and the institutions they represent – has been an important contributor to Singapore’s GDP for over 4 decades. And the question I have, really, is, ‘what was it that made you and Dr Goh believe that financial services would succeed in Singapore? What was the vision then? What was in your head when you launched…(the financial centre)’ Mr Lee : “But first, let me explain my attire. I was in Beijing recently and there was a Singaporean there who was doing a big job in the clothing business. -
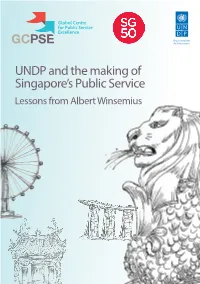
UNDP and the Making of Singapore's Public Service
UNDP and the making of Singapore’s Public Service Lessons from Albert Winsemius © 2015 UNDP Global Centre for Public Service Excellence # 08-01, Block A, 29 Heng Mui Keng Terrace, 119620 Singapore UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and drive and sus- tain the kind of growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in more than 170 countries and territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives and build resilient nations. The Global Centre for Public Service Excellence is UNDP’s cata- lyst for new thinking, strategy and action in the area of public service, promoting innovation, evidence, and collaboration. Disclaimer The views expressed in this publication are those of the author and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or the UN Member States. Cover images Vanessa Leong Yi Tian Printed using 55% recycled, 45% FSC-certified paper. Photo: UNDP GCPSE Contents Foreword i Introduction 1 1. The Singapore that was 2 2. Earlier international assessment and reports 3 3. Why Winsemius? 5 4. The EPTA / UNDP Mission – Getting the team right 8 5. The Mission’s work in Singapore 10 6. Impact of the EPTA / UNDP Mission’s report 14 7. The Common Market and the union with Malaysia 17 8. Becoming the “global city” 20 9. In Winsemius’ view – Five phases of Singapore’s growth 24 10. The ‘UN-orthodox’ economist 30 11. UNDP and the making of Singapore’s public service 35 12. -

102 LIVE FREE Old Frees’ Contribution to Singapore’S Success Story
CHAPTER Old Frees 9 Profiles 102 LIVE FREE Old Frees’ Contribution To Singapore’s Success Story What is astonishing too is that the Penangites in Singapore’s administration and three judges mentioned – Tan Ah Tah, the professions that if all were to return home, The Judiciary AV Winslow and JWD Ambrose were all Singapore would not be able to function! Queen’s Scholars. Lawyer and Old Free Kok Weng On And it is not just the judiciary that pointed out, “At one time in the history Old Frees have dominated. They have also of Singapore, the judiciary was almost occupied some of the highest levels of other completely ‘run’ by Old Frees — from the areas of Singapore’s public service as well as Chief Justice and the judges, the Chief t is a well-known fact that Old Frees in private enterprise. Registrar, the Attorney-General and the have dominated some of the top Singapore’s first Speaker of Parliament, Solicitor-General. The legal might of Penang positions in Singapore’s public service Yeoh Ghim Seng, a prominent surgeon, was Free School!” I- a tribute indeed to the calibre of students an Old Free. So was Lim Ho Hup, described who have gone through the portals of the by former PM Lee as the “lieutenant” HOW IT CAME ABOUT venerable Penang Free School (PFS). of then chairman of the Economic How, you might ask, did all this come about This is most apparent in the case of Development Board, Hon Sui Sen (himself – that is, the prominence of Old Frees in Singapore’s Judiciary. -

Prime Minister's Tribute to the Late Mr Hon Sui Sen In
1 PRIME MINISTER’S TRIBUTE TO THE LATE MR HON SUI SEN IN PARLIAMENT ON 20 DECEMBER 1983 It is with a heavy heart that I pay this tribute in memory of Hon Sui Sen. From August 1970 to October 1983, he was the Finance Minister. He steered our economy through two oil crises. But for a mild hiccough of the low 4% growth in 1974 he secured an average of 8½ % real growth for this period. In his unassuming way, he never claimed any credit for it. In truth he had worked for the 11 years previous to 1970 to help lay the foundation for this success. As Permanent Secretary ( Economic Development ) in Finance Ministry from 1959, Chairman EDB 1961-68, Chairman and President DBS 1968-1970, he helped Goh Keng Swee to work out the strategy for our economy transformation. At a micro-level, he was Chairman of nine companies the Government held equity in - National Iron & Steel Mills Ltd Jurong Shipyard Ltd Sembawang Shipyard (Pte) Ltd Keppel Shipyard (Pte) Ltd Neptune Orient Lines Ltd Jurong Shipbuilders Ltd Singapore Electronic & Engineering Ltd lky/1983/lky1220.doc 2 The Insurance Corporation of Singapore Ltd Singapore Petroleum Company He was also a Director of INTRACO. In 1970 I was confronted with the awesome prospect of moving Goh Keng Swee from the Ministry of Finance to Defence. Ministry of Defence needed him to move from the first stage of basic military training to the second stage of weapons systems and brigade structures. I was in a quandary. An inadequate Finance Minister would be a disaster. -

Government-And-Thiversities Tabfoie-Du-De the Pressures for Expansion, While Still Supplying Vital Skills Needed for Development? (Author/LBH)
DadOKENT --------- - ED 134 109 HE 008 590 AUTHOR Tapingkae, Amnuay, Ed. TITLE Higher Education and Economic Growth in Southeast Asia. INSTITUTION Regional Inst. of Higher Education and Development, Singapore. PUB D:STE 76 NOTE 96p.; For related studies, see HE 008 588-590 AVAILABLE FROM Regional Institute of Higher Education and Development, CSSDI Building, Henq Mui Keng Terrace, Singapore 5 ($6.00) EDRS PRICE MF-$0.83 Plus Postage. HC Not kvailable from EDRS. DESCRIPTORS Campus Planning; Costs; *Developing Nations; Educational Demand; *Educational Economics; *Educational Supply; *Foreign Countries; Government Role; Growth Patterns; *Higher Education; *Manpower Needs; School Expansion; Universities IDENTIFIERS *Asia (Southeast); Indonesia; Malaysia; Singapore; Thailand; Vietnam ABSTRACT This research project, which was originally mounted in five countries--Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam--is concerned with four key questions. They are:(1) What are the social and economic forces that contribute to the rapid expansion of universities in Thailand, Malaysia, Indonesia, and Singapore? (2) What are the monetary and nonmonetary costs and benefits of this expansion? (3) Is this expansion warranted by or necessary for economic growth? (4) If the expansion is-unwarranted, what steps can government-and-thiversities tabfoie-du-de the pressures for expansion, while still supplying vital skills needed for development? (Author/LBH) ********************************************************************* * Documents acquired by ERIC include many informal unpublished * materials not available from other sources. ERIC makes every effoit * * to obtain the best copy available. Nevertheless, items of marginal * * reproducibility are often encountered and this affects the quality * * of the microfiche and hardcopy reproductions ERIC makes available * * via the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). -

CONTENTS of Annual Report 2003 M Id Valley Megamall
CONTENTS Of Annual Report 2003 M id Valley Megamall Notice of Annual General Meeting 4 - 9 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 10 Corporate Information 14 - 15 Profile of the Board of Directors 18 -24 Statement of Directors’ Responsibilities 26 Report of the Audit Committee 28 - 32 Chairman’s Statement 34 - 35 Review of Operations 38 - 42 Statement on Corporate Governance 44 - 49 Statement of Internal Control 52 - 53 Analysis of Share/Warrant 1999/2004/ Irredeemable Convertible Preference Share 2002/2007 Holdings 56 - 60 List of Properties 62 - 65 Five-Year Group Financial Highlights 68 Reports and Financial Statements 72 - 141 Additional Compliance Information 144 - 148 Proxy Form 149 - 150 Annual Report 2003 1 This page intentionally left blank Annual Report 2003 2 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Annual Report 2003 3 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Fortieth Annual General Meeting of IGB Corporation Berhad will be held at Bintang Ballroom, Level 5, Cititel Mid Valley, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, on Monday, 31 May 2004 at 3.00 p.m. for the transaction of the following businesses: 1. To receive the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2003 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. Resolution 1 2. To sanction the declaration and payment of a final dividend of 3% less tax and 2% tax-exempt for the year ended 31 December 2003. Resolution 2 3. To re-elect Mr Tan Boon Seng who retires in accordance with Article 85 of the Articles of Association. -

Reflections of a Recycled Bureaucrat
10 Ethos, April 2004 Reflections of a Recycled Bureaucrat By JY Pillay could be acquired through joint-ventures with J Y Pillay addressed the EDB Society in MNCs. February this year. With almost 40 years of experience in the civil service, Mr Pillay, The Customer is King who once described himself as a ‘recycled bureaucrat’, spoke about how Singapore The situation today, of course, is quite different. is adapting to a new economic and In the intervening decades, we have moved up to social environment. He also distilled the sustained full employment, at least until recent management and leadership lessons from his times. Singapore is far wealthier. Civil servants are experience of working with former Minister better educated and trained, and have the most for Finance, Hon Sui Sen. What follows is an up-to-date tools to carry out their trade. But, edited excerpt of his remarks. likewise, the world has moved on, globalisation has extended its reach, Asian giants with enormous talent and potential are rising. We are better The New Environment equipped, but the terms of engagement are not necessarily mutating in our favour. Civil Service Then and Now Moreover, the electorate has also been globalised. I am occasionally asked to compare the They are no longer country bumpkins with straws environment for civil servants now with what it dangling from their mouths. They know their was forty-odd years ago. There is a perception that rights, or at least their interests, and are well- the labour, political, security and social turbulence equipped to engage in the cut-and-thrust of of the 1950s and early 1960s, combined with debate. -

1597 IGB Annualreport 2005-12-31 IGB
Contents Notice of Annual General Meeting 002 - 004 Statement of Internal Control 030 Statement accompanying Notice of Analysis of Shareholdings/Irredeemable Annual General Meeting 005 Convertible Preference Share 2002/2007 Holdings 031 - 033 Corporate Information 006 List of Properties 034 - 036 Profile of the Board of Directors 007 - 010 Five-Year Group Financial Highlights 037 Chairman’s Statement 011 - 012 Reports and Financial Statements 038 - 102 Review of Operations 013 - 016 Proxy Form Audit Committee Report 017 - 020 Statement on Corporate Governance 021 - 029 Notice of Annual General Meeting NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Forty-Second Annual General Meeting of IGB Corporation Berhad will be held at Bintang Ballroom, Level 5, Cititel Mid Valley, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur on Wednesday, 31 May 2006 at 3.00 p.m. for the transaction of the following businesses: AGENDA AS ORDINARY BUSINESS 1. To receive the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2005 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. Resolution 1 2. To sanction the declaration and payment of a final dividend of 2.5% less tax and 2.5% tax exempt for the financial year ended 31 December 2005. Resolution 2 3. To re-elect the following Directors who retire in accordance with Article 85 of the Company’s Articles of Association: (a) Tan Boon Seng Resolution 3 (b) Pauline Tan Suat Ming Resolution 4 (c) Datuk Abdul Habib bin Mansur Resolution 5 4. To re-elect Harun bin Hashim Mohd who retires in accordance with Article 89 of the Company’s Articles of Association.