Jahresbericht 2002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unterwegs Mit Bahn Und Bus
UNTERWEGS MIT BAHN UND BUS GUT INFORMIERT UND STRESSFREI VON A NACH B Schwerpunkt Ostregion AK Infoservice Wir wollen günstige Verbindungen für Pendlerinnen und Pendler sowie rasche und zuverlässige Informationen für Fahrgäste. Rudi Kaske AK Präsident wien.arbeiterkammer.at UNTERWEGS MIT BAHN UND BUS GUT INFORMIERT UND STRESSFREI VON A NACH B Sie sind mit öffentlichen Verkehrs- mitteln unterwegs? Dann sollte Ihre Fahrt möglichst frei von Stress und Ärger sein. Diese Broschüre hilft Ihnen dabei – mit vielen wichtigen Informa tionen und hilfreichen Tipps zu den Verkehrsunternehmen. WER SORGT FÜR GERECHTIGKEIT? FRAG UNS. Die AK App mit dem Lexikon des Arbeitsrechts, mit Banken rechner, Brutto-Netto-Rechner, Zeitspeicher, Urlaubsplaner, AK-Cartoons und mehr. Kostenlos erhältlich im App Store und Google play. apps.arbeiterkammer.at GERECHTIGKEIT MUSS SEIN Unterwegs mit Bus und Bahn Inhalt 1 | Unterwegs mit Bus und Bahn: Was ist wichtig? 4 2 | Wiener Linien unterwegs in Wien 8 3 | VOR – raus aus Wien 22 4 | Wiener Lokalbahnen – rund um Wien 36 5 | ÖBB – in alle Richtungen 44 6 | WESTbahn – in den Westen 56 7 | Wo finden Sie Park+Ride in der Ostregion? 61 8 | Wer bekommt das Pendlerpauschale? 64 9 | Welche Rechte haben Sie bei Verspätungen? 71 Anhang Wichtige Adressen und Servicekontakte 81 Stichwortverzeichnis 88 Abkürzungsverzeichnis 87 In dieser Broschüre finden Sie als Service auch sehr de- taillierte Informationen zu den Tarif- und Beförderungsbe- dingungen. Sämtliche Angaben beruhen auf Informationen der jewei ligen Verkehrsunternehmen im Herbst 2017 und sind ohne Gewähr. Auskunft über etwaige Preisänderungen erhalten Sie direkt bei den Verkehrsbetrieben, sämtliche Service- und Kontaktadressen finden Sie in den einzelnen Kapiteln sowie im Anhang. -

The Bulletin MTA OUTLINES PROPOSED 2021 BUDGET and Published by the Electric Railroaders’ FOUR-YEAR FINANCIAL PLAN Association, Inc
ERA BULLETIN — DECEMBER, 2020 The Bulletin Electric Railroaders’ Association, Incorporated Vol. 63, No. 12 December, 2020 The Bulletin MTA OUTLINES PROPOSED 2021 BUDGET AND Published by the Electric Railroaders’ FOUR-YEAR FINANCIAL PLAN Association, Inc. P. O. Box 3323 On November 18, the Metropolitan Trans- Agencies have already begun implementing Grand Central Station portation Authority (MTA) released its pro- these savings, which are now projected to New York, NY 10163 posed 2021 budget and four-year financial reduce expenses by $259 million in 2020, For general inquiries, plan amidst the worst financial crisis in agen- $601 million in 2021, $498 million in 2022, or Bulletin submissions, cy history. The plan includes devastating ser- $466 million in 2023 and $461 million in contact us at vice cuts, a drastic reduction in the agency’s 2024. https://erausa. org/ contact workforce and a continued pause on the his- In order to close the 2020 deficit caused by toric $51.5 billion Capital Plan in the absence federal inaction, the MTA will have to use its Editorial Staff: of $12 billion in federal aid. The MTA contin- authority to borrow the maximum of $2.9 bil- Jeff Erlitz ues to face an unprecedented financial crisis lion from the Federal Reserve’s Municipal Editor-in-Chief – eclipsing the Great Depression’s impact on Lending Facility (MLF) before the window Ron Yee transit revenue and ridership. closes at the end of 2020. The MTA is taking Tri-State News and The MTA presented a worst-case 2021 additional actions to address the 2020 deficit Commuter Rail Editor spending plan at its November Board meet- by releasing the current 2020 General Re- Alexander Ivanoff ing that assumes no additional federal emer- serve of $170 million, applying the $337 mil- North American and gency relief. -
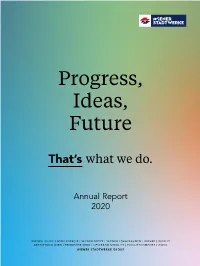
Annual Report 2020
Progress, Ideas, Future That’s what we do. Annual Report 2020 WIENER LINIEN | WIEN ENERGIE | WIENER NETZE | WIENER LOKALBAHNEN | WIPARK | WIEN IT BESTATTUNG WIEN | FRIEDHÖFE WIEN | UPSTREAM MOBILITY | FACILITYCOMFORT | GWSG WIENER STADTWERKE GROUP INVESTMENTS in our infrastructure 20 keep Vienna moving. 28 TOP EMPLOYER Helping to shape the future is fun. PROGRESS How we press ahead with important issues such as the energy transformation even in 12 times of crisis. CLIMATE PROTECTION These targets and projects 36 will make Vienna emission-free even faster. CONTENTS 4 WIENER STADTWERKE 6 LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD 10 GREETINGS FROM THE CITY THAT’S WHAT WE DO. 12 PROGRESS & ACHIEVEMENTS Helping you enjoy everyday life every day 20 INVESTMENTS Looking forward to the future in the world’s most liveable city 28 TOP EMPLOYER Providing answers through innovative ideas 36 CLIMATE PROTECTION Stopping poor air quality before it happens DATA AND FACTS FOR 2020 46 Business performance 52 Progress in sustainability 58 Looking to the future 62 CONTACT 62 IMPRINT That’s what we do. Industry is changing. Offices are shifting to people’s homes. And the topic of mobility is more important than ever. Even in times like these, we give citizens the security of knowing that they can fully rely on us. And we are keeping an eye on the future as well. After all, that’s what we do. WIENER STADTWERKE PERFORMANCE INDICATORS EUR m 2019 2020 Change in % Revenue 3,028.1 3,144.2 +3.8 Adjusted EBITDA* 569.5 615.6 +8.1 Adjusted profit for the year** 247.2 283.4 +14.6 Investments 1,094.5 1,757.4 +60.6 in property, plant and equipment and intangible assets 641.9 647.6 +0.9 in financial assets 452.6 1,109.8 +145.2 Capex ratio in % 21.2 20.6 -0.6 pp Total assets as at 31 Dec. -

2019 Annual Report with Figures That Everyone Can Understand
2019 Annual Report With figures that everyone can understand EUR 3,028m EUR 4,091m Revenue Property, plant and equipment EUR 1,095m EUR 299m Investment Profit for the year Our results at a glance Turn to page 12 for intuitive explanations. STATEMENT OF PROFIT OR LOSS EUR m 2019 2018 Revenue 3,028 2,754 Other income 553 512 Raw material, consumables and services used -1,332 -1,100 Personnel expenses -1,067 -1,037 Other expenses -702 -659 Net gains on investments accounted for using the equity method 64 64 Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) 544 535 Depreciation and amortisation -271 -255 Impairment losses and gains 76 24 Operating profit (EBIT) 349 303 Interest income 14 21 Other finance income 39 52 Interest expense -98 -114 Other finance costs -3 -48 Net finance costs -49 -90 Profit before tax 300 213 Income tax expense -1 -4 Profit for the year from continuing operations 299 208 Profit for the year 299 208 EUR 1,095m EUR 299m Investment Profit for the year from continuing operations EUR 1,067m Personnel expenses EUR 3,028m Revenue EUR 2,034m Raw material and consumables used, and other expenses Other sources: B1, B2 – see IFRS financial report; C1, C2 – see sustainability report CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION EUR m 31 Dec. 2019 31 Dec. 2018 1 Jan. 2018 ASSETS Property, plant and equipment 4,091 3,907 3,787 Intangible assets 158 145 142 Investments accounted for using the equity method 166 379 314 Non-current financial assets 3,500 2,626 2,373 Other non-current assets 415 240 201 Non-current -
Transnational Summary Report on Current
TRANSNATIONAL SUMMARY REPORT ON CURRENT MOBILITY AND TRANSPORT POLICY IN CE REGIONS Version 11 D.T1.1.1 Nov 2016 Title Transnational summary report on current mobility and transport policy in CE regions Deliverable D.T1.1.1 Authors Domokos Esztergár-Kiss, Tamás Mátrai, Tamás Tettamanti, Dénes Válóczi Contributors Elke Sumper, Peter Medved, Ján Roháč, Andrea Štulajterová, Barbara Cremonini, Guido Calvarese, Simona Sváčková, Petr Šmíd, Robert Sedlák, Martin Nawrath, Katja Karba, Mitja Kolbl, Miklós, Kózel, Botond Kővári, Péter Mándoki, Ferenc Mészáros, Zoltán Nagy, Tamás Soltész, Ádám Török, János Tóth Status Final Reviewed by DA Sinergija Submission 28.11.2016 Page 1 Contents 1. Executive summary ............................................................................. 5 2. Introduction ....................................................................................... 5 3. Synthesis of the regions report ............................................................... 6 4. Industrieviertel (Austria) ...................................................................... 7 4.1. Introduction to the region .......................................................................... 7 4.2. Description of the transport system .............................................................. 9 4.3. Governance structure and legal obligations ................................................... 11 4.4. Visions and goals .................................................................................... 12 5. Cityregion Bruck-Kapfenberg-Leoben -
„Region Südheide“ (Bezirke Mödling, Baden, Wien-Umgebung/Schwechat)
Erstellung eines ÖV-Konzeptes für die „Region Südheide“ (Bezirke Mödling, Baden, Wien-Umgebung/Schwechat) Auftraggeber: Grüne Niederösterreich, A-3100 St. Pölten Auftragnehmer/Bearbeiter: Dipl.-Ing. Herbert Seelmann Verkehrstechniker und -planer CZ - 613 00 Brno (Büro) Provazníkova 32 Tschechische Republik A - 1210 Wien Johann-Knoll-Gasse 12 Österreich Tel.: +420 - 721 559 287 E-Mail: [email protected] Perchtoldsdorf, Februar 2010 0 Inhaltsverzeichnis Ausgangslage......................................................................................................................... 2 Geschichte des Schienenverkehrs in der Region ........................................................ 3 Elektrische Lokalbahn Mödling – Hinterbrühl............................................................... 3 Straßenbahn in Baden mit Überlandstraßenbahnen Baden – Traiskirchen und Baden – Bad Vöslau ............................................................................................................. 3 Wiener Straßenbahnlinien 260/360 nach Perchtoldsdorf/Mödling........................... 4 Wiener Straßenbahnlinie 72 nach Schwechat............................................................... 4 Stadtstrecke der ehemaligen „Pressburgerbahn“ von Wien nach Schwechat.... 5 Laxenburger Bahn................................................................................................................. 5 Kaltenleutgebner-Bahn........................................................................................................ 5 Bestandsanalyse -

Wiener Lokalbahnen Gmbh, Barrierefreiheit Von Stationen Der Nebenfahrbahn
TO 25 StRH V - 2/19 Wiener Lokalbahnen GmbH, Barrierefreiheit von Stationen der Nebenbahn StRH V - 2/19 Seite 2 von 79 KURZFASSUNG Die Wiener Lokalbahnen GmbH bzw. die vormalige Aktiengesellschaft der Wiener Lo- kalbahnen erreichte durch ein ambitioniertes Modernisierungsprogramm bei zahlreichen Stationen der Nebenbahn eine deutliche Verbesserung ihrer Benutzbarkeit für Perso- nen mit Behinderungen bzw. mit eingeschränkter Mobilität. Das Modernisierungspro- gramm startete im Jahr 2010 und diente unter anderem der Umsetzung des Etappen- planes Verkehr aus dem Jahr 2006 zur Beseitigung von Barrieren innerhalb der im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz vorgesehenen zehnjährigen Frist. Da das Modernisierungsprogramm für die 19 Stationen der Nebenbahn noch nicht ab- geschlossen war, wiesen einige Stationen noch Barrieren für Rollstuhlfahrende und sehbehinderte bzw. blinde Personen auf. Der Stadtrechnungshof Wien empfahl technische Verbesserungen für Personen mit Behinderungen bzw. mit eingeschränkter Mobilität. Diese betrafen unter anderem schienengleiche Bahnsteigzugänge, taktile Bodenleitsysteme, Handläufe, Wartegele- genheiten, Fahrgastinformationssysteme und Fahrscheinautomaten. Auf eine noch be- stehende Diskriminierung von Rollstuhlfahrenden durch die Beförderungsbedingungen wurde hingewiesen. Die vorliegende Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien soll zur Aufrechterhaltung bzw. zum Erreichen der Barrierefreiheit von Stationen der Nebenbahn beitragen. StRH V - 2/19 Seite 3 von 79 Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Stationen der -

Fahrplan 2021 Fahrplanvorschau Bahn- Und Busverbesserungen
Fahrplan 2021 Fahrplanvorschau Bahn- und Busverbesserungen Stand November 2020 Alle Angaben ohne Gewähr! Inhalt 1. Wesentliche Neuerungen im Angebot 2. Änderungen im Detail 1. Westachse und Franz-Josefs-Bahn 2. Südachse 3. Ostachse und Nordburgenland 4. S-Bahn Wien und Nordäste 3. Änderungen im Regionalbussystem des VOR 4 Wesentliche Neuerungen im Angebot Fahrplan 2021 gültig ab 13. Dezember 2020 Alle Angaben ohne Gewähr! weitere Taktlückenschlüsse und Laaer Ostbahn Änderungen Fahrplan 2021: Überblick Angebotsausweitungen im gesamten Netz täglicher Stundentakt • zusätzliche Abend-/Frühzüge auf diversen Strecken bis Laa/Thaya 4 Züge pro Stunde bis • zusätzliche HVZ-Verstärker u.a. auf Regionalbahnen St. Andrä-Wördern Weiterführung der S40-Verstärker Wien FJBf. – Kritzendorf als R40 bis St. Andrä-Wördern Nordbahn Stundentakt Mo – Fr bis Bernhardsthal bzw. Břeclav Tullnerfeldbahn: S40-Stundentakt auch am Wochenende St. Pölten – Traismauer – Tullnerfeld (weiter nach Wien FJBf.) Elektrifizierung Marchfeldbahn: Gänserndorf – Marchegg Weiterführung der S1 aus Wien von Gänserndorf nach Marchegg, täglicher Abendzüge auf der Rudolfsbahn Stundentakt Ausweitung des Stundentakts Amstetten – Waidhofen/Ybbs bis 0:11 ab Amstetten Badner Bahn Wien Oper – Wiener Neudorf durchgehender 7,5-Minuten-Takt Neusiedler Seebahn Citybahn Waidhofen: Wien – Neusiedl/See - Pamhagen • Halbstundentakt (statt Stundentakt) • täglicher und durchgängiger • neuer Endpunkt Waidhofen Stundentakt Pestalozzistraße (Streckenkürzung) • Betriebszeitausweitung Innere Aspangbahn: Wien -

ISMST 2021 Preliminary Program.Pdf
Fotos: © tomas1111 | Lipskiy Pavel | 3dgenerator | 123RF.de rd World Congress of the International Society for Medical Shockwave Treatment 23 November 04 – 05, 2021 | Hotel Savoyen Vienna | Austria Preliminary Program General Information ➜ ORGANIZER Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA) Head Office Office for International Relations and Convention Management Vienna Twin Towers Wienerbergstrasse 11 1100 Vienna | Austria ➜ SCIENTIFIC ORGANIZATION Wolfgang Schaden, AUVA President of the ISMST Rainer Mittermayr, AUVA Scientific Congress Secretary ➜ INFORMATION AND ORGANIZATION Nikolaus Schaden-Kajoui Phone: +43 5 93 93-20192 [email protected] ➜ REGISTRATION AND PAYMENT Jennifer Konecky Phone: +43 5 93 93-20193 [email protected] ➜ CONGRESS LANGUAGE The official congress language is English. ➜ CONGRESS WEBSITE https://www.shockwavetherapy.org ➜ CONFERENCE VENUE Hotel Savoyen Vienna Rennweg 16 1030 Vienna | Austria Phone: +43 1 206 33-9109 [email protected] ➜ APPROBATION For the event, Austrian DFP credits will be requested at the Austrian Medical Chamber. These credits are convertible for the respective country. ➜ ICC REGISTRATION AND PAYMENT ISMST Office Catherine Auersperg Phone: +43 650 233 20 59 [email protected] Content Welcome Letter of the President of the ISMST ......................................................................2 Main Topics ..................................................................................................................................4 Scientific Committee ...................................................................................................................4 -

Die Badner Bahn Mein Wegbegleiter Zwischen Wien & Baden Wien Baden
Die Badner Bahn Mein Wegbegleiter zwischen Wien & Baden Wien Baden WIEN OPER Die Badner Bahn Von der Wiener City ins historische und ihre Strecke Zentrum nach Baden. Seit über 130 Jahren verbindet die meistgenutzte Regionalbahn Öster- reichs die Stadtzentren von Wien und Baden. Die 27 Kilometer lange Strecke der Badner Bahn erschließt als eine der wichtigsten Pendler- Innenverbindungen den Südraum von Wien. Von der Wiener Staatsoper geht es über die Gemeinden Vösen- dorf, Wiener Neudorf, Guntramsdorf, Traiskirchen in die Kurstadt Baden. Die Badner Bahn verbindet in gut einer Stunde Fahrzeit Stadt und Land, Heurigen- und Cafehauskultur, Sommerfrische und Cityflair und noch viel mehr. Für rund 40.000 Fahrgäste pro Tag ist die Badner Bahn Wegbegleiterin am Arbeits- weg, am Weg in die Schule, bei der Shoppingtour in Europas größtes Einkaufszentrum oder für Kultur, Freizeit und Ausflüge ins Grüne. KERNZONENGRENZE DIREKT ZUR U6 SHOPPING CITY SÜD SPORT & FREIZEIT Entspannt Pendeln mit Direkte Anbindung Fußball, Tennis, U-Bahn-Anbindung zu Europas größtem Schwimmen, ohne Parkplatzsuche. Einkaufszentrum. Wandern und mehr. Angebotsausbau 7,5 Minuten-Takt von Montag bis Samstag — Seit Dezember 2020 ist die Badner Bahn von Montag bis Samstag durchgängig im dich- teren 7,5-Minuten-Takt von Wien Oper bis Wiener Neudorf unterwegs. Für die Fahrgäste heißt das: kürzere Wartezeiten, schnelleres Vorankommen und mehr Komfort. Schritt- weise soll der dichtere Takt in den nächsten Jahren bis Baden ausgeweitet werden. 1.620kg CO2 Ersparnis Klimaschutz Bahnfahren schont Umwelt & Klima! — Eine einzige PendlerIn auf der Strecke von Baden nach Wien spart mit der Badner Bahn gegenüber dem Auto durchschnittlich 1.620 kg CO2-Ausstoß oder umgerechnet rund 600 Liter Diesel pro Jahr ein.