Zeitschrift-Saeugetierkunde 41 0237-0249.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
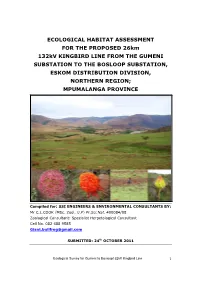
ECOLOGICAL HABITAT ASSESSMENT for the PROPOSED 26Km 132Kv KINGBIRD LINE from the GUMENI SUBSTATION to the BOSLOOP SUBSTATIO
ECOLOGICAL HABITAT ASSESSMENT FOR THE PROPOSED 26km 132kV KINGBIRD LINE FROM THE GUMENI SUBSTATION TO THE BOSLOOP SUBSTATION, ESKOM DISTRIBUTION DIVISION, NORTHERN REGION; MPUMALANGA PROVINCE Compiled for: SSI ENGINEERS & ENVIRONMENTAL CONSULTANTS BY: Mr C.L.COOK (MSc. Zool. U.P) Pr.Sci.Nat. 400084/08 Zoological Consultant: Specialist Herpetological Consultant Cell No. 082 688 9585 [email protected] SUBMITTED: 24th OCTOBER 2011 Ecological Survey for Gumeni to Bosloop132kV Kingbird Line 1 1. BACKGROUND INFORMATION Eskom Transmission is responsible for providing a high quality supply of electricity to meet the ever increasing needs of its end users. As a result, its infrastructure of power lines and substations are continuingly being established and expanded upon to support annual load growth. Eskom is planning to build a new 132kV Kingbird distribution line from the recently constructed Gumeni Substation to the south of Machadadorp to the existing Bosloop Substation. The study area is located in the Northern Mpumalanga Lowveld region. The powerline being considered for the project falls within rural areas, largely characterised by intensive commercial agricultural and pastoral land uses. The area is situated close to the small mining town of Machadadorp approximately 17km to the north, with Nelspruit situated approximately 75km to the northwest. There are two main roads that allow general access to the study area and these are R541 and the R36. The need for ESKOM’s proposed development has been identified by the low voltage service experienced in the 132kV ring supplied from Witkloof substation due to the loss of either the Witkloof-Holnek 132kV line or Witkloof-Wintershoek 132kV line voltages during the transmission and distribution. -

Diet and Microhabitat Use of the Woodland Dormouse Graphiurus Murinus at the Great Fish River Reserve, Eastern Cape, South Africa
Diet and microhabitat use of the woodland dormouse Graphiurus murinus at the Great Fish River Reserve, Eastern Cape, South Africa by Siviwe Lamani A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) in the Faculty of Science and Agriculture at the University of Fort Hare 2014 Supervisor: Ms Zimkitha Madikiza Co-supervisor: Prof. Emmanuel Do Linh San DECLARATION I Siviwe Lamani , student number 200604535 hereby declare that this dissertation titled “Diet and microhabitat use of the woodland dormouse Graphiurus murinus at the Great Fish River Reserve , Eastern Cape, South Africa” submitted for the award of the Master of Science degree in Zoology at the University of Fort Hare, is my own work that has never been submitted for any other degree at this university or any other university. Signature: I Siviwe Lamani , student number 200604535 hereby declare that I am fully aware of the University of Fort Hare policy on plagiarism and I have taken every precaution on complying with the regulations. Signature: I Siviwe Lamani , student number 200604535 hereby declare that I am fully aware of the University of Fort Hare policy on research ethics and have taken every precaution to comply with the regulations. The data presented in this dissertation were obtained in the framework of another project that was approved by the University Ethics committee on 31 May 2013 and is covered by the ethical clearance certificate # SAN05 1SGB02. Signature: ii SUPERVISOR’S FOREWORD The format of this Master’s dissertation (abstract, general introduction and two independent papers) has been chosen with two purposes in mind: first, to train the MSc candidate to the writing of scientific papers, and second, to secure and allow for a quicker dissemination of the scientific knowledge. -

Graphiurus Platyops – Rock Dormouse
Graphiurus platyops – Rock Dormouse Assessment Rationale Listed as Least Concern as the species is widespread, and, although no field surveys have been conducted recently in most areas of its range, it is thought to be fairly common in suitable habitat (especially in the northern Photograph parts of its range). Recently (2007 and 2014), it has been recorded from Tswalu Kalahari Reserve in the Northern wanted Cape Province, significantly extending its known range westwards. There are not suspected to be any major threats as the species occupies inaccessible habitats not prone to transformation and there seems to be no reason to believe that the population is declining. More work is necessary to discern its distribution from other Graphiurus spp. and to vet museum specimens pertaining to both this species and Graphiurus rupicola. Regional Red List status (2016) Least Concern Regional population effects: Possible immigration from National Red List status (2004) Data Deficient areas where habitat is continuous into South Africa from Reasons for change Non-genuine change: Zimbabwe and Botswana, but the Swaziland New information subpopulation is isolated. Global Red List status (2016) Least Concern TOPS listing (NEMBA) (2007) None Distribution This species is patchily distributed in the northeastern CITES listing None savannahs of southern Africa (Monadjem et al. 2015), and Endemic No has been recorded from Zambia, southern Malawi, much of Zimbabwe, central Mozambique, eastern Botswana, This species of dormouse is, to a greater extent, northeastern South Africa and the highveld of Swaziland. It associated with rocky habitat when compared was previously thought to occur in central Botswana (de with the other species within this group. -

The Dormice (Myoxidae) of Southern Africa
Hystrix, (n.s.)6 (1 -2) (1994): 287 - 293 (I 995) Proc. I1 Conf. on Dormice THE DORMICE (MYOXIDAE) OF SOUTHERN AFRICA PETERI. WEBB & JOHN D. SKINNER Mammal Research Institute, University of Pretoria, Preforia OU02, South Africa. ABSTRACT - Very little is known about the dormice of Africa south of the Sahara, even their current classification is suspect. This paper summarises the information available in the literature on the four (probable) species of dormouse found in southern Africa. Mean body masses are approximately >55 g, 50 g, 27 g and <27 g in Graphiurus ocularis, G. platyops, G. murinus, and G. pawus respectively. All four species are silver-grey dorsally and buffy-white ventrally with varying degress of black around the eyes. G. ocularis and G. platyops prefer rocky hillsides and koppies while G. niurinus and G. parvus are primarily arboreal. Breeding in southern Africa is probably limited to the warm, wet summer months with a normal litter size of three or four and one or two litters per year. At least in G. ocularis breeding pairs appear to be territorial. Torpor can be induced in individuals in captivity but the use and extent of hibernation in the wild depends on local climatic conditions. G. oculuris seems to be purely carnivorous while the other three species are omnivores. Key words: Myoxidae, Dormice, Graphiurus, southern Africa. RIASSUNTO - I Mioxidi del Sud @ica - Molto poco e conosciuto sui mioxidi dell'Africa a sud del Sahara, persino la loro classificazione attuale e dubbia. Nel presente lavoro vengono riassunte le informazioni disponibili in letteratura sulle quattro (probabili) specie di mioxidi del Sud Africa. -

Project Name
SYRAH RESOURCES GRAPHITE PROJECT, CABO DELGADO, MOZAMBIQUE TERRESTRIAL FAUNAL IMPACT ASSESSMENT Prepared by: Prepared for: Syrah Resources Limited Coastal and Environmental Services Mozambique, Limitada 356 Collins Street Rua da Frente de Libertação de Melbourne Moçambique, Nº 324 3000 Maputo- Moçambique Australia Tel: (+258) 21 243500 • Fax: (+258) 21 243550 Website: www.cesnet.co.za December 2013 Syrah Final Faunal Impact Assessment – December 2013 AUTHOR Bill Branch, Terrestrial Vertebrate Faunal Consultant Bill Branch obtained B.Sc. and Ph.D. degrees at Southampton University, UK. He was employed for 31 years as the herpetologist at the Port Elizabeth Museum, and now retired holds the honorary post of Curator Emeritus. He has published over 260 scientific articles, as well as numerous popular articles and books. The latter include the Red Data Book for endangered South African reptiles and amphibians (1988), and co-editing its most recent upgrade – the Atlas and Red Data Book of the Reptiles of South Africa, Lesotho and Swaziland (2013). He has also published guides to the reptiles of both Southern and Eastern Africa. He has chaired the IUCN SSC African Reptile Group. He has served as an Honorary Research Professor at the University of Witwatersrand (Johannesburg), and has recently been appointed as a Research Associate at the Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth. His research concentrates on the taxonomy, biogeography and conservation of African reptiles, and he has described over 30 new species and many other higher taxa. He has extensive field work experience, having worked in over 16 African countries, including Gabon, Ivory Coast, DRC, Zambia, Mozambique, Malawi, Madagascar, Namibia, Angola and Tanzania. -

Conservation Assessment of South African Mammals Appendices 1, 2 & 3
University of Pretoria etd – Keith, M (2005) Conservation assessment of South African mammals Appendices 1, 2 & 3 APPENDIX 1: Regional IUCN Red List assessments for South African terrestrial and marine mammals: An overview Regional Red Data Book (RRDB; Smithers 1986; Mugo et al. 1995), Friedmann & Daly (2004) regional Red List (RRL) and global IUCN Red List (GRL) assessments for all extant 295 marine and terrestrial taxa. RDB categories were as follows: Endangered (E), Vulnerable (V) Rare (R), Out of Danger (O) and Indeterminate (I). Regional and global IUCN RL categories ranged between that of IUCN RL version 2.4 and 3.1. The following abbreviations are used within the Appendix: Critically Endangered (CR); Endangered (EN); and Vulnerable (VU), Near Threatened (NT) (also including Lower Risk/near threatened (LR/nt)), Data Deficient (DD), Lower Risk/conservation dependant (CD) and, Least Concern (LC) (also including the old Lower Risk/least concern (LR/lc) category) and Not Evaluated (NE). Order Taxon name Common Name RRDB 1986 GRL 2003 RRL 2004 Artiodactyla Aepyceros melampus Impala Not Listed LR/cd LC Artiodactyla Alcelaphus buselaphus Red hartebeest Not Listed LR/cd LC Artiodactyla Antidorcas marsupialis Springbok Not Listed LR/cd LC Artiodactyla Cephalophus natalensis Red duiker R LR/cd LC Artiodactyla Connochaetes gnou Black wildebeest Not Listed LR/cd LC Artiodactyla C. taurinus taurinus Blue wildebeest Not Listed LR/cd LC Artiodactyla Damaliscus lunatus lunatus Tsessebe R LR/cd EN A2ac, C2a(i) Artiodactyla D. pygargus phillipsi Blesbok Not Listed LR/cd LC Artiodactyla D. pygargus pygargus Bontebok R VU D2 VU D1 Artiodactyla Giraffa camelopardalis Giraffe Not Listed LR/cd LC Artiodactyla Hippopotamus amphibius Hippopotamus R LR/lc LC Artiodactyla Hippotragus equinus Roan antelope E LR/cd VU D1 Artiodactyla H. -

Mammals, Birds, Reptiles, Fish, Insects, Aquatic Invertebrates and Ecosystems
AWF FOUR CORNERS TBNRM PROJECT : REVIEWS OF EXISTING BIODIVERSITY INFORMATION i Published for The African Wildlife Foundation's FOUR CORNERS TBNRM PROJECT by THE ZAMBEZI SOCIETY and THE BIODIVERSITY FOUNDATION FOR AFRICA 2004 PARTNERS IN BIODIVERSITY The Zambezi Society The Biodiversity Foundation for Africa P O Box HG774 P O Box FM730 Highlands Famona Harare Bulawayo Zimbabwe Zimbabwe Tel: +263 4 747002-5 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Website: www.biodiversityfoundation.org Website : www.zamsoc.org The Zambezi Society and The Biodiversity Foundation for Africa are working as partners within the African Wildlife Foundation's Four Corners TBNRM project. The Biodiversity Foundation for Africa is responsible for acquiring technical information on the biodiversity of the project area. The Zambezi Society will be interpreting this information into user-friendly formats for stakeholders in the Four Corners area, and then disseminating it to these stakeholders. THE BIODIVERSITY FOUNDATION FOR AFRICA (BFA is a non-profit making Trust, formed in Bulawayo in 1992 by a group of concerned scientists and environmentalists. Individual BFA members have expertise in biological groups including plants, vegetation, mammals, birds, reptiles, fish, insects, aquatic invertebrates and ecosystems. The major objective of the BFA is to undertake biological research into the biodiversity of sub-Saharan Africa, and to make the resulting information more accessible. Towards this end it provides technical, ecological and biosystematic expertise. THE ZAMBEZI SOCIETY was established in 1982. Its goals include the conservation of biological diversity and wilderness in the Zambezi Basin through the application of sustainable, scientifically sound natural resource management strategies. -

Eomyidae and Gliridae from Rudabánya
Palaeontographia Italica 90 2003 149-161 tavv. Pisa, 2005 Eomyidae and Gliridae from Rudabánya GUDRUN DAXNER-HÖCK* KEY WORDS — Rodents, Late Miocene, MN9, Hungary ABSTRACT — Six glirid species are described from the Late Miocene of Rudabánya: Glirulus lissiensis Hugueney & Mein 1965, Paraglirulus werenfelsi Engesser 1972, Muscardinus hispanicus De Bruijn 1966, Muscardinus cf. vallesiensis (Hartenberger 1966), Glis minor Kowalski 1963 and Myoglis cf. ucrainicus Nesin & Kowalski 1997. Although descending from Early Miocene glirid lineages, three out of six species are restricted to the Late Miocene. The eomyid from Rudabánya, Eomyops catalaunicus, is known to range from MN9 to MN10. This glirid-eomyid association is characteristic for a Vallesian age (MN9). The Rudabánya glirids most probably lived in arboreal thickets and forests, feeding on fruits, seeds, berries and insects as their living relatives do. RIASSUNTO — Vengono descritte sei specie di gliridi dalla località del Miocene superiore (MN9) di Rudabánya (Ungheria): Glirulus lis- siensis Hugueney & Mein 1965, Paraglirulus werenfelsi Engesser 1972, Muscardinus hispanicus De Bruijn 1966, Muscardinus cf. valle- siensis (Hartenberger 1966), Glis minor Kowalski 1963 and Myoglis cf. ucrainicus Nesin & Kowalski 1997. Sebbene rappresentanti di linee evolutive che risalgono al Miocene Inferiore, tre delle sei specie presenti a Rudabánya sono limitate al Miocene superiore. Un unico eomyide è presente a Rudabánya, Eomyops catalaunicus. Questa forma è nota per avere una distribuzione che abbraccia le zone MN9 e MN10. L’associazione gliridi-eomyidi di Rudabánya è indicativa di una età Vallesiana (MN9). I gliridi di Rudabánya molto probabilmente vivevano in boschi e foreste, cibandosi di frutta, semi ed insetti, come fanno i loro corrispondenti viventi. -

Rodentia, Mammalia) from Hayranlı, Anatolia: Implications for Paleoecology and Paleobiodiversity
Palaeontologia Electronica palaeo-electronica.org Systematics and dental microwear of the late Miocene Gliridae (Rodentia, Mammalia) from Hayranlı, Anatolia: implications for paleoecology and paleobiodiversity Ferhat Kaya and Nuretdin Kaymakçı ABSTRACT New finds of Gliridae (Mammalia, Rodentia) from the late Miocene of Hayranlı, located in central eastern Anatolia, are described. These specimens include Micrody- romys koenigswaldi De Bruijn, 1966, and Myomimus maritsensis De Bruijn et al., 1970. The morphological overlap between Myomimus and Peridyromys makes it difficult to distinguish between the two genera. The last appearance of Microdyromys was previ- ously recorded in Ampudia 3 (MN 10, Duero Basin, Spain), but the Hayranlı collection from the middle Turolian extends its spatiotemporal occurence. Dental microwear anal- ysis indicates that these species of dormice had a diet that involved a combination of insects, fruit, seeds, and grasses, which could point to the development of a more gen- eralist behavior adapted to the seasonal availability of foods. Environmental changes, occurring from the middle Miocene to the late Miocene in Europe and the Eastern Med- iterranean, caused a drastic decrease in the number of species of Gliridae adapted to an arboreal lifestyle and a warm and humid climate. There is a significant faunal exchange from forest dwellers to ground dwelling species, which is characterized by the increase in Myomimus finds from a number of localities during the late Miocene − probably attributable to the vegetational shift from predominating forested wetland environments to open woodland and steppe-like environments. Considering the large herbivore-omnivore mammal collection of Hayranlı the mean hypsodonty value (=1.6) depicts a relatively humid woodland and shrubby paleoenvironment. -

Bonner Zoologische Beiträge Band 51 (2002) Heft 4 Seiten 229-254 Bonn, Dezember 2003
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at Bonner zoologische Beiträge Band 51 (2002) Heft 4 Seiten 229-254 Bonn, Dezember 2003 Annotated Checklist of the Mammals of the Republic of Macedonia Boris Krystufek" & Svetozar Petkovski"' "Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia -'Macedonian Museum of Natural History, Skopje, Republic of Macedoni Abstract. Eighty-two mammals in 51 genera, 18 families and 6 orders occur in the Republic of Macedonia. Eight species were introduced, either deliberately or accidentally by humans, and the red deer, Cervus elaphus, has been reintroduced. The number of recent human induced extinctions is low, and includes, besides the red deer, also the golden jackal, Canis aureus. Any domesticated mammal has established permanent feral populations. Among the 25 taxa originally named and descri- bed from the Republic of Macedonia, three are currently considered to be valid species: Talpa stankovici, Microtus felteni, and Mus macedonicus. All new names, proposed for Macedonian mammals are listed and type localities are shown on a map. Distribution of 20 species is spot mapped. Key words. Mammalia, status, biogeography, distribution, bibliography INTRODUCTION regions and the lowlands. The first two are delimited by the River Vardar. Western Macedonia is a part of 1.1. General the Sara-Pindus mountain massifs (highest peak 2748 The Republic of Macedonia, one of the top European m), while Eastern Macedonia contains portions of the hot spots of biodiversity (Gaston & Rhian 1994), has Rhodope mountains (highest peak 2252 m). The attracted considerable attention of naturalists in this bedrock is mostly sediments of the Lower Palaeozoic, century. -
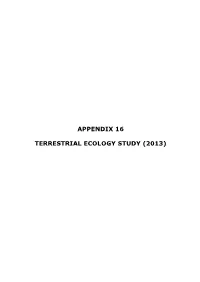
Appendix 16 Terrestrial Ecology Study
APPENDIX 16 TERRESTRIAL ECOLOGY STUDY (2013) FLORA AND FAUNA BASELINE ASSESSMENT FOR A FEASIBILITY STUDY FOR THE PROPOSED VENTERSBURG MINE GOLD ONE AFRICA LIMITED JUNE 2013 _________________________________________________ Digby Wells and Associates (South Africa) (Pty) Ltd (Subsidiary of Digby Wells & Associates (Pty) Ltd). Co. Reg. No. 2010/008577/07. Fern Isle, Section 10, 359 Pretoria Ave Randburg Private Bag X10046, Randburg, 2125, South Africa Tel: +27 11 789 9495, Fax: +27 11 789 9498, [email protected], www.digbywells.com ________________________________________________ Directors: A Sing*, AR Wilke, LF Koeslag, PD Tanner (British)*, AJ Reynolds (Chairman) (British)*, J Leaver*, GE Trusler (C.E.O) *Non-Executive _________________________________________________ p:\projects\gold_one\gol1675_ventersburg_esia\9_specialist_studies\f_and_f\report\gol1675_flora_and_fauna_report_2013-06-11_rg_la2.docx FLORA AND FAUNA BASELINE ASSESSMENT FOR A FEASIBILITY STUDY FOR THE PROPOSED VENTERSBURG MINE GOL1675 This document has been prepared by Digby Wells Environmental. Report Title: FLORA AND FAUNA BASELINE ASSESSMENT FOR A FEASIBILITY STUDY FOR THE PROPOSED VENTERSBURG MINE Project Number: GOL1675 Name Responsibility Signature Date Rudi Greffrath Report Writer 3/2/2013 Leigh-Ann de Wet, Review 31/5/2013 Pri.Sci.Nat. (400233/12) Andrew Husted, Pri. Sci. 1st Review 4/2/2013 Nat. (400213/11). Danie Otto, Natural 2nd Review 3/5/2013 Scientist S.A (400096/02). This report is provided solely for the purposes set out in it and may not, in whole -

Mammal Species of the World Literature Cited
Mammal Species of the World A Taxonomic and Geographic Reference Third Edition The citation for this work is: Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University Press, 2,142 pp. (Available from Johns Hopkins University Press, 1-800-537-5487 or (410) 516-6900 http://www.press.jhu.edu). Literature Cited Abad, P. L. 1987. Biologia y ecologia del liron careto (Eliomys quercinus) en Leon. Ecologia, 1:153- 159. Abe, H. 1967. Classification and biology of Japanese Insectivora (Mammalia). I. Studies on variation and classification. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 55:191-265, 2 pls. Abe, H. 1971. Small mammals of central Nepal. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 56:367-423. Abe, H. 1973a. Growth and development in two forms of Clethrionomys. II. Tooth characters, with special reference to phylogenetic relationships. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 57:229-254. Abe, H. 1973b. Growth and development in two forms of Clethrionomys. III. Cranial characters, with special reference to phylogenetic relationships. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 57:255-274. Abe, H. 1977. Variation and taxonomy of some small mammals from central Nepal. Journal of the Mammalogical Society of Japan, 7(2):63-73. Abe, H. 1982. Age and seasonal variations of molar patterns in a red-backed vole population. Journal of the Mammalogical Society of Japan, 9:9-13. Abe, H. 1983. Variation and taxonomy of Niviventer fulvescens and notes on Niviventer group of rats in Thailand.