(Ernst Werner) Hans Zocher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Homenagem a August Karl Gustav Bier Por Ocasião Dos 100 Anos Da
Rev Bras Anestesiol ARTIGO DIVERSO 2008; 58: 4: 409-424 MISCELLANEOUS Homenagem a August Karl Gustav Bier por Ocasião dos 100 Anos da Anestesia Regional Intravenosa e dos 110 Anos da Raquianestesia* Eulogy to August Karl Gustav Bier on the 100th Anniversary of Intravenous Regional Block and the 110th Anniversary of the Spinal Block Almiro dos Reis Jr, TSA1 RESUMO Unitermos: ANESTESIA, Regional: subaracnóidea, venosa; Reis Jr. A — Homenagem a August Karl Gustav Bier por Ocasião dos ANESTESIOLOGIA: história. 100 Anos da Anestesia Regional Intravenosa e dos 110 Anos da Raquianestesia SUMMARY JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: August Karl Gustav Bier foi o in- Reis Jr A — Eulogy to August Karl Gustav Bier on the 100th Anni- trodutor de duas importantes técnicas de anestesia regional: a versary of Intravenous Regional Block and the 110th Anniversary of anestesia regional intravenosa e a anestesia subaracnóidea, Spinal Block. ambas até hoje amplamente empregadas. Completando neste ano de 2008 a primeira delas 100 anos e a segunda 110 anos de exis- BACKGROUND AND OBJECTIVES: August Karl Gustav Bier in- tência, seria mais do que justo prestarmos uma homenagem ao no- troduced two important techniques in regional block: intravenous tável médico que as criou. regional block and subarachnoid block, widely used nowadays. Since the first one celebrates its 100th anniversary and the second CONTEÚDO: O texto relata os dados familiares, estudantis inici- its 110th anniversary, it is only fair that we pay homage to this ex- ais, do curso acadêmico e da residência médica, as atividades pro- traordinary physician who created them. fissionais e universitárias, a personalidade, a aposentadoria e o falecimento de A. -

James, Steinhauser, Hoffmann, Friedrich One Hundred Years at The
James, Steinhauser, Hoffmann, Friedrich One Hundred Years at the Intersection of Chemistry and Physics Published under the auspices of the Board of Directors of the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society: Hans-Joachim Freund Gerard Meijer Matthias Scheffler Robert Schlögl Martin Wolf Jeremiah James · Thomas Steinhauser · Dieter Hoffmann · Bretislav Friedrich One Hundred Years at the Intersection of Chemistry and Physics The Fritz Haber Institute of the Max Planck Society 1911–2011 De Gruyter An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org Aut ho rs: Dr. Jeremiah James Prof. Dr. Dieter Hoffmann Fritz Haber Institute of the Max Planck Institute for the Max Planck Society History of Science Faradayweg 4–6 Boltzmannstr. 22 14195 Berlin 14195 Berlin [email protected] [email protected] Dr. Thomas Steinhauser Prof. Dr. Bretislav Friedrich Fritz Haber Institute of the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society Max Planck Society Faradayweg 4–6 Faradayweg 4–6 14195 Berlin 14195 Berlin [email protected] [email protected] Cover images: Front cover: Kaiser Wilhelm Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry, 1913. From left to right, “factory” building, main building, director’s villa, known today as Haber Villa. Back cover: Campus of the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, 2011. The Institute’s his- toric buildings, contiguous with the “Röntgenbau” on their right, house the Departments of Physical Chemistry and Molecular Physics. -
Das Leben Des Feinmechanikermeisters Hermann
Michael Lütge Feinmechanikermeister Hermann Lütge (1886-1970) Diener von Fritz Haber am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie 1913-1933 mit einem prozessualen Psychogramm der zerrüttenden Ehe Habers mit der Pazifistin Clara Immerwahr Verlag Lebensreise 2021 1 Vorbemerkungen Aus den spärlichen Angaben seiner Lebensläufe habe ich mit einiger Recherche eine Biographie meines Großvaters rekonstruiert. Darauf folgen seine eigenen Texte über seine Kindheit und Jugend und die Berichte aus dem KWIpCh. Sie liegen im Sütterlin-Original in meinem Keller bzw. im Archiv der MPG. Daß sie und die dazugehörigen Fotos Eingang in eine Handwerkerbiografie gefunden ha- ben, entspricht dem Selbstverständnis des Protagonisten. Daß Hermann Lütge öffentliche Erwähnung findet, resultiert aus dem Ammoniak- Apparat im Deutschen Museum und Lütges Kronzeugenschaft im Freitod Clara Immerwahrs, der Gattin von Fritz Haber. Sie war Patentante meines Vaters. Da Lütge gern benutzt wird, um das Motiv ihres Suizids von Verzweiflung über Ha- bers Giftgaskrieg zu einem Eifersuchtsdrama zu stipulieren, habe ich diese Frage im Schlußteil einer psycho-kriminalistischen Anamnese unterzogen. Sie bindet die später vom Naziterror gebrochene Karriere eines kleinen Handwerksmeisters in den Weltkriegskontext ein und thematisiert damit die Frage der Verantwortung des Wissenschaftlers für die Zerstörung der Welt. Meiner Freundin Petra Schröder danke ich für ihr vehementes Debattieren über jede Frage, die da entsteht, wo bei magerer Quellenlage Interpretationen -

Cerebrospinal Fluid: History, Collection Techniques, Indications
REVIEW ARTICLE J Bras Patol Med Lab. 2020; 56: 1-11. Cerebrospinal fluid: history, collection techniques, indications, contraindications and complications Líquido cefalorraquidiano: história, técnicas de coleta, indicações, contraindicações e complicações 10.5935/1676-2444.20200054 João Paulo S. Oliveira; Natalia T. Mendes; Álvaro R. Martins; Wilson Luiz Sanvito Hospital Santa Casa de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brazil. ABSTRACT This article is based on a historical review of the medical literature with the purpose of acknowledging the historical stages and anatomical findings over the years, which led gradually to performance of the first lumbar puncture by Quincke, as well as collection techniques and analyses, allowing it to be an irreplaceable diagnostic tool in daily clinical practice. Cerebrospinal fluid analyses have continued to develop and nowadays play a major role in diagnosing and understanding the physiopathology of a great variety of neurological conditions. Biomarkers and genetic sequencing have recently been the target of multiple studies and are implicated as promising diagnostic tools of a large range of diseases. Key words: cerebrospinal fluid; history; spinal puncture. RESUMO Este artigo se baseia em uma revisão histórica da literatura médica cujo objetivo foi reconhecer as etapas e os achados anatômicos ao longo dos anos do desempenho de Quincke – desde a primeira punção lombar –, bem como as técnicas e as análises de coleta que permitiram que essa punção se tornasse uma ferramenta insubstituível na prática clínica diária. As análises do líquido cefalorraquidiano continuaram se desenvolvendo e hoje desempenham um papel importante no diagnóstico e na compreensão da fisiopatologia de diversas condições neurológicas. Recentemente, biomarcadores e sequenciamento genético foram objeto de vários estudos e são considerados técnicas de diagnóstico promissoras para uma grande variedade de doenças. -

7 X 11 Three Lines.P65
Cambridge University Press 978-0-521-86919-5 - The Pseudotumor Cerebri Syndrome: Pseudotumor Cerebri, Idiopathic Intracranial Hypertension, Benign Intracranial Hypertension and Related Conditions Ian Johnston, Brian Owler and John Pickard Excerpt More information 1 Introduction The condition or syndrome to be considered in this monograph has been a clearly recognized clinical entity since the descriptions given by Quincke (1893, 1897) and Nonne (1904, 1914) over 100 years ago. However, reports of cases which were almost certainly examples of the same condition undoubtedly antedated their pioneering accounts by almost four decades. The essential elements of the syndrome are the symptoms and signs of intracranial hypertension without ventricular dilatation and without an intracranial mass lesion. For reasons which will be made clear in the following chapters, we shall call it the pseudotumor cerebri syndrome (PTCS) although quite a variety of terms have been applied to it. It is a particularly intriguing condition for a number of reasons, as follows: 1. Clinically the condition presents an essentially pure picture of raised intracranial pressure (ICP) without focal neurological disturbance and without investigative evidence of structural disturbance, either focal or general. As such, it is a condition which manifests, in isolation, what is a critical component of many neurological and neurosurgical conditions, i.e. intracranial hypertension, thereby creating a situation in which the pathological effects of this component exist in a pure form. 2. Despite much speculation and numerous clinical and laboratory studies (although clinical investigations are constrained by the exigent circumstances of the condition and laboratory studies by lack of a suitable model) there is still no clear consensus on its mechanism, although the predominant view is that the intracranial hypertension is due to a disturbance of cerebrospinal fluid (CSF) dynamics. -
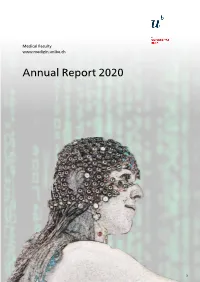
Annual Report 2020 Annual Report 2020
Medical Faculty, University of Bern, Switzerland Medical Faculty, Medical Faculty www.medizin.unibe.ch Annual Report 2020 Annual Report 2020 3 4 Contents Foreword ...................................................................................................................................................................... 7 Highlights 2020 ........................................................................................................................................................... 8 The Medical Faculty in Numbers ............................................................................................................................22 Historical Glimpses of the History of the Faculty .................................................................................................................26 Deans of the Medical Faculty ..................................................................................................................................29 Key People and Institutions Organigram .................................................................................................................................................................32 Board of Faculty .........................................................................................................................................................33 Institutional Overview ..............................................................................................................................................34 Structural Development of -

Fixed and Dilated: the History of a Classic Pupil Abnormality
HISTORICAL VIGNETTE J Neurosurg 122:453–463, 2015 Fixed and dilated: the history of a classic pupil abnormality Peter J. Koehler, MD, PhD,1 and Eelco F. M. Wijdicks, MD, PhD2 1Department of Neurology, Atrium Medical Centre, Heerlen, The Netherlands; and 2Division of Critical Care Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota The aim of this study was to investigate the development of ideas about the nature and mechanism of the fixed dilated pupil, paying particular attention to experimental conditions and clinical observations in the 19th century. Starting from Kocher’s standard review in 1901, the authors studied German, English, and French texts for historical information. Medical and neurological textbooks from the 19th and 20th centuries were reviewed to investigate when and how this in- formation percolated through neurological and neurosurgical practices. Cooper experimented with intracranial pressure (ICP) in a dog in the 1830s, but did not mention the pupils. He described dilated pupils in clinical cases without referring to the effect of light. Bright demonstrated to have some knowledge of the pupil sign (clinical observations). Realizing the unreliability of the pupil sign, Hutchinson in 1867–1868 tried to reason in which cases trepanation would be advisable. Von Leyden’s 1866 animal experiments, in which he increased CSF volume by injecting protein solutions intracranially, was the first observation in which the association between fixed dilated pupils and increased ICP was established. Along with bradycardia and motor and respiratory effects, he noticed wide pupils were usually present in a comatose state. Asymmetrical dilation could not always be attributed to increased ICP, but to an oculomotor nerve lesion. -

Advances in Neurosurgery 20 K
Advances in Neurosurgery 20 K. Piscol, M. Klinger, M. Brock (Eds.) Neurosurgical Standards Cerebral Aneurysms Malignant Gliomas With 164 Figures Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest Proceedings of the 42th Annual Meeting of the Deutsche Gesellschaft fUr Neurochirurgie Bremen, May 5-S, 1991 Prof. Dr. Kurt Piscol Neurochirurgische Klinik Zentralkrankenhaus St.-Jiirgen-Str. W-2S00 Bremen 1, FRG Prof. Dr. Margareta Klinger Neurochirurgische Klinik der UniversiHit Erlangen-Niirnberg Schwabachanlage 6 (Kopfklinikum), W-S520 Erlangen, FRG Prof. Dr. Mario Brock Neurochirurgische Klinik und Poliklinik Universitatsklinikum Steglitz, Freie Universitat Berlin Hindenburgdamm 30, W-lOOO Berlin 45, FRG ISBN-13 :978-3-540-54838-6 e-ISBN-13:978-3-642-771 09-5 DOl: 10.1007/978-3-642-77109-5 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Neurosurgical standards, cerebral aneurysms, malignant gliomas I K. Piscol, M. Klinger, M. Brock (eds.). p. cm. - (Advances in neurosurgery; 20) "Proceedings of the 42th Annual Meeting of the Deutsche Gesellschaft fiir Neurochirurgie, Bremen, May 5-8, 1991" - T.p. verso. Includes bibliographical references and index. 1. Intracranial aneurysms-Surgery-Standards-Congresses. 2. Gliomas-Surgery-Standards-Con gresses. I. Piscol, Kurt. II. Klinger, M. (Margareta), 1943-. III. Brock, M. (Mario), 1938- . IV. Deutsche Gesellschaft fUr Neurochirurgie. Tagung 42th: 1991 : Bremen, Germany. V. Series. [DNLM: 1. Cerebral Aneurysm-surgery--congresses. 2. Glioma-therapy--congresses. 3. Cerebral Aneruysm-surgery--congresses. 4. Glioma-therapy--congresses. 5. Neurosurgery-standards--con gresses. WI AD684N v.20] RD594.2.N48 1992 617.4'81-dc20 DNLM/DLC for Library of Congress 92-2145 CIP This work is subject to copyright. -

The Making of Modern Psychiatry
Ronald Chase The Making of Modern Psychiatry λογος The Making of Modern Psychiatry The Making of Modern Psychiatry Ronald Chase Cover image: A motor neuron from the ventral horn of the spinal cord (unknown species). Drawn by Otto Deiters in 1865, it is one of the first accurate representations of a nerve cell. Logos Verlag Berlin λογος Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.d-nb.de . The electronic version of this book is freely available under CC BY-SA 4.0 licence, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched (KU). KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. c Logos Verlag Berlin GmbH 2018 ISBN 978-3-8325-4718-9 DOI 10.30819/4718 Logos Verlag Berlin GmbH Comeniushof, Gubener Str. 47, 10243 Berlin Germany Tel.: +49 (0)30 42 85 10 90 Fax: +49 (0)30 42 85 10 92 INTERNET: https://www.logos-verlag.com For Jack and Niko, with Grandpa's love Contents Introduction9 1 Institutional Reforms 13 2 Cutting Nature at its Joints 21 3 Mind, Brain or Both? 34 4 A New Vision for Psychiatry 46 5 Bernhard Gudden at the Upper Bavarian District Mental Hospital 56 6 The Tragic Deaths of the King and the Professor 65 7 A Mismatched Pair of Rising Stars 72 8 Experimental Psychology 84 9 Kraepelin and Nissl in Heidelberg 100 10 A Very Complex Thing 115 11 Seeing is Believing, or Maybe Not 127 12 Mind-Altering Drugs and Disease-Causing Poisons 140 13 Psychosis 151 14 Dementia praecox 172 15 A Classification for the Twentieth Century 181 16 Nineteenth Century Psychiatry Today and in the Future 199 Suggested Readings 227 Index 228 7 Introduction Psychiatry is the medical field that deals with mental illness.