Version Februar 2016 Masterplan Botanische Gärten Der Universität
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Summary of Offerings in the PBS Bulb Exchange, Dec 2012- Nov 2019
Summary of offerings in the PBS Bulb Exchange, Dec 2012- Nov 2019 3841 Number of items in BX 301 thru BX 463 1815 Number of unique text strings used as taxa 990 Taxa offered as bulbs 1056 Taxa offered as seeds 308 Number of genera This does not include the SXs. Top 20 Most Oft Listed: BULBS Times listed SEEDS Times listed Oxalis obtusa 53 Zephyranthes primulina 20 Oxalis flava 36 Rhodophiala bifida 14 Oxalis hirta 25 Habranthus tubispathus 13 Oxalis bowiei 22 Moraea villosa 13 Ferraria crispa 20 Veltheimia bracteata 13 Oxalis sp. 20 Clivia miniata 12 Oxalis purpurea 18 Zephyranthes drummondii 12 Lachenalia mutabilis 17 Zephyranthes reginae 11 Moraea sp. 17 Amaryllis belladonna 10 Amaryllis belladonna 14 Calochortus venustus 10 Oxalis luteola 14 Zephyranthes fosteri 10 Albuca sp. 13 Calochortus luteus 9 Moraea villosa 13 Crinum bulbispermum 9 Oxalis caprina 13 Habranthus robustus 9 Oxalis imbricata 12 Haemanthus albiflos 9 Oxalis namaquana 12 Nerine bowdenii 9 Oxalis engleriana 11 Cyclamen graecum 8 Oxalis melanosticta 'Ken Aslet'11 Fritillaria affinis 8 Moraea ciliata 10 Habranthus brachyandrus 8 Oxalis commutata 10 Zephyranthes 'Pink Beauty' 8 Summary of offerings in the PBS Bulb Exchange, Dec 2012- Nov 2019 Most taxa specify to species level. 34 taxa were listed as Genus sp. for bulbs 23 taxa were listed as Genus sp. for seeds 141 taxa were listed with quoted 'Variety' Top 20 Most often listed Genera BULBS SEEDS Genus N items BXs Genus N items BXs Oxalis 450 64 Zephyranthes 202 35 Lachenalia 125 47 Calochortus 94 15 Moraea 99 31 Moraea -

Boophone Disticha
Micropropagation and pharmacological evaluation of Boophone disticha Lee Cheesman Submitted in fulfilment of the academic requirements for the degree of Doctor of Philosophy Research Centre for Plant Growth and Development School of Life Sciences University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg April 2013 COLLEGE OF AGRICULTURE, ENGINEERING AND SCIENCES DECLARATION 1 – PLAGIARISM I, LEE CHEESMAN Student Number: 203502173 declare that: 1. The research contained in this thesis, except where otherwise indicated, is my original research. 2. This thesis has not been submitted for any degree or examination at any other University. 3. This thesis does not contain other persons’ data, pictures, graphs or other information, unless specifically acknowledged as being sourced from other persons. 4. This thesis does not contain other persons’ writing, unless specifically acknowledged as being sourced from other researchers. Where other written sources have been quoted, then: a. Their words have been re-written but the general information attributed to them has been referenced. b. Where their exact words have been used, then their writing has been placed in italics and inside quotation marks, and referenced. 5. This thesis does not contain text, graphics or tables copied and pasted from the internet, unless specifically acknowledged, and the source being detailed in the thesis and in the reference section. Signed at………………………………....on the.....….. day of ……......……….2013 ______________________________ SIGNATURE i STUDENT DECLARATION Micropropagation and pharmacological evaluation of Boophone disticha I, LEE CHEESMAN Student Number: 203502173 declare that: 1. The research reported in this dissertation, except where otherwise indicated is the result of my own endeavours in the Research Centre for Plant Growth and Development, School of Life Sciences, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg. -

2017 COURS N°23.SUITE CONSTITUTION D'une FEUILLE, Suite
COURS N°23 MERCREDI LE 11 AVRIL 2018 Descriptions de plantes ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 plante herbacée, vivace par son bulbe. De ce bulbe sortent des feuilles linéaires, rubanées, à nervations parallèles. Une hampe florale porte une fleur solitaire. La hampe s’arrête à l’endroit où se trouve la bractée (ou spathe) pour devenir un pédoncule floral. La famille à laquelle appartient cette plante est caractérisée par une inflorescence en ombelle. Ici il y a une fleur solitaire. 6 tépales mauves très clairs, soudés en un tube à la base (3 nettement externes et 3 nettement internes, on pourrait les distinguer en sépales et pétales). 6 étamines, un pistil comportant un ovaire, un style et un stigmate. L’ovaire est fait de 3 carpelles bien soudés ensemble. La plante sent l’ail. Elle est maintenant incluse dans les Amaryllidacées (ovaire infère et toxique), sous-famille des Allioïdées (à ovaire supère mais comestible). Ipheion uniflorum var. caerulea (pour la variété on n’est pas sûr). La variété caerulea n’existe pas dans the Plant List. Amérique du Nord presque tempérée, sud du Brésil, Argentine. Culture très facile. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 plante herbacée, rampante. La tige rampante est souple. Il y a des nœuds et des entrenœuds. Les nœuds portent des racines adventives et des tiges. La tige est un petit peu carrée. Il y a de jeunes tiges verticales qui portent des fleurs. Les feuilles sont simples, entières, opposées, réniformes, crénelées, légèrement gaufrées, plus grandes en bas. Elles ont un pétiole. La nervation est palmée. A mi-hauteur, à l’aisselle des feuilles, apparaissent des cymes à 2 ou 3 fleurs zygomorphes. -

Mating System and Population Genetic Structure of an Androdioecious Tree, Fraxinus Lanuginosa Koidz
Heredity (2002) 88, 296–301 2002 Nature Publishing Group All rights reserved 0018-067X/02 $25.00 www.nature.com/hdy Mating system and population genetic structure of an androdioecious tree, Fraxinus lanuginosa Koidz. (Oleaceae) in northern Japan K Ishida1 and Tsutom Hiura2 1Kansai Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute, Momoyama, Fushimi, Kyoto 612–0855, Japan; 2Tomakomai Experimental Forest, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University, Tomakomai 053–0035, Japan Models for the maintenance of androdioecy have suggested life stage (Fa) were not significantly different from zero at five = = that selfing of hermaphrodites decreases the frequency of loci (Fa 0.056 to 0.101, q 0.11 to 0.61), and the Fa values males in a population (the ‘male frequency’). To test this were lower than the Fj values in several of the plots where hypothesis, we used electrophoretic allozyme methods to both values were measured. These results indicate that study the mating system and population genetics of an and- inbreeding depression substantially decreases the pro- rodioecious tree, Fraxinus lanuginosa, which exhibits large portion of selfed progeny in partially self-fertilising subpopul- variations in male frequency among subpopulations in cen- ations. A theoretical model for the maintenance of andro- tral Hokkaido (northern Japan). We estimated the outcross- dioecy showed expected male frequencies significantly ing rates by using seeds assayed at three polymorphic loci, lower than the observed values in plots with high male fre- = and found that the multilocus outcrossing rate (tm) increased quency (q 0.59 to 0.61), although the differences between = with increasing male frequency (q)(tm 0.69 to 0.99, the expected and observed values of male frequencies were = q 0.11 to 0.59). -

Visualizing Wood Anatomy in Three Dimensions with High-Resolution X-Ray Micro-Tomography (Μ CT) – a Review –
408 IAWAIAWA Journal Journal 34 (4), 34 2013: (4), 2013 408–424 VISUALIZING WOOD ANATOMY IN THREE DIMENSIONS with high-resolution X-ray micro-tomography (µ CT) – A REvIEW – Craig R. Brodersen Horticultural Sciences Department, Citrus Research & Education Center, University of Florida, 700 Experiment Station Road, Lake Alfred, FL 33850, U.S.A. E-mail: [email protected] ABsTracT High-resolution X-ray micro-tomography (μCT) has emerged as one of the most promising new tools available to wood anatomists to study the three-dimensional organization of xylem networks. This non-destructive method faithfully repro- duces the spatial relationships between the different cell types and allows the user to explore wood anatomy in new and innovative ways. With μCT imaging, the sample can be visualized in any plane and is not limited to a single section or exposed plane. Conventional CT software aids in the visualization of wood structures, and newly developed custom software can be used to rapidly automate the data extraction process, thereby accelerating the rate at which samples can be analyzed for research. In this review the origins of xylem reconstructions using traditional methods are discussed, as well as the current applications of μCT in plant biology and an overview of pertinent technical considerations associated with this technique. μCT imaging offers a new perspective on wood anatomy and highlights the importance of the relationships between wood structure and function. Keywords: Synchrotron, 3D, tomography, wood anatomy, visualization, μCT. INTrOducTiON Over the past 10–15 years high resolution X-ray micro-computed tomography (μCT) has seen a surge in popularity as a tool for producing three-dimensional (3D) visualiza- tions of plant tissue. -

TAXONOMY Plant Family Species Scientific Name GENERAL
Plant Propagation Protocol for Eriogonum niveum ESRM 412 – Native Plant Production Protocol URL: https://courses.washington.edu/esrm412/protocols/ERNI2.pdf Spring 2014 North America Distribution Washington State Distribution Source: USDA PLANTS Database TAXONOMY Plant Family Scientific Name Polygonaceae Common Name Buckwheat Family Species Scientific Name Scientific Name Eriogonum niveum Douglas ex Benth. Varieties Eriogonum niveum Douglas ex. Benth. var. dichotomum (Douglas ex Benth.) M.E. Jones Eriogonum niveum Douglas ex. Benth. var. decumbens (Benth.) Torr. & A. Gray Sub-species Eriogonum niveum Douglas ex. Benth. ssp. decumbens (Benth.) S. Stokes Cultivar Common Synonym(s) Eriogonum strictum Benth. var. lachnostegium Common Name(s) Snow buckwheat, canyon heather 6 Species Code (as per USDA Plants ERNI2 database) GENERAL INFORMATION Geographical range Found mainly on the grassy plains east of the Cascade Range in southern British Columbia, west-central Idaho, northeastern Oregon, and eastern Washington.1 See maps above for distribution in North America and Washington state. Ecological distribution Found in sand to gravelly flats, slopes, bluffs, and rocky, often volcanic outcrops, mixed grassland and sagebrush communities and conifer woodlands.1 Climate and elevation range Elevation: 150-1500 m 2 Cold Hardiness Zone: 5a-7a 6 Mean Annual Precipitation: 150 – 460 mm 2 Soil: Well-drained sands to clay 2 Local habitat and abundance Common in big sage (Artemissia tridentate), antelope bitterbrush (Purshia tridentate), and open Ponderosa pine (Pinus ponderosa) areas. It also occurs in the canyon grasslands of the Snake and Columbia River systems.2 Found primarily in full sun but will grow in partial shade such as open Ponderosa pine hillsides.6 Tolerates extremely droughty soils and is a common occupant of dry, rocky southern exposures.6 Plant strategy type / successional Colonizer 2 stage Very successful pioneer species6 Plant characteristics Rarity: Locally Common 3 Dense perennial subshrub with erect leaves. -

Rock Garden Plants
RICAN APRIL 1982 ORfICULTURlSf lue Hollies combine the superb as a hedge, they serve as a barrier to Angel (PI. Pat. 3662), a medium sized performonce of a rugged w ind and animals. It's the I'\ind of red berried beauty for smaller land Bshrub w ith the classic good lool~ engineering achievement you'd scapes; the Glue Princess (PI. Pat. of Eng lish Holly. The result is an expect to be introduced by Conard 3675) a popular, highly ornamental extraordinarily versatile plant that Pyle. variety with a profl,Jsion of bright red responds beautifully to all conditions In short, when it comes to meeting berries; and the Glue Prince ( PI. Pat. from narmal to extreme. From the most demanding landscape 3517), a rapid growing male that sun bol"ed hills and arid plains, to rocl"Y challenges, the Glue Hollies are the best insures pollination for Glue Angel and soil and the snowy North, the Glue thing to come down the road in Glue Princess. Hollies go anywhere, in any w eather. a long time. Naturally, all three come with the They can be sheared and shaped Find out more aboutthe Glue Hollies built-in hardiness and rich lustrous foli to any size from full to compact. at leading nurseries and garden age that's standard eqUipment on Use them as foundation plantings centers through out the U.S. They're all Glue Hollies. or fit them in any space. Formed available in three models: the Glue RICAN VOLUME 61 NUMBER 4 ORTICULTlIRIST Florists' strain of Primula X polyantha. -

Osmanthus Delavayi Pearly Gates
Osmanthus delavayi Pearly Gates Osmanthus delavayi Pearly Gates Botanical Name: Osmanthus delavayi Pearly Gates Common Names: TBA Native: No Foliage Type: Evergreen Plant Type: Hedging / Screening, Shrubs Plant Habit: Dense, Shrub Like, Upright Description: Pearly Gates is a dense bushy form of Osmanthus that will produce masses of tubular white and sweetly fragrant flowers in winter through early spring. Plants are hardy and easy to grow in with full sun or shade and tolerant of light frost. The small dark foliage makes it ideal for hedging. The sister-variety Heaven Sent flowers slightly later, so use in combo to extend the flowering season. Mature Height: 1-2m Position: Any Mature Width: 1-2m Soil Type: Well Drained Family Name: Oleaceae Landscape Use(s): Borders / Shrubbery, Courtyard, Cut Flower, Feature, Formal Garden, Fragrant Garden, Hedging / Screening, Mass Planting, Shady Garden, Origin: Asia Topiary / Espalier, Tropical Garden, Container / Pot, Under Trees Characteristics: Pest & Diseases: Foliage Colours: Green Generally trouble free Flower Colours: White Flower Fragrant: No Cultural Notes: Flowering Season: Summer Will grow well in most soil types. Very poor or heavy soils may need some organic Fruit: Insignificant matter adding prior to planting. May need some protection in extreme situations especially when young. Space plants 1m apart for a hedge or screen. Lightly prune Requirements: after flowering to maintain shape. Extra trimming maybe required if a more formal Growth Rate: Moderate hedge or shape is desired. Feed plants in spring and summer using a high quality Maintenance Level: Medium compete fertiliser. Information and images courtesy of Paradise Plants. Water Usage: Medium / Moderate Plant Care: Tolerances: Annual slow release fertiliser, Keep moist during dry periods, Mulch well Drought: Medium / Moderate Frost: Moderate Wind: Moderate Disclaimer: Information and images provided is to be used as a guide only. -

Newsletter No. 4 Autumn 2005
The Southern African Bulb Group Newsletter No. 4 Autumn 2005 The Southern African Bulb Group was initiated by a group of enthusiasts on April 4th 2004. The objective of the group is to further the understanding of the cultivation of Southern African bulbs, where `bulbs' is used in the broad sense to encompass bulb-, corm- and tuber- possessing Southern African plants, including `dicots' such as Oxalis. In the first instance the group will be run on an informal basis, with an initial subscription of £5 invited from participants. Committee: Robin Attrill (Membership secretary and Newsletter editor), Margaret Corina (Treasurer), Stefan Rau and Terry Smale Editorial This issue of the newsletter contains a report of the meeting of the group held at Rupert Bowlby's Nursery on April 9th 2005, an article on Crinum moorei by David Corina, information on recent literature of interest to growers of Southern African bulbs, and an updated list of suppliers of seed and bulbs/corms of Southern African geophytes. In addition a balance sheet covering the first year of operation of the group is attached. With respect to the supplier list, please let me know if you are aware of other sources which should be included. As I have previously stated the group welcomes articles, and suggestions, for inclusion in future newsletters. Contributions (hand/typewritten and electronic are acceptable!) are urgently required and should be sent to the newsletter editor at 17 Waterhouse Moor, Harlow, Essex, CM18 6BA (Email [email protected] ) Publication of the next issue is scheduled for December 2005. Report on visit to Rupert Bowlby - Saturday 9 th April 2005 by David Corina About 20 members attended the event, and the Group would like to thank Rupert for his hospitality at the event and for opening his collection to the public gaze. -
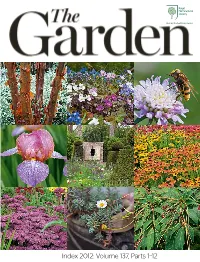
RHS the Garden 2012 Index Volume 137, Parts 1-12
Index 2012: Volume 137, Parts 112 Index 2012 The The The The The The GardenJanuary 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 GardenFebruary 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 GardenMarch 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 GardenApril 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 GardenMay 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 GardenJune 2012 | www.rhs.org.uk | £4.25 RHS TRIAL: LIVING Succeed with SIMPLE WINTER GARDENS GROWING BUSY LIZZIE RHS GUIDANCE Helleborus niger PLANTING IDEAS WHICH LOBELIA Why your DOWNY FOR GARDENING taken from the GARDEN GROW THE BEST TO CHOOSE On home garden is vital MILDEW WITHOUT A Winter Walk at ORCHIDS SHALLOTS for wildlife How to spot it Anglesey Abbey and what to HOSEPIPE Vegetables to Radishes to grow instead get growing ground pep up this Growing chard this month rough the seasons summer's and leaf beet at Tom Stuart-Smith's salads private garden 19522012: GROW YOUR OWN CELEBRATING Small vegetables OUR ROYAL for limited spaces PATRON SOLOMON’S SEALS: SHADE LOVERS TO Iris for Welcome Dahlias in containers CHERISH wınter to the headline for fi ne summer displays Enjoy a SUCCEED WITH The HIPPEASTRUM Heavenly summer colour How to succeed ALL IN THE MIX snowdrop with auriculas 25 best Witch hazels for seasonal scent Ensuring a successful magnolias of roses peat-free start for your PLANTS ON CANVAS: REDUCING PEAT USE IN GARDENING seeds and cuttings season CELEBRATING BOTANICAL ART STRAWBERRY GROWING DIVIDING PERENNIALS bearded iris PLUS YORKSHIRE NURSERY VISIT WITH ROY LANCASTER May12 Cover.indd 1 05/04/2012 11:31 Jan12 Cover.indd 1 01/12/2011 10:03 Feb12 Cover.indd 1 05/01/2012 15:43 Mar12 Cover.indd 1 08/02/2012 16:17 Apr12 Cover.indd 1 08/03/2012 16:08 Jun12 OFC.indd 1 14/05/2012 15:46 1 January 2012 2 February 2012 3 March 2012 4 April 2012 5 May 2012 6 June 2012 Numbers in bold before ‘Moonshine’ 9: 55 gardens, by David inaequalis) 10: 25, 25 gracile ‘Chelsea Girl’ 7: the page number(s) sibirica subsp. -

Articles-38747 Archivo 01.Pdf
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA Ministro de Educación Pública Carolina Schmidt Zaldívar Subsecretario de Educación Fernando Rojas Ochagavía Dirección de Bibliotecas, Magdalena Krebs Kaulen Archivo y Museos Diagramación Herman Núñez Impreso por BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CHILE Director Claudio Gómez Papic Editor Herman Núñez Comité Editor Pedro Báez R. Mario Elgueta D. Gloria Rojas V. David Rubilar R. Rubén Stehberg L. (c) Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Inscripción N° XXXXXXX Edición de 100 ejemplares Museo Nacional de Historia Natural Casilla 787 Santiago de Chile www.mnhn.cl Se ofrece y acepta canje Exchange with similar publications is desired Échange souhaité Wir bitten um Austach mit aehnlichen Fachzeitschriften Si desidera il cambio con publicazioni congeneri Deseja-se permuta con as publicações congéneres Este volumen se encuentra disponible en soporte electrónico como disco compacto y en línea en Contribución del Museo Nacional de Historia Natural al Programa del Conocimiento y Preservación de la Diversidad Biológica Las opiniones vertidas en cada uno de los artículos publicados son de excluisiva responsabilidad del autor respectivo BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CHILE 2013 62 SUMARIO CLAUDIO GÓMEZ P. Editorial ............................................................................................................................................................................6 ANDRÉS O. TAUCARE-RÍOS y WALTER SIELFELD Arañas (Arachnida: Araneae) del Extremo Norte de Chile ...............................................................................................7 -

Baja California, Mexico, and a Vegetation Map of Colonet Mesa Alan B
Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany Volume 29 | Issue 1 Article 4 2011 Plants of the Colonet Region, Baja California, Mexico, and a Vegetation Map of Colonet Mesa Alan B. Harper Terra Peninsular, Coronado, California Sula Vanderplank Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont, California Mark Dodero Recon Environmental Inc., San Diego, California Sergio Mata Terra Peninsular, Coronado, California Jorge Ochoa Long Beach City College, Long Beach, California Follow this and additional works at: http://scholarship.claremont.edu/aliso Part of the Biodiversity Commons, Botany Commons, and the Ecology and Evolutionary Biology Commons Recommended Citation Harper, Alan B.; Vanderplank, Sula; Dodero, Mark; Mata, Sergio; and Ochoa, Jorge (2011) "Plants of the Colonet Region, Baja California, Mexico, and a Vegetation Map of Colonet Mesa," Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany: Vol. 29: Iss. 1, Article 4. Available at: http://scholarship.claremont.edu/aliso/vol29/iss1/4 Aliso, 29(1), pp. 25–42 ’ 2011, Rancho Santa Ana Botanic Garden PLANTS OF THE COLONET REGION, BAJA CALIFORNIA, MEXICO, AND A VEGETATION MAPOF COLONET MESA ALAN B. HARPER,1 SULA VANDERPLANK,2 MARK DODERO,3 SERGIO MATA,1 AND JORGE OCHOA4 1Terra Peninsular, A.C., PMB 189003, Suite 88, Coronado, California 92178, USA ([email protected]); 2Rancho Santa Ana Botanic Garden, 1500 North College Avenue, Claremont, California 91711, USA; 3Recon Environmental Inc., 1927 Fifth Avenue, San Diego, California 92101, USA; 4Long Beach City College, 1305 East Pacific Coast Highway, Long Beach, California 90806, USA ABSTRACT The Colonet region is located at the southern end of the California Floristic Province, in an area known to have the highest plant diversity in Baja California.