Ronald Lötzsch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
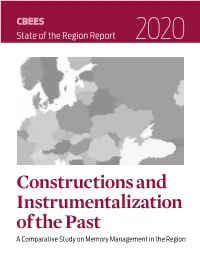
Constructions and Instrumentalization of the Past: a Comparative Study on Memory Management in the Region
CBEES State of the Region Report 2020 Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region Published with support from the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjstiftelsen) Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region December 2020 Publisher Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Sdertrn University © CBEES, Sdertrn University and the authors Editor Ninna Mrner Editorial Board Joakim Ekman, Florence Frhlig, David Gaunt, Tora Lane, Per Anders Rudling, Irina Sandomirskaja Layout Lena Fredriksson, Serpentin Media Proofreading Bridget Schaefer, Semantix Print Elanders Sverige AB ISBN 978-91-85139-12-5 4 Contents 7 Preface. A New Annual CBEES Publication, Ulla Manns and Joakim Ekman 9 Introduction. Constructions and Instrumentalization of the Past, David Gaunt and Tora Lane 15 Background. Eastern and Central Europe as a Region of Memory. Some Common Traits, Barbara Trnquist-Plewa ESSAYS 23 Victimhood and Building Identities on Past Suffering, Florence Frhlig 29 Image, Afterimage, Counter-Image: Communist Visuality without Communism, Irina Sandomirskaja 37 The Toxic Memory Politics in the Post-Soviet Caucasus, Thomas de Waal 45 The Flag Revolution. Understanding the Political Symbols of Belarus, Andrej Kotljarchuk 55 Institutes of Trauma Re-production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania, Per Anders Rudling COUNTRY BY COUNTRY 69 Germany. The Multi-Level Governance of Memory as a Policy Field, Jenny Wstenberg 80 Lithuania. Fractured and Contested Memory Regimes, Violeta Davoliūtė 87 Belarus. The Politics of Memory in Belarus: Narratives and Institutions, Aliaksei Lastouski 94 Ukraine. Memory Nodes Loaded with Potential to Mobilize People, Yuliya Yurchuk 106 Czech Republic. -

Download Book
84 823 65 Special thanks to the Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies for assistance in getting access to archival data. The author also expresses sincere thanks to the International Consortium "EuroBelarus" and the Belarusian Association of Journalists for information support in preparing this book. Photos by ByMedia.Net and from family albums. Aliaksandr Tamkovich Contemporary History in Faces / Aliaksandr Tamkovich. — 2014. — ... pages. The book contains political essays about people who are well known in Belarus and abroad and who had the most direct relevance to the contemporary history of Belarus over the last 15 to 20 years. The author not only recalls some biographical data but also analyses the role of each of them in the development of Belarus. And there is another very important point. The articles collected in this book were written at different times, so today some changes can be introduced to dates, facts and opinions but the author did not do this INTENTIONALLY. People are not less interested in what we thought yesterday than in what we think today. Information and Op-Ed Publication 84 823 © Aliaksandr Tamkovich, 2014 AUTHOR’S PROLOGUE Probably, it is already known to many of those who talked to the author "on tape" but I will reiterate this idea. I have two encyclopedias on my bookshelves. One was published before 1995 when many people were not in the position yet to take their place in the contemporary history of Belarus. The other one was made recently. The fi rst book was very modest and the second book was printed on classy coated paper and richly decorated with photos. -

Review–Chronicle
REVIEWCHRONICLE of the human rights violations in Belarus in 2005 Human Rights Center Viasna ReviewChronicle » of the Human Rights Violations in Belarus in 2005 VIASNA « Human Rights Center Minsk 2006 1 REVIEWCHRONICLE of the human rights violations in Belarus in 2005 » VIASNA « Human Rights Center 2 Human Rights Center Viasna, 2006 REVIEWCHRONICLE of the human rights violations in Belarus in 2005 INTRODUCTION: main trends and generalizations The year of 2005 was marked by a considerable aggravation of the general situation in the field of human rights in Belarus. It was not only political rights » that were violated but social, economic and cultural rights as well. These viola- tions are constant and conditioned by the authoritys voluntary policy, with Lu- kashenka at its head. At the same time, human rights violations are not merely VIASNA a side-effect of the authoritarian state control; they are deliberately used as a « means of eradicating political opponents and creating an atmosphere of intimi- dation in the society. The negative dynamics is characterized by the growth of the number of victims of human rights violations and discrimination. Under these circums- tances, with a high level of latent violations and concealed facts, with great obstacles to human rights activity and overall fear in the society, the growth points to drastic stiffening of the regimes methods. Apart from the growing number of registered violations, one should men- Human Rights Center tion the increase of their new forms, caused in most cases by the development of the state oppressive machine, the expansion of legal restrictions and ad- ministrative control over social life and individuals. -

Preliminary Monitoring of Human Rights Center “Viasna” Concerning Tortures and Facts of Other Kinds of Inhumane Treatment Towards Citizens of Belarus
REVIEW-CHRONICLE OF THE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN BELARUS IN 2004 2 REVIEW-CHRONICLE OF THE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN BELARUS IN 2004 PREAMBLE: CONCLUSIONS AND GENERALIZATIONS In 2004 the political situation in Belarus was distinguished by further worsening of the situation of human rights and the relations between the state and individuals. Regular and deliberate human rights violations became a necessary condition for the strengthening of the unlimited dictatorial power – infringements of human rights served as the funda¬ment for authoritarianism and were a favorable environment for the development of totalitarianism. One of the main factors that influenced the public and political situation in Belarus in 2004 was the Parliamentary election and the nationwide referendum concerning the possibility to prolong Aliaksandr Luka¬shenka’s presidential powers. The need for the liquidation of the cons¬ti¬tutional restriction of the number of possible presidential terms defined the state policy and influenced it in all circles of public life. This factor ma¬nifested in the sphere of human rights with the aggravation of the rep¬ressions against political opponents and prosecution of opposition-mindedness, enforcement of new discriminative legal acts, further limitation of the freedom of the press, violation of the liberty of peaceful assemblies and associations and other obstacles for the enjoyment of personal liberties by citizens of Belarus. Citizens of Belarus were deprived of the right to take part in the state government with the assistance of elected representatives. The election to the Chamber of Representatives wasn’t free and democratic. It was conducted according to the scenario that was prepared by the authorities in complete conformity with the “wishes” A. -

Download a Pdf Copy of the Publication
In Germany and occupied Austria, people with disabilities were the first to fall victim to National Socialist mass murder, propa- IHRA gated under the euphemistic term of “euthanasia”. For racist and economic reasons they were deemed unfit to live. The means and methods used in these crimes were applied later during the Holocaust— perpetrators of these first murders became experts in the death camps of the so-called “Aktion Reinhardt”. International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.) Over the course of World War II the National Socialists aimed to exterminate people with disabilities in the occupied territories of Mass Murder of People with Western Europe, and also in Eastern Europe. This publication presents the results of the latest research on Disabilities and the Holocaust these murders in the German occupied territories, as discussed at an IHRA conference held in Bern in November 2017. Edited by Brigitte Bailer and Juliane Wetzel Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust the and Disabilities with People of Murder Mass ISBN: 978-3-86331-459-0 9 783863 314590 us_ihra_band_5_fahne.indd 1 11.02.2019 15:48:10 IHRA series, vol. 5 ihra_5_fahnen Nicole.indd 2 29.01.19 13:43 International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.) Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust Edited by Brigitte Bailer and Juliane Wetzel ihra_5_fahnen Nicole.indd 3 29.01.19 13:43 With warm thanks to Toby Axelrod for her thorough and thoughtful proofreading of this publication, and Laura Robertson from the Perma- nent Oce of IHRA for her support during the publication procedure. ISBN: 978-3-86331-459-0 ISBN (E-Book): 978-3-86331-907-6 © 2019 Metropol Verlag + IHRA Ansbacher Straße 70 10777 Berlin www.metropol-verlag.de Alle Rechte vorbehalten Druck: buchdruckerei.de, Berlin ihra_5_fahnen Nicole.indd 4 29.01.19 13:43 Content Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust .......................................... -

The Belarusian Press of the Second Polish Republic in Egodocuments
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2019. T. specjalny: Dla Niepodległej The Studies into the History of the Book and Book Collections 2019. Special issue: For an Independent Poland ISSN 1897-0788, e-ISSN 2544-8730 www.bookhistory.uw.edu.pl https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2020.210 Nadzeya Sluka National Academy of Sciences of Belarus in Minsk [email protected] ORCID 0000-0002-5874-6476 Naked eye: the Belarusian press of the Second Polish Republic in egodocuments Abstract The article deals with the particular kind of documentary sources for the history of the Belarusians in the Second Polish Republic – memoirs and diaries. The memoirs of Liudvika Vojcik, Janka Bagdanowič, Marjan Pieciukievič, and also the diaries of Maksim Tank and Piotr Siaŭruk are reviewed. The article concludes that personal writings provide unique information about the Belarusian national movement and the Belarusian press that can be applied in further historical research. Key words: Second Polish Republic – Western Belarus – Belarusian press – egodocuments. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej – zadanie finansowane w ramach umowy nr 653/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. © Copyright by Uniwersytet Warszawski; CC BY-NC 4.0 http://doi.org/10.33077/zbkh Nadzeya Sluka Egodocuments are invaluable source materials as they deliver the insights into the lived experience of the people. The diaries and memoirs of the partic- ipants of the Belarusian national movement in the Second Polish Republic can be studied as a separate object of historical research, but also can back up his- torical facts from other sources, and connect them to create a more accurate picture of historical events and figures. -

Understanding the Political Symbols of Belarus by Andrej Kotljarchuk
Essay The Flag Revolution. Understanding the Political Symbols of Belarus by Andrej Kotljarchuk elarus remains one of the least known Lukashenka led to mass protests across the country for countries in western and northern the right to vote in free and fair elections. International Europe. There are several reasons for readers are fascinated by the peaceful nature of the pro- this, the primary one being the fact that tests and by the thousands of white-red-white fags worn in modern times, Belarus did not exist by protestors. as a political entity. During this time Belarus had no sovereignty, being initially a province of Poland-Lithua- aving a national fag is an old tradition. From the nia and the Russian Empire.1 The Cold War contributed Hbeginning, national fags were an efective medium to the disappearance of Belarus from Western politi- for political messages that could be passed on to people cal and academic discourse. Very few scientifc books without having to rely on a certain level of literacy. Dur- and articles about Belarus were published in the West ing the era of nationalism in Europe, several new political before 1991.2 Despite the Belarusian SSR’s membership nations constructed their own fags that were intended of the UN, Belarus was absorbed by the Soviet Union. to mobilize a movement and unite a nation around a Unlike neighboring Latvia or Lithuania, Belarus was not powerful political symbol. As Gabriella Elgenius point- independent during the interwar period and had no large ed out, in the modern world national fags continue to diaspora in Europe after 1945. -
Punishment Without Crime: Belarusian Prison Poetry
69 The Journal of Belarusian Studies Punishment Without Crime: Belarusian Prison Poetry BY ARNOLD MCMILLIN* ‘I never saw a man who looked With such a wistful eye Upon that little tent of blue Which prisoners call the sky.’ Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol (1898) ‘Stone walls do not a prison make, Nor iron bars a cage...’ Richard Lovelace, ‘To Althea, from Prison: Song’ (1649) In Belarus during the twentieth and twenty-first centuries many people were punished with imprisonment for the ‘crime’ of resisting hostile political systems or defending minority national and religious allegiances: under the Tsars, when Belarus was referred to as The North West Region of the Russian Empire; between 1921 and 1939 when Western Belarus was under Polish rule; before and after the Second World War in Soviet Belarus; and, of course, during the authoritarian reign of Aliaksandr Lukašenka. It is worth recalling that Stalin’s purges of the Belarusian elite were more thorough in Belarus than anywhere else in the Soviet Union, with 90% of the leading Belarusian literary group ‘Maladniak’ subjected to show trials as early as 1930. As Andrew Wilson notes, during the great purges of 1937-41, 100,000- 250,000 Belarusians were murdered and buried in the notorious Kurapaty site near Minsk (Wilson 2011, 205). For more detail of Stalin’s victims see the comprehensive work of Lieanid Marakoǔ: Marakoǔ 2002-05, Marakoǔ 2007a, and Marakoǔ 2007b. This paper considers the poetry of those who suffered prison rather * Arnold McMillin is Emeritus Professor at the School of Slavonic and East European Studies, University College London. -

Table of Contents: Summary
July-December 2014 Belarusian Institute for Strategic Studies Table of contents: Summary This new issue of BISS-Trends is a semiannual monitoring review of the main 1 Summary developments in the Belarusian state and society in the second half of 2014. The report identifies the main trends in the following areas: 2 Executive summary • political democratization / political liberalization; 3 Political liberalization/ political democratiza- • economic liberalization; tion • good governance and rule of law; • geopolitical orientation; 6 Economic liberalization • cultural policy. Each of these five priority areas is described based upon the following 8 Good governance and rule of law pattern: • general characteristic of the main tendencies; 10 Geopolitical orientation • description of the main developments that determined the rating of the trend; 13 Cultural policy • description of additional developments; • brief forecast for the next six months. At the beginning start of the report, we offer a brief summary of the main trends in the five target areas (Executive summary). This review also comprises a table that identifies the degree of progress or regress in each area. 1 July-December 2014 Belarusian Institute for Strategic Studies Executive summary Regress continued in the political democratization/political liberalization segment in the second half of the year, and negative changes were recorded. The main developments that identified the trend towards further deliberalization were curbs on the freedom of speech brought about by the new version of the law “On the mass media” and massive blocking of Internet news resources and media regardless of their political engagement. The second half of the year was marked by an increase in repression against human rights activists and journalists, whereas the scope of repression in terms of the freedom of association and freedom of assembly remained unchanged. -

Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene?
Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? EDITED BY Piotr RUDKOŬSKI Kaciaryna KOLB Warsaw 2013 Editors: Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb Papers of the conference “Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene?” The conference was held on 8-10 of March 2013 in Warsaw, Poland The conference was sponsored by Konrad-Adenauer-Stiftung Belarus Office, National Endowment for Democracy and Lazarski University Translation: Aleś Lahviniec, Vieranika Mazurkievič Proof-reading: Sviatlana Citova (Belarusian), Barbara Kozieł (English) Cover design: Marzena Dołganiuk Stylesheet set-up: Nadzieja Pankratava Publication of this volume was made possible by National Endowment for Democracy © Copyright by Uczelnia Łazarskiego, Warsaw 2013 Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 02-662 Warszawa ul. Świeradowska 43 tel. 22 54-35-450, 22 54-35-410 [email protected] www.lazarski.pl ISBN: 978-83-64054-32-7 Implementation of publishing: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85 e-mail: [email protected], www.elipsa.pl Contents Preface. Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb ................................................................................7 Introduction. Reflections on Self-goverment and Citizenship. Andrzej S. Kamiński ......................................................................................................................9 PART 1. HISTORIA MAGISTRA VITAE-IN-LIBERTATE ..................................................17 -

Belarusian Prison Poetry BY
69 The Journal of Belarusian Studies Punishment Without Crime: Belarusian Prison Poetry BY ARNOLD MCMILLIN * ‘I never saw a man who looked With such a wistful eye Upon that little tent of blue Which prisoners call the sky.’ Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol (1898) ‘Stone walls do not a prison make, Nor iron bars a cage...’ Richard Lovelace, ‘To Althea, from Prison: Song’ (1649) In Belarus during the twentieth and twenty-first centuries many people were punished with imprisonment for the ‘crime’ of resisting hostile political systems or defending minority national and religious allegiances: under the Tsars, when Belarus was referred to as The North West Region of the Russian Empire; between 1921 and 1939 when Western Belarus was under Polish rule; before and after the Second World War in Soviet Belarus; and, of course, during the authoritarian reign of Aliaksandr Lukašenka. It is worth recalling that Stalin’s purges of the Belarusian elite were more thorough in Belarus than anywhere else in the Soviet Union, with 90% of the leading Belarusian literary group ‘Maladniak’ subjected to show trials as early as 1930. As Andrew Wilson notes, during the great purges of 1937-41, 100,000- 250,000 Belarusians were murdered and buried in the notorious Kurapaty site near Minsk (Wilson 2011, 205). For more detail of Stalin’s victims see the comprehensive work of Lieanid Marakoǔ: Marakoǔ 2002-05, Marakoǔ 2007a, and Marakoǔ 2007b. This paper considers the poetry of those who suffered prison rather * Arnold McMillin is Emeritus Professor at the School of Slavonic and East European Studies, University College London. -

Excerpts from a Panel Discussion Held on 13 May 2011 in Kraków During the Second International Miłosz Festival
Przekładaniec. Between Miłosz and Milosz 25 (2011): 281–296 10.4467/16891864ePC.13.031.1220 EXCERPTS FROM A PANEL DISCUSSION HELD ON 13 MAY 2011 IN KRAKÓW DURING THE SECOND INTERNATIONAL MIŁOSZ FESTIVAL The title of the panel devoted to Czesław Miłosz’s works and their trans- lations in international circulation is meant to allude to the title of Jan Błoński’s book Miłosz jak świat (Miłosz Like the World), and at the same time to The World. A Naïve Poem, one of the most frequently translated works by the Polish Nobel laureate. The discussion featured translators of the poet’s work into different languages, people involved in creating his image; they spoke of his work and the realities of their respective cultures and traditions, and the readers apprehending it from a range of very dif- ferent experiences. They all shared the belief in Miłosz’s importance for the literatures of their countries and for world literature, and an aware- ness of the many diffi culties in translating Miłosz’s works. The discussion, excerpts of which are presented below, was the culminating point of the international translation seminars of the 2nd Czesław Miłosz Literary Festi- val. During the seminars more than twenty individuals from different coun- tries worked for four days with the assistance and guidance of experienced translators of Polish literature and Miłosz scholars. Miłosz like the world; Miłosz and the world; Miłosz in the world; Miłosz as a world poet: this may suffi ce as the briefest summary of the debate chaired by Magda Heydel, a conversation that featured: Anders Bodegård, a Swedish Slavicist, translator of Polish and French literature, for many years a teacher of Swedish at the Jagiellonian Univer- sity and the University of Warsaw.