Fürastronomie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abstracts of Extreme Solar Systems 4 (Reykjavik, Iceland)
Abstracts of Extreme Solar Systems 4 (Reykjavik, Iceland) American Astronomical Society August, 2019 100 — New Discoveries scope (JWST), as well as other large ground-based and space-based telescopes coming online in the next 100.01 — Review of TESS’s First Year Survey and two decades. Future Plans The status of the TESS mission as it completes its first year of survey operations in July 2019 will bere- George Ricker1 viewed. The opportunities enabled by TESS’s unique 1 Kavli Institute, MIT (Cambridge, Massachusetts, United States) lunar-resonant orbit for an extended mission lasting more than a decade will also be presented. Successfully launched in April 2018, NASA’s Tran- siting Exoplanet Survey Satellite (TESS) is well on its way to discovering thousands of exoplanets in orbit 100.02 — The Gemini Planet Imager Exoplanet Sur- around the brightest stars in the sky. During its ini- vey: Giant Planet and Brown Dwarf Demographics tial two-year survey mission, TESS will monitor more from 10-100 AU than 200,000 bright stars in the solar neighborhood at Eric Nielsen1; Robert De Rosa1; Bruce Macintosh1; a two minute cadence for drops in brightness caused Jason Wang2; Jean-Baptiste Ruffio1; Eugene Chiang3; by planetary transits. This first-ever spaceborne all- Mark Marley4; Didier Saumon5; Dmitry Savransky6; sky transit survey is identifying planets ranging in Daniel Fabrycky7; Quinn Konopacky8; Jennifer size from Earth-sized to gas giants, orbiting a wide Patience9; Vanessa Bailey10 variety of host stars, from cool M dwarfs to hot O/B 1 KIPAC, Stanford University (Stanford, California, United States) giants. 2 Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology TESS stars are typically 30–100 times brighter than (Pasadena, California, United States) those surveyed by the Kepler satellite; thus, TESS 3 Astronomy, California Institute of Technology (Pasadena, Califor- planets are proving far easier to characterize with nia, United States) follow-up observations than those from prior mis- 4 Astronomy, U.C. -

Astronomy Magazine 2011 Index Subject Index
Astronomy Magazine 2011 Index Subject Index A AAVSO (American Association of Variable Star Observers), 6:18, 44–47, 7:58, 10:11 Abell 35 (Sharpless 2-313) (planetary nebula), 10:70 Abell 85 (supernova remnant), 8:70 Abell 1656 (Coma galaxy cluster), 11:56 Abell 1689 (galaxy cluster), 3:23 Abell 2218 (galaxy cluster), 11:68 Abell 2744 (Pandora's Cluster) (galaxy cluster), 10:20 Abell catalog planetary nebulae, 6:50–53 Acheron Fossae (feature on Mars), 11:36 Adirondack Astronomy Retreat, 5:16 Adobe Photoshop software, 6:64 AKATSUKI orbiter, 4:19 AL (Astronomical League), 7:17, 8:50–51 albedo, 8:12 Alexhelios (moon of 216 Kleopatra), 6:18 Altair (star), 9:15 amateur astronomy change in construction of portable telescopes, 1:70–73 discovery of asteroids, 12:56–60 ten tips for, 1:68–69 American Association of Variable Star Observers (AAVSO), 6:18, 44–47, 7:58, 10:11 American Astronomical Society decadal survey recommendations, 7:16 Lancelot M. Berkeley-New York Community Trust Prize for Meritorious Work in Astronomy, 3:19 Andromeda Galaxy (M31) image of, 11:26 stellar disks, 6:19 Antarctica, astronomical research in, 10:44–48 Antennae galaxies (NGC 4038 and NGC 4039), 11:32, 56 antimatter, 8:24–29 Antu Telescope, 11:37 APM 08279+5255 (quasar), 11:18 arcminutes, 10:51 arcseconds, 10:51 Arp 147 (galaxy pair), 6:19 Arp 188 (Tadpole Galaxy), 11:30 Arp 273 (galaxy pair), 11:65 Arp 299 (NGC 3690) (galaxy pair), 10:55–57 ARTEMIS spacecraft, 11:17 asteroid belt, origin of, 8:55 asteroids See also names of specific asteroids amateur discovery of, 12:62–63 -
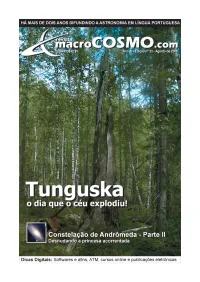
Macrocosmo Nº33
HA MAIS DE DOIS ANOS DIFUNDINDO A ASTRONOMIA EM LÍNGUA PORTUGUESA K Y . v HE iniacroCOsmo.com SN 1808-0731 Ano III - Edição n° 33 - Agosto de 2006 * t i •■•'• bSÈlÈWW-'^Sif J fé . ’ ' w s » ws» ■ ' v> í- < • , -N V Í ’\ * ' "fc i 1 7 í l ! - 4 'T\ i V ■ }'- ■t i' ' % r ! ■ 7 ji; ■ 'Í t, ■ ,T $ -f . 3 j i A 'A ! : 1 l 4/ í o dia que o ceu explodiu! t \ Constelação de Andrômeda - Parte II Desnudando a princesa acorrentada £ Dicas Digitais: Softwares e afins, ATM, cursos online e publicações eletrônicas revista macroCOSMO .com Ano III - Edição n° 33 - Agosto de I2006 Editorial Além da órbita de Marte está o cinturão de asteróides, uma região povoada com Redação o material que restou da formação do Sistema Solar. Longe de serem chamados como simples pedras espaciais, os asteróides são objetos rochosos e/ou metálicos, [email protected] sem atmosfera, que estão em órbita do Sol, mas são pequenos demais para serem considerados como planetas. Até agora já foram descobertos mais de 70 Diretor Editor Chefe mil asteróides, a maior parte situados no cinturão de asteróides entre as órbitas Hemerson Brandão de Marte e Júpiter. [email protected] Além desse cinturão podemos encontrar pequenos grupos de asteróides isolados chamados de Troianos que compartilham a mesma órbita de Júpiter. Existem Editora Científica também aqueles que possuem órbitas livres, como é o caso de Hidalgo, Apolo e Walkiria Schulz Ícaro. [email protected] Quando um desses asteróides cruza a nossa órbita temos as crateras de impacto. A maior cratera visível de nosso planeta é a Meteor Crater, com cerca de 1 km de Diagramadores diâmetro e 600 metros de profundidade. -
![Arxiv:1902.02360V2 [Astro-Ph.GA] 8 Feb 2019 Ers and the Accretion of Smaller Galaxies (E.G](https://docslib.b-cdn.net/cover/5765/arxiv-1902-02360v2-astro-ph-ga-8-feb-2019-ers-and-the-accretion-of-smaller-galaxies-e-g-3035765.webp)
Arxiv:1902.02360V2 [Astro-Ph.GA] 8 Feb 2019 Ers and the Accretion of Smaller Galaxies (E.G
DRAFT VERSION FEBRUARY 11, 2019 Typeset using LATEX twocolumn style in AASTeX62 The Next Generation Fornax Survey (NGFS): V. Discovery of a dwarf-dwarf galaxy pair at z = 0:30 and its characterization using deep VLT/MUSE observations ∗ y z x EVELYN J. JOHNSTON,1 , PAUL EIGENTHALER,1 , THOMAS H. PUZIA,1 YASNA ORDENES-BRICENO˜ ,1, 2 , MATTHEW A. TAYLOR,3 , ∗ KARLA ALAMO-MART´INEZ,4 , PATRICK COTˆ E´,5 GASPAR GALAZ,1 EVA K. GREBEL,2 MICHAEL HILKER,6 ARIANE LANC¸ ON,7 y STEFFEN MIESKE,8 RUBEN SANCHEZ´ -JANSSEN,9 AND YU RONG1 , 1Institute of Astrophysics, Pontificia Universidad Catolica´ de Chile, Av. Vicuna˜ Mackenna 4860, 7820436 Macul, Santiago, Chile 2Astronomisches Rechen-Institut, Zentrum fur¨ Astronomie der Universitat¨ Heidelberg, Monchhofstraße¨ 12-14, D-69120 Heidelberg, Germany 3Gemini Observatory, Northern Operations Center, 670 North A’ohoku Place, Hilo, HI 96720, USA 4Departamento de Astronomia, Instituto de F´ısica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 91501-970 Porto Alegre, R.S, Brazil 5NRC Herzberg Astronomy and Astrophysics, 5071 West Saanich Road, Victoria, BC V9E 2E7, Canada 6European Southern Observatory, Karl-Schwarzchild-Str. 2, D-85748 Garching, Germany 7Observatoire astronomique de Strasbourg, Universite´ de Strasbourg, CNRS, UMR 7550, 11 rue de l’Universite, F-67000 Strasbourg, France 8European Southern Observatory, 3107 Alonso de Cordova,´ Vitacura, Santiago 9STFC UK Astronomy Technology Centre, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh, EH9 3HJ, UK (Received September 13, 2018; Revised February 01, 2019; Accepted February 02, 2019) Submitted to ApJ ABSTRACT We report the detection of a pair of dwarf galaxies at z = 0:30 which may be in the early stages of an 9 interaction. -

ETD-5608-032-LIN-9413.13.Pdf (3.426Mb)
TESTING THE DARK SECTOR VERSUS MODIFIED GRAVITY MODELS IN COSMOLOGY by Weikang Lin APPROVED BY SUPERVISORY COMMITTEE: Dr. Mustapha Ishak-Boushaki, Chair Dr. Robert Glosser Dr. Michael Kesden Dr. Lindsay J. King Dr. Kaloyan Penev Copyright c 2018 Weikang Lin All rights reserved TESTING THE DARK SECTOR VERSUS MODIFIED GRAVITY MODELS IN COSMOLOGY by WEIKANG LIN DISSERTATION Presented to the Faculty of The University of Texas at Dallas in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PHYSICS THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS August 2018 ACKNOWLEDGMENTS I want to say thanks to many people. I am hoping I would not leave out anyone. First I would like to thank my advisor Dr. Mustapha Ishak for the past six years of support and advise for my graduate study. I am thankful that Dr. Ishak encouraged me to explore various sci- entific ideas. Dr. Ishak has provided significant help during my search for postdoctoral positions. I would also like to thank my dissertation committee including Dr. Mustapha Ishak, Dr. Robert Glosser, Dr. Michael Kesden, Dr. Lindsay King and Dr. Kaloyan Penev. I thank Dr. Glosser and Dr. Penev for providing advise about my career decision. I want to sincerely express my grati- tude to Dr. Michael Kesden and Dr. Lindsay King, for their help during my search of postdoctoral position. They both have pointed out to me many postdoctoral opportunities, especially the post- doctoral position at NCSU pointed out by Dr. Kesden. I owe a special thanks to Dr. Xingang Chen, who is not only one of my previous dissertation committee members but also my friend. -

Ian J. M. Crossfield Appointments & Experience Education
Ian J. M. Crossfield http://www.mit.edu/∼iancross/ Massachusetts Institute of Technology, Physics Department [email protected] MIT Kavli Institute +1 949 923-0578 (USA) 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 Appointments & Experience MIT Department of Physics Assistant Professor 07/2017- present • Discovery of new planets using TESS, studying planets' atmospheres using HST and ground-based tele- scopes, new isotopic measurements of cool dwarfs. University of California, Santa Cruz Adjunct Professor 12/2017- present Associate Researcher 06/2017- 07/2017 Sagan Fellow 08/2016- 05/2016 • Continued the discovery of new planets using K2 and characterizing their atmospheres with ground- and space-based telescopes. U. Arizona, Lunar and Planetary Lab Sagan Fellow 07/2014 - 08/2016 • Work to understand hazy atmospheres of extrasolar objects: cloud properties and molecular abundances in known `super-Earth' planets; discovering new transiting planets with the K2 mission. Max Planck Institut f¨urAstronomie Postdoctoral Fellow 07/2012 - 06/2014 • Extrasolar planet atmosphere characterization via transits and secondary eclipses from ground- and space-based observatories. High-resolution spectroscopy of nearby brown dwarfs. University of California, Los Angeles Graduate Studies 09/2007 - 06/2012 • Characterization of exoplanet atmospheres via phase curves, secondary eclipses, and transits. Refined parameters of known transiting planets via optical transit photometry. NASA/Jet Propulsion Laboratory Systems Engineer 07/2004 - 06/2007 • High-contrast instrument performance simulations for the Gemini Planet Imager and TMT Planet For- mation Instrument. Optical testbed work for the Space Interferometry Mission. Exoplanet science. Education University of California, Los Angeles, Los Angeles, California USA • Ph.D., Astrophysics (Dissertation Year Fellow), 06/2012 Advisor: Prof. -
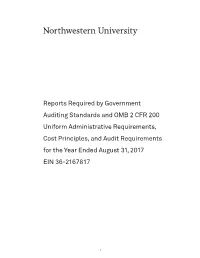
Reports Required by Government Auditing Standards and OMB 2 CFR 200 Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Au
Reports Required by Government Auditing Standards and OMB 2 CFR 200 Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for the Year Ended August 31, 2017 EIN 36-2167817 – 1 – NORTHWESTERN UNIVERSITY TABLE OF CONTENTS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2017 Report of Independent Auditors Page 3 Northwestern University Financial Statements Page 5 FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMS FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2017 Schedule of Expenditures of Federal Awards Page 33 Notes to the Schedule of Expenditures of Federal Awards Page 131 SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2017 Report of Independent Auditors on Internal Control Over Financial Reporting and on Compliance and Other Matters Based on an Audit of Financial Statements Performed in Accordance with Government Auditing Standards Page 133 Report of Independent Auditors on Compliance with Requirements That Could Have a Direct and Material Effect on Each Major Program and on Internal Control Over Compliance in Accordance with the Uniform Guidance Page 135 Schedule of Findings and Questioned Costs Page 137 Summary Schedule of Prior Audit Findings Page 140 Management’s Views and Corrective Action Plan Page 142 – 2 – Report of Independent Auditors To the Board of Trustees of Northwestern University: We have audited the accompanying consolidated financial statements of Northwestern University (the “University”), which comprise the consolidated statements of financial position as of August 31, 2017 and 2016, the related consolidated statement of activities for the year ended August 31, 2017 and of cash flows for the years ended August 31, 2017 and 2016, and the related notes to the financial statements. -

November 2016 BRAS Newsletter
NovemberOctober 20162016 IssueIssue th Next Meeting: Monday, November 14 at 7PM at HRPO (2nd Mondays, Highland Road Park Observatory) Join us at this meeting to celebrate BRAS’s 35th Anniversary. Several founding members will be there to help us remember and appreciate our history and achievements. What's In This Issue? President’s Message Secretary's Summary of October Meeting Outreach Report Light Pollution Committee Report Recent Forum Entries 20/20 Vision Campaign Messages from the HRPO The Edge of Night Fall Rocket Camp Observing Notes: Andromeda – The Chained Woman, by John Nagle & Mythology Newsletter of the Baton Rouge Astronomical Society November 2016 President’s Message November already! Holiday season, cold and long nights (all the better to observe under), and it is also the 35th anniversary of the founding of our organization, the Baton Rouge Astronomical Society, commonly called BRAS. At our meeting this month, to “celebrate” the anniversary, we will have cake and refreshments as some of the founders and first members of 35 years ago will regale us with the “story” of how BRAS came into existence, and some of its history. December’s meeting is our annual “pot luck” dinner and the election of officers for the next year. Be thinking about who you want as officers next year. Be prepared to nominate and/or second nominations. Also be prepared for a good meal. The first 3 members who told me they found the Witch Head Nebulae silhouette hidden in the October newsletter were Coy F. Wagoner, Robert Bourgeois, and Cathy Gabel. Congratulations, and well done. -
Transit Photometry of Recently Discovered Hot Jupiters Sean Peter Mccloat
University of North Dakota UND Scholarly Commons Theses and Dissertations Theses, Dissertations, and Senior Projects January 2017 Transit Photometry Of Recently Discovered Hot Jupiters Sean Peter Mccloat Follow this and additional works at: https://commons.und.edu/theses Recommended Citation Mccloat, Sean Peter, "Transit Photometry Of Recently Discovered Hot Jupiters" (2017). Theses and Dissertations. 2282. https://commons.und.edu/theses/2282 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, and Senior Projects at UND Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UND Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. TRANSIT PHOTOMETRY OF RECENTLY DISCOVERED HOT JUPITERS by Sean Peter McCloat Bachelor of Arts, SUNY Geneseo, 2013 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of North Dakota in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science Grand Forks, North Dakota December 2017 Copyright 2017 Sean Peter McCloat ii iii PERMISSION Title Transit Photometry of Recently Discovered Hot Jupiters Department Space Studies Degree Master of Science In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for a graduate degree from the University of North Dakota, I agree that the library of this University shall make it freely available for inspection. I further agree that permission for extensive copying for scholarly purposes may be granted by the professor who supervised my thesis work or, in his absence, by the Chairperson of the department of the dean of the School of Graduate Studies. It is understood that any copying or publication or other use of this thesis or part thereof for financial gain shall not be allowed without my written permission. -

OUTCOME of SIX CANDIDATE TRANSITING PLANETS from a Tres FIELD in ANDROMEDA Francis T
The Astrophysical Journal, 662:658–668, 2007 June 10 # 2007. The American Astronomical Society. All rights reserved. Printed in U.S.A. OUTCOME OF SIX CANDIDATE TRANSITING PLANETS FROM A TrES FIELD IN ANDROMEDA Francis T. O’Donovan,1 David Charbonneau,2,3 Roi Alonso,4 Timothy M. Brown,5 Georgi Mandushev,6 Edward W. Dunham,6 David W. Latham,2 Robert P. Stefanik,2 Guillermo Torres,2 and Mark E. Everett7 Received 2006 July 22; accepted 2007 February 7 ABSTRACT Driven by the incomplete understanding of the formation of gas giant extrasolar planets and of their mass-radius relationship, several ground-based, wide-field photometric campaigns are searching the skies for new transiting ex- trasolar gas giants. As part of the Trans-atlantic Exoplanet Survey (TrES), in 2003/2004 we monitored approximately 30,000 stars (9:5 V 15:5) in a 5:7 ; 5:7 field in Andromeda with three telescopes over 5 months. We identified six candidate transiting planets from the stellar light curves. From subsequent follow-up observations we rejected each of these as an astrophysical false positive, i.e., a stellar system containing an eclipsing binary, whose light curve mimics that of a Jupiter-sized planet transiting a Sunlike star. We discuss here the procedures followed by the TrES team to reject false positives from our list of candidate transiting hot Jupiters. We present these candidates as early examples of the various types of astrophysical false positives found in the TrES campaign, and discuss what we learned from the analysis. Subject headinggs: planetary systems — techniques: photometric — techniques: radial velocities 1. -
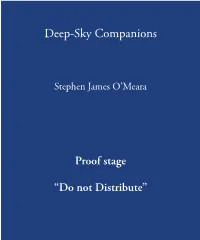
Deep-Sky Companions: the Messier Objects,Second Edition
Deep-Sky Companions Stephen James O’Meara Proof stage “Do not Distribute” DEEP-SKY COMPANIONS The Messier Objects, Second Edition The bright galaxies, star clusters, and nebulae cata- engaging and informative writing style and for his logued in the late 1700s by the famous comet hunter remarkable skills as a visual observer. O’Meara Charles Messier are still the most widely observed spent much of his early career on the editorial staff celestial wonders in the sky. The second edition of of Sky & Telescope before joining Astronomy mag- Stephen James O’Meara’s acclaimed observing guide azine as its Secret Sky columnist and a contribut- to the Messier objects features improved star charts ing editor. An award-winning visual observer, he for helping you find the objects, a much more robust was the first person to sight Halley’s comet upon telling of the history behind their discovery – includ- its return in 1985 and the first to determine visu- ing a glimpse into Messier’s fascinating life – and ally the rotation period of Uranus. One of his most updated astrophysical facts to put it all into con- distinguished feats was the visual detection of text. These additions, along with new photos taken the mysterious spokes in Saturn’s B-ring before with the most advanced amateur telescopes, bring spacecraft imaged them. Among his achieve- O’Meara’s first edition more than a decade into the ments, O’Meara has received the prestigious Lone twenty-first century. Expand your universe and test Stargazer Award, the Omega Centauri Award, and your viewing skills with this truly modern Messier the Caroline Herschel Award. -

230Th AAS Session Table of Contents
230th AAS Austin, TX – June, 2017 Meeting Abstracts Session Table of Contents 100 – Welcome Address by AAS President Christine Jones (Harvard-Smithsonian, CfA) 101 – Kavli Foundation Lecture: Dark Matter in the Universe, Katherine Freese (University of Michigan) 102 – Extrasolar Planets: Detection and Future Prospects 103 – Instrumentation, and Things to do with Instrumentation: From the Ground 104 – Topics in Astrostatistics 105 – Inner Solar Systems: Planet Compositions as Tracers of Formation Location 106 – Annie Jump Cannon Award: Origins of Inner Solar Systems, Rebekah Dawson (Penn State University) 108 – Astronomy Education: Research, Practice, and Outreach Across the Human Continuum 109 – Bridging Laboratory & Astrophysics: Atomic Physics 110 – Preparing for JWST Observations: Insights from First Light and Assembly of Galaxies GTO Programs I 111 – Inner Solar Systems: Super-Earth Orbital Properties: Nature vs. Nurture 112 – Plenary Talk: The Universe's Most Extreme Star-forming Galaxies, Caitlin Casey (University of Texas, Austin) 113 – Plenary Talk: Science Highlights from SOFIA, Erick Young (USRA) 114 – Preparing for JWST Observations Poster Session 115 – Astronomy Education: Research, Practice, and Outreach Across the Human Continuum Poster Session 116 – Societal Matters Poster Session 117 – Instrumentation Poster Session 118 – Extrasolar Planets Poster Session 119 – The Solar System Poster Session 200 – LAD Plenary Talk: The Rosetta Mission to Comet 67P/ Churyumov-Gerasimenko, Bonnie Buratti (JPL) 201 –