Traumaverarbeitung in Kriegsfilmen“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE MESSENGER Press Kit October 2010
presents THE MESSENGER Starring BEN FOSTER, WOODY HARRELSON, SAMANTHA MORTON, JENA MALONE, STEVE BUSCEMI, EAMONN WALKER Written by ALESSANDRO CAMON & OREN MOVERMAN Produced by MARK GORDON, LAWRENCE INGLEE, ZACH MILLER www.madman.com.au/incinemas Release date: November 11th 2010 Running time: 112 minutes Rating: MA NATIONAL PUBLICITY: Shelley Watters Theatrical Communications Manager Madman Cinema t: 03 9419 5444 m: 0415 901 440 e: [email protected] THE MESSENGER SYNOPSIS In his most powerful performance to date, Ben Foster stars as Will Montgomery, a U.S. Army officer who has just returned home from a tour in Iraq and is assigned to the Army’s Casualty Notification service. Partnered with fellow officer Tony Stone (Woody Harrelson in an Oscar Nominated performance) to bear the bad news to the loved ones of fallen soldiers, Will faces the challenge of completing his mission while seeking to find comfort and healing back on the home front. When he finds himself drawn to Olivia (Samantha Morton), to whom he has just delivered the news of her husband's death, Will’s emotional detachment begins to dissolve and the film reveals itself as a surprising, humorous, moving and very human portrait of grief, friendship and survival. Featuring tour-de-force performances from Foster, Harrelson and Morton, and a brilliant directorial debut by Moverman, THE MESSENGER brings us into the inner lives of these outwardly steely heroes to reveal their fragility with compassion and dignity. ABOUT THE PRODUCTION IT STARTS WITH THE SCRIPT Like so many memorable films, everything begins with the script. THE MESSENGER came together after Los Angeles-based producer Alessandro Camon (THE COOLER, THANK YOU FOR SMOKING, AMERICAN PSYCHO) suggested to Oren Moverman, that he write a screenplay about casualty notification officers. -
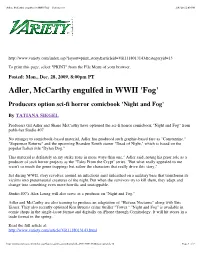
Adler, Mccarthy Engulfed in WWII 'Fog' - Variety.Com 1/4/10 12:03 PM
Adler, McCarthy engulfed in WWII 'Fog' - Variety.com 1/4/10 12:03 PM http://www.variety.com/index.asp?layout=print_story&articleid=VR1118013143&categoryid=13 To print this page, select "PRINT" from the File Menu of your browser. Posted: Mon., Dec. 28, 2009, 8:00pm PT Adler, McCarthy engulfed in WWII 'Fog' Producers option sci-fi horror comicbook 'Night and Fog' By TATIANA SIEGEL Producers Gil Adler and Shane McCarthy have optioned the sci-fi horror comicbook "Night and Fog" from publisher Studio 407. No stranger to comicbook-based material, Adler has produced such graphic-based fare as "Constantine," "Superman Returns" and the upcoming Brandon Routh starrer "Dead of Night," which is based on the popular Italian title "Dylan Dog." This material is definitely in my strike zone in more ways than one," Adler said, noting his prior role as a producer of such horror projects as the "Tales From the Crypt" series. "But what really appealed to me wasn't so much the genre trappings but rather the characters that really drive this story." Set during WWII, story revolves around an infectious mist unleashed on a military base that transforms its victims into preternatural creatures of the night. But when the survivors try to kill them, they adapt and change into something even more horrific and unstoppable. Studio 407's Alex Leung will also serve as a producer on "Night and Fog." Adler and McCarthy are also teaming to produce an adaptation of "Havana Nocturne" along with Eric Eisner. They also recently optioned Ken Bruen's crime thriller "Tower." "Night and Fog" is available in comic shops in the single-issue format and digitally on iPhone through Comixology. -

2012 Twenty-Seven Years of Nominees & Winners FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDS
2012 Twenty-Seven Years of Nominees & Winners FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDS BEST FIRST SCREENPLAY 2012 NOMINEES (Winners in bold) *Will Reiser 50/50 BEST FEATURE (Award given to the producer(s)) Mike Cahill & Brit Marling Another Earth *The Artist Thomas Langmann J.C. Chandor Margin Call 50/50 Evan Goldberg, Ben Karlin, Seth Rogen Patrick DeWitt Terri Beginners Miranda de Pencier, Lars Knudsen, Phil Johnston Cedar Rapids Leslie Urdang, Dean Vanech, Jay Van Hoy Drive Michel Litvak, John Palermo, BEST FEMALE LEAD Marc Platt, Gigi Pritzker, Adam Siegel *Michelle Williams My Week with Marilyn Take Shelter Tyler Davidson, Sophia Lin Lauren Ambrose Think of Me The Descendants Jim Burke, Alexander Payne, Jim Taylor Rachael Harris Natural Selection Adepero Oduye Pariah BEST FIRST FEATURE (Award given to the director and producer) Elizabeth Olsen Martha Marcy May Marlene *Margin Call Director: J.C. Chandor Producers: Robert Ogden Barnum, BEST MALE LEAD Michael Benaroya, Neal Dodson, Joe Jenckes, Corey Moosa, Zachary Quinto *Jean Dujardin The Artist Another Earth Director: Mike Cahill Demián Bichir A Better Life Producers: Mike Cahill, Hunter Gray, Brit Marling, Ryan Gosling Drive Nicholas Shumaker Woody Harrelson Rampart In The Family Director: Patrick Wang Michael Shannon Take Shelter Producers: Robert Tonino, Andrew van den Houten, Patrick Wang BEST SUPPORTING FEMALE Martha Marcy May Marlene Director: Sean Durkin Producers: Antonio Campos, Patrick Cunningham, *Shailene Woodley The Descendants Chris Maybach, Josh Mond Jessica Chastain Take Shelter -

Di HERMAN KOCH Durata: 120 Minuti USCITA: 18 Maggio
presenta THE DINNER scritto e diretto da OREN MOVERMAN dal bestseller internazionale “LA CENA” di HERMAN KOCH Durata: 120 minuti USCITA: 18 Maggio US UFFICIO STAMPA Via Pierluigi Giovanni Da Palestrina, 47, 00193 Roma, ☎ +39 06916507804 Alessandro +39 3493127219 [email protected] | Valerio +39 3357081956 [email protected] I materiali sono disponibili sul sito www.us-ufficiostampa.it DIGITAL PR – B STUDIO Via dei Volsci 123°, 00185 Roma +39 0687770618 [email protected] DISTRIBUZIONE VIDEA Via Livigno, 50 - 00188 Roma - Tel 06.331851 [email protected] - www.videaspa.it 2 www.youtube.com/videa - www.twitter.com/videaspa www.facebook.com/videa THE DINNER CAST ARTISTICO Stan Lohman RICHARD GERE Claire Lohman LAURA LINNEY Paul Lohman STEVE COOGAN Katelyn Lohman REBECCA HALL Nina ADEPERO ODUYE Dylan Heinz MICHAEL CHERNUS Michael Lohman CHARLIE PLUMMER Barbara Lohman CHLOË SEVIGNY Rick Lohman SEAMUS DAVEY-FITZPATRICK Beau Lohman MILES J. HARVEY Antonio JOEL BISSONNETTE Anna LAURA HAJEK Moriah (senzatetto) ONIKA DAY Beau (bambino) JUDAH SANDRIGE Michael (bambino) JESSE DEAN PETERSON Rick (bambino) BENJAMIN SNYDER Val Lohman EMMA MUD Gettysburg Narrator STEPHEN LANG Kamryn Velez TAYLOR RAE ALMONTE Stephen Whitney GEORGE SHEPHARD 3 THE DINNER CAST TECNICO Scritto e diretto da OREN MOVERMAN Basato sul romanzo di HERMAN KOCH Prodotto da COTTY CHUBB LAWRENCE INGLEE EDDIE VAISMAN JULIA LEBEDEV Line Producer ALLISON ROSE CARTER Produttori Esecutivi LEONID LEBEDEV ANGEL LOPEZ OLGA SEGURA EVA MARIA DANIELS Direttore della Fotografia BOBBY BUKOWSKI Scenografia KELLY McGEHEE Montaggio ALEX HALL Costumi CATHERINE GEORGE Produttore musicale HAL WILLNER Supervisore alle Musiche RACHEL FOX Casting LAURA ROSENTHAL JODI ANGSTREICH MARIBETH FOX 4 THE DINNER Sinossi breve Una cena tra due fratelli con le rispettive mogli in un ristorante di lusso fa venire a galla un orribile segreto. -

RAMPART Textes DP
METROPOLITAN FILMEXPORT présente Un film Sierra Affinity Un film d’Oren Moverman RAMPART Woody Harrelson Robin Wright Sigourney Weaver Ice Cube Ben Foster Ned Beatty Steve Buscemi Cynthia Nixon Anne Heche Scénario : James Ellroy et Oren Moverman Un film produit par Lawrence Inglee, Clark Peterson, Ben Foster, Ken Kao Durée : 1h47 Sortie : 3 juillet 2013 Notre nouveau portail est à votre disposition. Inscrivez-vous à l’espace pro pour récupérer le matériel promotionnel du film sur : www.metrofilms.com Distribution : Relations presse : METROPOLITAN FILMEXPORT BOSSA -NOVA 29 rue Galilée - 75116 Paris Michel BURSTEIN Tél. 01 56 59 23 00 32 boulevard St Germain - 75005 Paris Fax 01 53 57 84 02 Tél. 01 43 26 26 26 info@metropolitan -films.com [email protected] Programmation : www.bossa -nova.info Tél. 01 56 59 23 25 1 L’HISTOIRE L’officier de police Dave Brown est connu depuis toujours pour ses méthodes expéditives et sa tendance à franchir toutes les lignes. Lorsque la vidéo d’une raclée qu’il administre à un suspect se retrouve sur toutes les chaînes de télé, tout le monde se décide à lui faire payer l’addition. Face au scandale qui pourrait mettre en lumière les pratiques douteuses de la police, ce spécialiste des excès en tous genres fera un magnifique exemple… Coincé entre sa hiérarchie, ses ex-femmes, ses filles et ses peurs qu’il cache comme il peut, Brown va être écrasé, broyé, poussé à bout pour n’être plus que lui- même, loin de son arrogance et de ses méthodes de cow-boy. -

The Messenger AMREEKA Let's Make Money
The Messenger AMREEKA Let’s Make Money Director(s): Director(s): Director(s): Oren Moverman Cherien Dabis Erwin Wagenhofer Screenwriter(s): Screenwriter(s): Editor: Oren Moverman, Alessandro Cherien Dabis Paul M. Sedlacek Camon Executive Producers: Music: Producers: Alicia Sams, Cherien Dabis Helmut Neugebauer Mark Gordon, Lawrence Inglee, Producers: Sound: Zach Miller Christina Piovesan, Paul Barkin Lisa Ganser Coproducer: Coproducers: Consultant: Gwen Bialic Liz Jarvis, Al-Zain Al-Sabah Corinna Milborn Production Designer: Cinematographer: Assistant Director: Steven Beatrice Tobias Datum Lisa Ganser Composer: Editor: Nathan Larson Keith Reamer Sound: Composer: Leslie Shatz, Javier Bennassar Kareem Roustom Editor: Alex Hall 87 Afghanistan/United Kingdom, 2008 US Narrative Feature Films US Narrative Feature U.S.A. 2009, 84 mins, color International Films Documentary Feature mins., color Intl Documentary Short United Kingdom, 2008, 10 mins., color , First Thursday. September 3 2009. 7pm First Thursday. November 5 2009. 7pm First Thursday. November 5 2009. 7pm With three months left in the service, Will (Ben Foster) has spent Director Cherien Dabis’s auspicious debut feature, Amreeka, is a Erwin Wagenhofer has crafted a momentous and chilling work of report- a good deal of time in army hospitals, healing scars from his warm and lighthearted film about one Palestinian family’s tumultu- age in this documentary that maps and analyzes the contemporary time in Iraq. To make things worse, the girl he left behind (Jena ous journey into Diaspora amidst the cultural fallout of America’s global financial system.Shuttled around the world in private limousines Malone) has moved on with her life. Ironically, his chance at a war in Iraq. -

A Film by Anja Marquardt 2014 / USA / English / Drama 90 Min/ HD / 16:9 / Dolby 5.1
A FILM BY ANJA MARQUARDT 2014 / USA / English / Drama 90 min/ HD / 16:9 / Dolby 5.1 173 Richardson Street, Brooklyn, NY 11222 Office: +1.718.312.8210 Fax: +1.718.362.4865 Email: [email protected] Web: www.monumentreleasing.com LOGLINE DIRECTOR’S STATEMENT The professional and personal life of a sexual surrogate begins to unravel when she starts working She’s Lost Control started as a sci-fi thriller. I had read an article about a Japanese geriatrics facility with a new client. that uses robots not only to lift and feed patients, but also to “caress” them. As a result they were less aggressive and better able to sleep. Around the same time I heard about present-day surrogate SHORT SYNOPSIS partner therapy – a subculture of trained clinicians who teach their clients how to be intimate, sexual Fiercely independent, Ronah works as a sexual surrogate in New York City, teaching her clients the intercourse included. very thing they fear most – to be intimate. Her life unravels when she starts working with a volatile There is something fascinating and unsettling and also deeply moving about the idea that intimacy new client, Johnny, blurring the thin line between professional and personal intimacy in the modern can be taught, or simulated. It puts a magnifying glass on the basic human need (and inability) to world. connect. As I was exploring Ronah, the film’s protagonist, it soon became clear that what I was re- ally interested in was her “professional intimacy.” The inevitable blurring of lines is what I set out to FESTIVALS explore. -

34 Years of Nominees and Winners 2019 Nominees (Winners in Bold)
34 Years of Nominees and Winners 2019 Nominees (Winners in bold) BEST FEATURE JOHN CASSAVETES AWARD BEST MALE LEAD (Award given to the producer) (Award given to the best feature made for under *ETHAN HAWKE - First Reformed $500,000; award given to the writer, director, *IF BEALE STREET COULD TALK and producer) JOHN CHO - Searching PRODUCERS: Dede Gardner, Barry Jenkins, Jeremy Kleiner, Sara Murphy, Adele Romanski *EN EL SÉPTIMO DÍA DAVEED DIGGS - Blindspotting WRITER/DIRECTOR/PRODUCER: Jim McKay CHRISTIAN MALHEIROS - Sócrates EIGHTH GRADE PRODUCERS: Alex Bach, Lindsey Cordero, PRODUCERS: Eli Bush, Scott Rudin, Christopher Storer, JOAQUIN PHOENIX - You Were Never Really Here Caroline Kaplan, Michael Stipe Lila Yacoub A BREAD FACTORY BEST SUPPORTING FEMALE FIRST REFORMED WRITER/DIRECTOR/PRODUCER: Patrick Wang PRODUCERS: Jack Binder, Greg Clark, Gary Hamilton, *REGINA KING - If Beale Street Could Talk PRODUCERS: Daryl Freimark, Matt Miller Victoria Hill, David Hinojosa, Frank Murray, Deepak Sikka, KAYLI CARTER - Private Life Christine Vachon NEVER GOIN’ BACK WRITER/DIRECTOR: Augustine Frizzell TYNE DALY - A Bread Factory LEAVE NO TRACE PRODUCERS: Liz Cardenas, Toby Halbrooks, PRODUCERS: Anne Harrison, Linda Reisman, THOMASIN HARCOURT MCKENZIE - Leave No Trace James M. Johnston Anne Rosellini J. SMITH-CAMERON - Nancy SÓCRATES YOU WERE NEVER REALLY HERE WRITER/DIRECTOR/PRODUCER: Alex Moratto BEST SUPPORTING MALE PRODUCERS: Rosa Attab, Pascal Caucheteux, WRITER: Thayná Mantesso Rebecca O’Brien, Lynne Ramsay, James Wilson *RICHARD E. GRANT - Can You Ever Forgive Me? PRODUCERS: Ramin Bahrani, Jefferson Paulino, Tammy Weiss RAÚL CASTILLO - We the Animals BEST FIRST FEATURE (Award given to the director and producer) THUNDER ROAD ADAM DRIVER - BLACKkKLANSMAN WRITER/DIRECTOR: Jim Cummings JOSH HAMILTON - Eighth Grade *SORRY TO BOTHER YOU PRODUCERS: Natalie Metzger, Zack Parker, DIRECTOR: Boots Riley Benjamin Weissner JOHN DAVID WASHINGTON - Monsters and Men PRODUCERS: Nina Yang Bongiovi, Jonathan Duffy, Charles D. -

2011 Product Guide
Digital Platform AFM 2011 THEEstablished in 1980 tm SCREENING M TODAY L I F WEDNESDAY F O NOV 2 Contact Us Media Kit Submission Form Magazine Editions Editorial Comments Link to AFM Website THR.com Variety.com Screendaily.com Le Film Francais.com Trailers BUSINESS READ The Synopsis SYNOPSISandTRAILERS.com WATCH The Trailer The One-Stop Viewing Platform CONNECT To Seller click to view INNOVATION FIRST The Business of Film (TBOF) revolutionizes Film Trade Publishing again! DOWNLOAD THE QR READER APP to your Smartphone or iPad TODAY & START NOW at AFM a NEW way of VIEWING AVAILABLE CONTENT www.SynopsisAndTrailers.com for DISTRIBUTION PLATFORMS in your Territory Scan the QR code above using Barcode TBOF enables YOU as A BUYER Scanner on your ipad or smartphone and the TO TAKE MORE CONTROL link will be instantly Maximize YOUR Time Efficiently at AFM. accessible on your phone. The Business of Film — Thinking Forward www.synopsisandtrailers.com /AFM2011ProductGuide /AFMProductGuide.pdf Scan any of these Source - Select - Download QR codes using Barcode Powered by Scanner on your ipad Nu Image Millenium Films or smartphone and the link will be instantly accessible AFM 2011 TheWIFTS on your phone. Trailer Trailer Bumper Edition Foundation First Hand Films NonStop Films AFM PRODUCTPRODUCTwww.thebusinessoffilmdaily.comGUIDEGUIDE JOSE AND PILAR THE HAPPETS home. AKA: JOSE Y PILAR AKA: LA TROPA DE TRAPO YOUNG ONES Documentary (125 min) Animation (85 min) Thriller A Language: Portuguese, spanish Language: Spanish Language: English 6 SALES Director: Miguel Goncalves Mendes Director: Alex Colls Director: Jake Paltrow 6 Sales, Alto de las cabanas 5, Las Writer: Miguel Goncalves Mendes Writer: Lola Beccaria Writer: Jake Paltrow Rozas, Madrid 28231 Spain, Tel: Co-Production Partners: Jumpcut2011Co-Production Partners: Abano Producer: ARCADIA, 982 +34.91.636.10.54 Fax: Producer: Miguel Goncalves Mendes Producions, Anera Films, Continental Delivery Status: Pre-Production +34.91.710.35.93. -

Rampart ”Woody Harrelson Är Strålande” Variety
THE MOST CORRUPT COP YOU’VE EVER SEEN ON SCREEN RAMPART ”WOODY HARRELSON ÄR STRÅLANDE” VARIETY RAMPART är en hårdkokt thriller skriven av genrens mästare James Ellroy, där Woody Harrelson återförenas med regissören Oren Moverman efter den Oscarnominerade The Messenger. Harrelsson backas upp av Sigourney Weaver, Steve Buscemi, Robin Wright, Anne Heche, Cynthia Nixon, Ben Foster, Ice Cube och Ned Beatty. Dave Brown ger uttrycket ”bad cop” ett ansikte. Han är våldsam, fördomsfull, på gränsen till kriminell och tror stenhårt på bilden av sig själv som de svagas beskyddare. Tumultet och korruptionen har nått bristningsgränsen inom Los Angelespolisen och när Brown misshandlar en misstänkt på WOODYHARRELSON öppen gata och smygfi lmas klipps skyddsnäten som tidigare alltid fångat upp honom. Nu står han ensam i ett inferno av byråkrater som vill åt honom, en familj som vänder honom ryggen och lösa sexmöten i en värld där han inte kan lita på någon. Nu är den enda vägen nedåt. LIGHTSTREAM PICTURES PRESENTS A WAYPOINT ENTERTAINMENT PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH THE THIRD MIND PICTURES AND SIERRA PICTURES “RAMPART” WOODY HARRELSON NED BEATTY BEN FOSTER ANNE HECHE ICE CUBE CYNTHIA NIXON SIGOURNEY WEAVER ROBERT WISDOM ROBIN WRIGHT AND STEVE BUSCEMI CASTING BY LAURA ROSENTHAL AND RACHEL TENNER MUSIC SUPERVISOR JIM BLACK MUSIC BY DICKON HINCHLIFFE COSTUME DESIGNER CATHERINE GEORGE EDITED BY JAY RABINOWITZ, A.C.E. PRODUCTION DESIGNER DAVID WASCO DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY BOBBY BUKOWSKI CO-PRODUCER LUCA BORGHESE EXECUTIVE PRODUCERS MICHAEL DEFRANCO LILA YACOUB MARK GORDON PAUL CURRIE GARRETT KELLEHER PRODUCED BY LAWRENCE INGLEE CLARK PETERSON BEN FOSTER KEN KAO WRITTEN BY JAMES ELLROY AND OREN MOVERMAN DIRECTED BY OREN MOVERMAN RAMPART (2011) 108 MIN THRILLER ENGELSKA TEXT RAMPART NED BEN ANNE ICE CYNTHIA SIGOURNEY ROBIN STEVE HIGH DEFINITION ––––––––––––––––––––––––––––– BEATTY FOSTER HECHE CUBE NIXON WEAVER WRIGHT AND BUSCEMI 2.35:1 1080 p / 24 PsF RÄTTIGHETERNA TILL DETTA PROGRAM TILLHÖR NOBLE ENTERTAINMENT AB. -
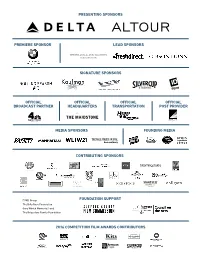
FINAL-Hiffcat2016-Compressed.Pdf
PRESENTING SPONSORS premiere SPONSOR LEAD SPONSORS SIGNATURE SPONSORS OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL BROADCAST PARTNER HEADQUARTERS TRANSPORTATION POST PROVIDER MEDIA SPONSORS FOUNDING MEDIA CONTRIBUTING SPONSORS FOND Group FounDAtion Support The Billy Rose Foundation Gary Winick Memorial Fund The Brizzolara Family Foundation 2016 Competition Film AWARDS Contributors Arenson Props T:7.75” The BMW 7 Series bmwusa.com T:9.75” THE BMW 7 SERIES. THE MOST INNOVATIVE VEHICLE IN ITS CLASS. Experience uncompromised luxury and cutting-edge technology, with 13 innovations found in no other luxury vehicle. And with its lighter Carbon Core frame and 445-horsepower* engine, this BMW delivers exactly the kind of performance you’d expect from the Ultimate Driving Machine.® *445 horsepower based on the 750i xDrive Sedan. ©2016 BMW of North America, LLC. The BMW name, model names and logo are registered trademarks. BMWN16KB0079 – BMWQ1ERP18 – THE BMW 7 SERIES. – LHP FINAL MECHANICAL! ANY FURTHER CHANGES PUB TRIM LIVE BLEED Insertion Date Due Date MAY AFFECT RELEASE DATE! HAMPTONS FILM FESTIVAL 7.5 x 9.75 - - PROG 9/1 PDF/X-1a via FTP + E-mail followup [NO proof ] CLIENT BMW of North America Filename BMWN16KB0079_ERP18_7S_1.indd Job Mgr.# 12090 Last Date 8-31-2016 4:55 PM Fonts Doc. Path Description FP Non-Bleed LHP Prod. Mgr. D. McMurray BMW Type Global Pro (Bold, Regular), Helvetica (Bold) StudioMechanicals2:Volumes:Studio- Bleed None Art Director - Mechanicals2:BMW: Final Mechani- cals:BMWN16KB0079 2016 Feb-Dec Trim 7.75” x 9.75” Acct. Mgr. Sydney Shatsky Ti...M 12090:BMWQ1ERP18 7 Series Luxury Portfolio HAMPTONS FILM Live None Copy Writer - FESTIVAL - LHP:BMWN16KB0079_ER- Gutter - (Folds: None) Studio Oper. -

Cinema: Opinião Pública E O Mito Da Guerra
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IRAQUE EM CENA: CINEMA, OPINIÃO PÚBLICA E O MITO DA GUERRA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Maria Clara Ferreira Leite Garcia Orientador: Prof. Dr. Paulo Knauss. Niterói 2013 2 MARIA CLARA FERREIRA LEITE GARCIA IRAQUE EM CENA: CINEMA, OPINIÃO PÚBLICA E O MITO DA GUERRA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH/UFF), como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Orientador: Prof. Dr. Paulo Knauss. Niterói 2013 3 Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá G216 Garcia, Maria Clara Ferreira Leite. Iraque em cena: cinema, opinião pública e o mito da guerra nos Estados Unidos da América / Maria Clara Ferreira Leite Garcia. – 2013. 215 f. Orientador: Paulo Knauss de Mendonça. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2013. Bibliografia: f. 196-211. 1. Cinema americano. 2. Filme de guerra. 3. Mito. 4. Opinião pública. 5. Guerra do Iraque, 2003. I. Mendonça, Paulo Knauss de. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. III. Título. CDD 791.430973 4 MARIA CLARA FERREIRA LEITE GARCIA IRAQUE EM CENA: CINEMA, OPINIÃO PÚBLICA E O MITO DA GUERRA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH/UFF), como requisito