Begegnungen Mit Inge Borkh
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

07 – Spinning the Record
VI. THE STEREO ERA In 1954, a timid and uncertain record industry took the plunge to begin investing heav- ily in stereophonic sound. They were not timid and uncertain because they didn’t know if their system would work – as we have seen, they had already been experimenting with and working the kinks out of stereo sound since 1932 – but because they still weren’t sure how to make a home entertainment system that could play a stereo record. Nevertheless, they all had their various equipment in place, and so that year they began tentatively to make recordings using the new medium. RCA started, gingerly, with “alternate” stereo tapes of monophonic recording sessions. Unfortunately, since they were still uncertain how the results would sound on home audio, they often didn’t mark and/or didn’t file the alternate stereo takes properly. As a result, the stereo versions of Charles Munch’s first stereo recordings – Berlioz’ “Roméo et Juliette” and “Symphonie Fanastique” – disappeared while others, such as Fritz Reiner’s first stereo re- cordings (Strauss’ “Also Sprach Zarathustra” and the Brahms Piano Concerto No. 1 with Ar- thur Rubinstein) disappeared for 20 years. Oddly enough, their prize possession, Toscanini, was not recorded in stereo until his very last NBC Symphony performance, at which he suf- fered a mental lapse while conducting. None of the performances captured on that date were even worth preserving, let alone issuing, and so posterity lost an opportunity to hear his last half-season with NBC in the excellent sound his artistry deserved. Columbia was even less willing to pursue stereo. -

Phonographie PETER MAAG, Seite 2 &
Peter Maag (geboren am 10. Mai 1919 in St. Gallen) (gestorben am 16. April 2001 in Verona) 1 PHONOGRAPHIE · Erfassungsstand: 13. Oktober 2013 Í Abkürzungen: Ob Oboe A Alt OSI Orchestra della Svizzera Italiana, Lugano AD Aufnahmedatum OSR Orchestre de la Suisse Romande, Genf AGF Archiv Gert Fischer, Heidmoor (auch: CD- OVW Orchester der Volksoper Wien Serie „Freundesgaben“) PhilHung Philharmonia Hungarica, Marl BambS Bamberger Symphoniker POV Philharmonisches Orchester von Veneto Bar. Bariton PrNTO Orchester des Prager National-Theaters BernSO Berner Symphonieorchester RAI Rom Orchestra Sinfonica di Torino della BK Bandkopie Radiotelevisione Italiana (RAI) BM Bandmitschnitt RAI Turin Orchestra Sinfonica di Torino della BSO Basler Sinfonie-Orchester Radiotelevisione Italiana (RAI) CD CompactDisc [auch ~] RPH Radio-Philharmonie Hannover des NDR COP Orchestre de la Société des Concerts du (vordem: Rundfunkorchester Hannover des Conservatoire, Paris NDR) DVD Digital Versatile Disc RSO Basel Radio-Sinfonieorchester Basel HD-Rec Mit-/ Umschnitt auf Festplatte (> AGF) SFO Stockholms Filharmoniska Orkester Hr. Horn SO-BOG Symphonieorchester der Basler Klar. Klarinette Orchestergesellschaft Kl. Klavier SO des BR Symphonie-Orchester des Bayerischen KRSO Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester Rundfunks, München LP Langspielplatte (St) Stereo LSO London Symphony Orchestra TschPh Tschechische Philharmonie, Prag (m) mono TschPhCh Tschechischer Philharmonischer Chor, Prag Mez. Mezzosopran V. Violine NPO New Philharmonia Orchestra, London Va. Viola NSOL New Symphony Orchestra of London ~ Compact Disc NYCSO New York Chamber Symphony Orchestra ] 1 Die nachstehend aufgeführten Aufnahmen Peter Maags widerspiegeln den aktuellen Bestand im Schallarchiv Gert Fischer, Heidmoor. Vollständigkeit ist weder beabsichtigt noch wahrscheinlich tatsächlich erreichbar. - Die mit _ gekennzeichneten Aufnahmen liegen nur im Archiv von Dr. Christoph Winzeler, Basel, vor. -

Deutsche Nationalbibliografie 2018 T 11
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 T 11 Stand: 07. November 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201711171918 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

Ariadne Auf Naxos
La natura és l'origen de totes les coses bones. Yoghourts, flams, cremes, formatges. —aliments frescos i naturals— GRAN TEATRE DEL LICEU Temporada d'òpera 1983/84 CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU CENERALHAT DE CATALUNYA AJUNTAMENT DE BARCELONA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Ptas.1,949.480PRECIO: decirfaltahaceNomás dynamicThecar BRITISH Tels. Tels. S.A.MOTORS, 46-48Gervasio.SanP.»VENTAS:YEXPOSICION Q38211373124797- 36Calabna,RECAMBIOS:YTALLERES BARCELONA242922314-- ARIADIME AUF IMAXOS òpera en 1 pròleg i 1 acte Llibret d'Hugo von Hofmannsthal Miisica de Richard Strauss Funció de Gala Dijous, 12 de gener de 1984, a les 21 h., funció núm. 23, torn B Diumenge, 15 de gener de 1984, a les 17 h., funció núm. 24, torn T Dimecres, 18 de gener de 1984, a les 21 h., funció núm. 25, torn A GRAN TEATRE DEL LICEU Barcelona HïïVÜS ^ROSSO^ fWlW^ATI martini & ROSSI Un Martini invitaavivir [martini ARIADNE AUF NAXOS El majordom (part parlada): Hans Christian Un mestre de miisica: Ernst Gutstein El compositor: Alicia Nafé Bacchus: Klaus Koening Un oficial: Alfredo Heilbron Un mestre de ball: Wolf Appel Un perruquer: Steven Kimbrough Un lacai: Alfred Werner Zerbinetta: Celina Lindsley Ariadne: Montserrat Caballé Arlequí: Georg Tichy Scaramuccio: Ernst Dieter Suttheimer Truffaldin: Ude Krekow Brighella: Wolf Appel Echo: Downing Whitesell Najade: Agnes Habereder Dryade: Ingrid Mayr Director d'orquestra: János Kulka Director d'escena: Mario Kriiger Violí concertino: Josep M." Alpiste Producció: Staatstheater - Braunschweig (R.F.A.) ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Comentaris a càrrec dels Drs. Roger Alier, Xosé Aviñoa i Oriol Martorell, del Departament d'Art de la Universitat de Barcelona. -

Inge Borkh – Sängerin Und Schauspielerin Elektra, Salome Und Was Kommt Noch?
Oktober 2011 Bock’s Music Shop e.U. Agentur–Handel–Produktion & Vertrieb 1130 Wien (Europe), Glasauergasse 14/3 Tel.- u. Fax: (+43-1)877-89-58 [email protected] www.bocksmusicshop.at Inge Borkh – Sängerin und Schauspielerin Elektra, Salome und was kommt noch? (Foto ©: Uwe Sickinger) Bock Productions und das Haus Hofmannsthal laden ein! ELEKTRA, SALOME UND WAS KOMMT NOCH? Ein Abend für und mit Frau Inge Borkh Inge Borkh im Gespräch mit Markus Vorzellner Weinverkostung vom Weingut Leopold Fürnkranz. Freitag, 21. Oktober 2011, 19:30 Uhr Haus Hofmannsthal 1030 Wien, Reisnerstraße 37 (Tel.: 01/714-85-33) Das Unglaubliche wird wahr: Inge Borkh , die faszinierende Sopranistin mit dunkler Timbrierung und erfri- schender Eloquenz wird einen ganzen Abend lang aus ihrem Leben erzählen. Begleitet von Ton- und Filmaufnahmen tauchen wir ein in eine vergangen geglaubte faszinierende Welt, die doch frischer und lebendiger zu sein scheint als so manche Retortenstars der unmittelbaren Gegenwart. Salome, Elektra, Tiefland und ... mehr sei nicht verraten. BOCK'S MUSIC SHOP Seite 1 Newsletter Inge Borkh CDs und Bücher von und mit Inge Borkh Borkh, Inge / Voigt, Thomas - Nicht nur Salome und Elektra (Inge Borkh im Gespräch mit Thomas Voigt) Sie gehört zu den großen Legenden der Oper. Ihre Aufnahmen sind Kult. In diesem Buch erzählt Inge Borkh ihre Geschichte: siebzig Theaterjahre, randvoll mit Erfolgen und Enttäuschungen, Herausforderungen und Schwierigkeiten. In Gesprächen mit dem Musikjournalisten Thomas Voigt schildert Inge Borkh ihr Leben als Schauspielerin, Sopranistin, Diseuse und Lehrerin. Ein Leben für das Theater, reflektiert von in- tensiver Beschäftigung mit Religion und Philosophie, kommentiert mit Selbstironie und Humor. -

Staged Treasures
Italian opera. Staged treasures. Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini and Gioacchino Rossini © HNH International Ltd CATALOGUE # COMPOSER TITLE FEATURED ARTISTS FORMAT UPC Naxos Itxaro Mentxaka, Sondra Radvanovsky, Silvia Vázquez, Soprano / 2.110270 Arturo Chacon-Cruz, Plácido Domingo, Tenor / Roberto Accurso, DVD ALFANO, Franco Carmelo Corrado Caruso, Rodney Gilfry, Baritone / Juan Jose 7 47313 52705 2 Cyrano de Bergerac (1875–1954) Navarro Bass-baritone / Javier Franco, Nahuel di Pierro, Miguel Sola, Bass / Valencia Regional Government Choir / NBD0005 Valencian Community Orchestra / Patrick Fournillier Blu-ray 7 30099 00056 7 Silvia Dalla Benetta, Soprano / Maxim Mironov, Gheorghe Vlad, Tenor / Luca Dall’Amico, Zong Shi, Bass / Vittorio Prato, Baritone / 8.660417-18 Bianca e Gernando 2 Discs Marina Viotti, Mar Campo, Mezzo-soprano / Poznan Camerata Bach 7 30099 04177 5 Choir / Virtuosi Brunensis / Antonino Fogliani 8.550605 Favourite Soprano Arias Luba Orgonášová, Soprano / Slovak RSO / Will Humburg Disc 0 730099 560528 Maria Callas, Rina Cavallari, Gina Cigna, Rosa Ponselle, Soprano / Irene Minghini-Cattaneo, Ebe Stignani, Mezzo-soprano / Marion Telva, Contralto / Giovanni Breviario, Paolo Caroli, Mario Filippeschi, Francesco Merli, Tenor / Tancredi Pasero, 8.110325-27 Norma [3 Discs] 3 Discs Ezio Pinza, Nicola Rossi-Lemeni, Bass / Italian Broadcasting Authority Chorus and Orchestra, Turin / Milan La Scala Chorus and 0 636943 132524 Orchestra / New York Metropolitan Opera Chorus and Orchestra / BELLINI, Vincenzo Vittorio -

Portrait Splendeur Fatale
Portrait Splendeur fatale Salome, Elektra, Medea, Lady Macbeth,Antigone – in extremen Partien Zeitpunkt zwölf, und diese Einspielung hat Inge Borkh, die Ende Mai ihren 80. Geburtstag feiert, Maßstäbe wurde Teil meines Alltags – obwohl sie natürlich alles andere als alltäglich war. gesetzt. Dass sie nicht nur als Expressionistin des Musik-Theaters, Aber sie war immer verfügbar,und das war sondern auch als Sängerin eine Kategorie für sich war, zeigen etliche gut zu wissen, besonders während äußerst Aufnahmen. Eine Hommage von Thomas Voigt. unangenehmer Schulstunden. Die Aus- sicht, nach Hause zu kommen und diese er lebenslänglich Platten die verlorene Unschuld. Aber es gibt Auf- herrlich hysterische, ekstatische, besesse- hört, dürfte diese Erfahrung nahmen,die all diesen Veränderungen der ne Elektra zu hören, ließ mich manches Wkennen: dass manche Auf- eigenen Wahrnehmung mühelos stand- mit Gleichmut ertragen. nahmen, die man zuerst ganz toll fand, im halten. Dazu gehört in meinem Leben die Ihren bewegenden Gesang in der Orest- Laufe der Zeit erheblich an Faszination Elektra der Inge Borkh. Sie war die Erste, Szene wusste ich damals noch nicht so zu verlieren. Man ist älter, vielleicht auch rei- die ich in dieser Rolle hörte. Nicht live schätzen. Was ich mit wachsender Be- fer geworden, ist durch etliche Eindrücke (leider, der Nachteil der späten Geburt), geisterung hörte, war die Szene mit Kly- verwöhnt, wenn nicht verdorben. Auch sondern in der klassischen Dresdner tämnestra, der grandiosen Jean Madeira, beim Platten-Hören gibt es so etwas wie Einspielung unter Böhm. Ich war zu dem deren satter, erdiger Contraalt wie eine 36 FONO FORUM 6/01 Orgel tönte. -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -
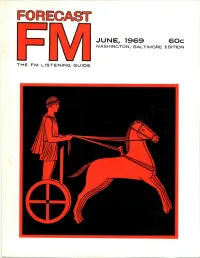
JUNE, 1969 60C WASHINGTON/ BALTIMORE EDITION
JUNE, 1969 60c WASHINGTON/ BALTIMORE EDITION THE FM LISTENING GUIDE . r . 'n YG} itas-er".175ro ó _o °.. - i ,1!11 (! TV 1151,!S~ .. ha...,.. .,wv . _ . v '7.] gl "The Sony 6060 is the brightest thing that happened to stereo in a long while. If outshines receivers costing hundreds more." i///,ompoo.11 111111111IIIt111Í11111SM\\\\\\\\\\\ SONY FM 88 90 92 94 96 98 100 102104 10E 108 MHz at I 1UNING .lN"WI, 1 .. .r. I STEREO RECEIVER 0060 SO110 STATE Sony Model STR-6060 FW AM/FM Stereo Receiver MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS- 0.5°/o. FM Stereo Separation: More :han 0.2°/o at rated output; under 0.15°/o at FM Tuner Section-IHF Usable Sensitivity: 40 dB @ 1 kHz. AM Tuner Section-Sensi- 0.5 watts output. Frequency Response: 1.8 /t, V. S/N Ratio: 65 dB. Capture Ratio: tivity: 160 µ,V (built-in antenna); 10 µ,V Aux, Tape: 20 Hz to 60 kHz +0, -3 dB. 1.5 dB. IHF Selectivity: 80 dB. Antenna: (external antenna). S/N Ratio: 50 dE @ S/N Ratio: Aux, Tape: 100 dB; Phono: 70 300 ohm & 75 ohm. Frequency Response: 5 mV input. Amplifier Section Dynamic dB; Tape Head; 60 dB. Tone Control 20 to 20,000 Hz ±1 dB. Image Rejection: Power Output: 110 watts (total), 8 ohms. Range: Bass: ±10 dB @ 100 Hz; Treble: 80 dB. IF Rejection: 90 dB. Spurious Rejec- RMS Power Output: 45 watts per charnel, ±10 dB @ 10 kHz. General-Dimensions: tion: 90 dB. AM Suppression: 50 dB. Total 8 ohms. -

Genève L'autographe
l’autographe Genève l'autographe L’Autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201, Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in US DOLLARS, SWISS FRANCS and EUROS and do not include postage. All overseas shipment will be sent by air. Orders above € 1000 benefits of free shipping. We accept payments via bank transfer, PayPal, and all major credit cards. We do not accept bank checks. Images not reproduced will be provided on request Postfinance CCP 61-374302-1 3 rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: EUR: CH94 0900 0000 9175 1379 1 CHF: CH94 0900 0000 6137 4302 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped with La Poste and Federal Express on request. Great opera singers p. 4 Dance and Ballet p. 33 Great opera singers 1. Licia Albanese (Bari, 1909 - Manhattan, 2014) Photograph with autograph signature of the Italian soprano as Puccini’s Madama Butterfly. (8 x 10 inch. ). $ 35/ Fr. 30/ € 28 2. Lucine Amara (Hartford, 1924) Photographic portrait of the Metropolitan Opera's American soprano as Liu in Puccini’s Turandot (1926).(8 x 10 inch.). $ 35/ Fr. 30/ € 28 3. Vittorio Arimondi (Saluzzo, 1861 - Chicago, 1928) Photographic portrait with autograph signature of the Italian bass who created the role of Pistola in Verdi’s Falstaff (1893). $ 80/ Fr. -

"Deutsche Spieloper"
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „‚Deutsche Spieloper‛ im Kontext der Spielplanprogrammatik der Wiener Volksoper von 1955 bis 2012“ verfasst von Angelika Kozak Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Ass.-Prof. Dr. Isolde Schmid-Reiter Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................................................................... 4 Einleitung und Forschungsstand ................................................................................................ 6 1. Zum Terminus „Deutsche Spieloper“ .................................................................................... 9 2. Volksoper – Die Oper fürs Volk? Spielplanprogrammatik der Volksoper bis 1955 ........... 16 3. Die Direktionen ab 1955 und ihre Spielplanpolitik ............................................................. 31 3.1. Franz Salmhofer 1955-1963 ...................................................................................... 31 3.2. Albert Moser 1963-1973 ........................................................................................... 33 3.3. Karl Dönch 1973-1987 .............................................................................................. 44 3.4. Eberhard Waechter 1987-1992 .................................................................................. 57 3.5. Ioan Holender 1992-1996 ......................................................................................... -

Over 100 Opera Makers
#OPERAHARMONY CREATING OPERAS IN ISOLATION 1 3 WELCOME TO #OPERA HARMONY FROM FOUNDER – ELLA MARCHMENT Welcome to #OperaHarmony. #Opera Harmony is a collection of opera makers from across the world who, during this time of crisis, formed an online community to create new operas. I started this initiative when the show that I was rehearsing at Dutch National Opera was cancelled because of the lockdown. Using social media and online platforms I invited colleagues worldwide to join me in the immense technical and logistical challenge of creating new works online. I set the themes of ‘distance’ and ‘community’, organised artist teams, and since March have been overseeing the creation of twenty new operas. All the artists involved in #OperaHarmony are highly skilled professionals who typically apply their talents in creating live theatre performances. Through this project, they have had to adapt to working in a new medium, as well as embracing new technologies and novel ways of creating, producing, and sharing work. #OperaHarmony’s goal was to bring people together in ways that were unimaginable prior to Covid-19. Over 100 artists from all the opera disciplines have collaborated to write, stage, record, and produce the new operas. The pieces encapsulate an incredibly dark period for the arts, and they are a symbol of the unstoppable determination, and community that exists to perform and continue to create operatic works. This has been my saving grace throughout lockdown, and it has given all involved a sense of purpose. When we started building these works we had no idea how they would eventually be realised, and it is with great thanks that we acknowledge the support of Opera Vision in helping to both distribute and disseminate these pieces, and also for establishing a means in which audiences can be invited into the heart of the process too .