Robert Maillart Ein Innovativer Brückenbauer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

David P. Billington Is a Professor of Civil and Environmental Engineering at Princeton University, Where He Is the Gordon Y.S
DaviD P. Billington is a professor of civil and environmental engineering at Princeton University, where he is the Gordon Y.S. Wu Professor of Engineering. He has curated numerous museum exhibitions and is the author of 10 books, including most recently Power, Speed and Form: Engineers and the Making of the Twentieth Century (with David P. Billington, Jr.); The Art of Structural Design: A Swiss Legacy; Big Dams of the New Deal Era: A Confluence of Engineering and Politics (with Donald C. Jackson); and Félix Candela: Engineer, Builder and Structural Artist (with Maria E. Moreyra Garlock). Jeff Stein AIA is head of the school of architecture and dean of the Boston Architectural College. Civil Service David P. Billington talks with Jeff Stein AIA An engineer extols the virtues of efficiency, economy, and, yes, elegance. Jeff Stein: A decade ago, Engineering News Record named you one and I began to teach a structures course to architects through of the top five educators in civil engineering since 1874. beautiful works, slipping in the technical part. I finally decided that the course should be given to the whole university, not just David Billington: I don’t know how they measured that but it to the architecture students. So I began in 1974 the course called was nice to hear it. I hold the world’s record for having taught “Structures in the Urban Environment,”and it became popular. architecture students more years than any other civil engineering After that, the associate dean came to me in 1984 and said, professor. Most civil engineering professors don’t like to do that. -

World Monument Salginatobel Bridge
Technical Profile World Monument Salginatobel Bridge Construction type: Three-hinged arch, developed World Monument Salginatobel Bridge as hollow-box girder Construction material: Reinforced concrete International Historic Civil Engineering Landmark Total length: 132.30 m Width of roadway: 3.5 m Slope of roadway: 3% or 3.97 m Span of arch: 90.04 m Arch rise: 12.99 m Dimensions of the arch slab: at the support hinges: 0.40 x 6.00 m at the crown: 0.20 x 3.80 m Load bearing capacity: 8 t or 350 kg/m² Only thirty structures in the world have received an equi- Height above water: over 90 m valent bronze plaque! Design Engineer: Robert Maillart, Geneva International Regard The Salginatobel Bridge is a highlight of 20th century Contractor: Florian Prader & Cie., bridge architecture. As an outstanding engineering Zurich/Chur feat and modern work of art, it has an almost magical Scaffolding: Richard Coray, Trin attraction to experts and artists alike since its com- pletion in 1930. Construction time: 1929/30 In 1991, the American Society of Civil Engineers Total cost: CHF 180,000 (ASCE) declared this exceptional bridge a "world Extensive restoration: 1997/98 monument". Today, around 30 structures form a small group of the most significant engineering creations, The Salginatobel Bridge Book (in German) including well-known ones such as the Eiffel Tower in 232 pages, 61 b/w photos Paris, the Statue of Liberty in New York, or the 16 drawings, 9 plans (4 fold-outs) Panama Canal, to name a few. 23 pages of calculations Almost ten years later, after a worldwide survey, the ISBN 3 9 5 2 0 9 6 3 1 8 renowned British trade journal "Bridge - design & Price CHF 40 TOURISM engineering" voted the Salginatobel Bridge the most Group Transportation (apx. -

The Introduction of Reinforced Concrete in Switzerland (1890-1914) : Social and Cultural Aspects
The Introduction of Reinforced Concrete in Switzerland (1890-1914) : Social and Cultural Aspects. Hans-Ulrich Jost Reinforced Concrete, introduced in all Europe during the late years of the 19th century, has today a well-documented history (see one of the latest publications: Simonnet 2005). Considering this knowledge, my study will, for the essentials, keep to put in perspective the circumstances which favoured the application of this new material in Belle-Époque Switzerland (Schindler Yui 1995) and to a lesser extent those opposed to it. The technology of reinforced concrete was by no means a simple matter. Few people actually mastered the new techniques and technology, and some even doubted that the material was reliable. As a result, the general public was reluctant to accept the new building technique. For the most part, those opposed to it came from two socio-political milieus: the conservative circles on one hand, and the newly created nature and historical heritage conservation movement, known as Heimatschutz (Le Dinh 1992, Clavien 1993, pp. 87-91), on the other. I propose to analyse some aspects of the introduction of this new material in Switzerland between 1890 and 1914. I will examine and discuss the penetration and spread of reinforced concrete as a potential technology, its first applications, and its incorporation as a discipline taught in relevant industry academies. I will then focus on the public debates and controversies generated by its adoption, the attitudes of the political authorities, as well as the reactions and perceptions of cultural milieus. Before getting into the subject, we should point out a few ambiguous aspects of this period, marked on one side by a fast and intense technological modernisation, and on the other by an often forceful reconstitution of traditionalist, if not reactionary, forces (Schwengel 1988, Teich/Porter 1990, Kuchenbuch 1992). -
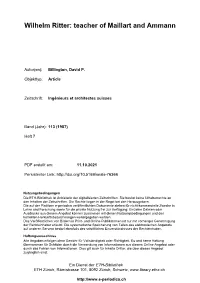
Wilhelm Ritter: Teacher of Maillart and Ammann
Wilhelm Ritter: teacher of Maillart and Ammann Autor(en): Billington, David P. Objekttyp: Article Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses Band (Jahr): 113 (1987) Heft 7 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-76366 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch CHRISTIAN MENN Ingénieurs el architectes suisses n" 7 26 mars 1987 Tableau 1. — Amplitudes maximales des variations de températures uniformes les ponts selon différentes sources. pour Bibliographie à Taa [°C] [1] J accoud, J.-P. Gradients de tempéra¬ dans les et Ponts en bétons Ponts mixtes Ponts en acier ture ponts. -

Life Cycle Assessment of Maillart's Bridges
Politecnico di Torino École polytechnique fédérale de Lausanne Master Course in Civil Engineering Master Thesis: Life Cycle Assessment of Maillart’s Bridges Giulia Pirro Professors: Supervisor: C. Fivet and C. De Wolf R. Ceravolo Academic Year 2018/2019 Life Cycle Assessment of Maillart’s Bridges Giulia Pirro 1 Master Thesis, 2019 Life Cycle Assessment of Maillart’s Bridges Abstract Robert Maillart’s contribution to the community of civil engineers and, most of all, his crucial role in the evolution of the structural art are undeniable. He was able to merge not only mechanical efficiency with innovative solutions but also aesthetic expression as a real artist, always balancing his choices with limited resources both in terms of construction materials and costs. Following these three key parameters he succeeded in producing structures which can be considered a very good combination of structural performance and sustainability. The actual goal is to understand to what extent Maillart’s bridges are indeed sustainable in addition to be efficient and elegant. That is why performing a Life Cycle Assessment (LCA) of his bridges is a valid quantitative confirmation of his achievements. The followed procedure is, thus, based on the computation of construction materials volumes. Starting from the original drawings [1], elaborating them as 3D model, the contribution of concrete and steel is computed. Then, the volume of masonry is also calculated and, where present, the timber for the scaffolding. The goal is to compute the Global Warming Potential (GWP) of each bridge, to normalise them per deck area and to be able to compare them according to different strategies. -

Robert Maillart BUILDER, DESIGNER, and ARTIST
Robert Maillart BUILDER, DESIGNER, AND ARTIST David P. Billington Princeton University CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Contents Illustrations page xiii Preface xxi Acknowledgments xxvii Introduction 1 CHAPTER ONE Student and Designer, 1872-1901 3 THE SYNTHESIS OF CULTURES: BERN AND ZURICH 3 Belgian and German-Swiss 3 Discipline and Play 5 Engineering in Zurich: The Swiss Synthesis 6 Ritter and the Bridge: Maillart and Ammann 8 Ritter and the Design View 9 STONE VERSUS CONCRETE: ZURICH, 1894-1899 10 The New Material and the Tradition of Mass 10 Ritter and the Big Bridge 13 Maillart and Hennebique 14 THE SHIFT OF VISION: ZUOZ, 1894-1901 17 Zuoz: The First Major Innovation 17 The Meaning of the Zuoz Design 18 A Proposal 20 An Inner Companion 22 Together in Zurich 23 CHAPTER TWO Designer and Builder, 1902-1909 26 THE NEW FIRM, 1902-1904 26 Independence 26 The First Success 27 The St. Gallen Bridge: More Rational and More Beautiful 31 Maillart Against the Authorities 32 VII VIII CONTENTS THE FIRST MASTERPIECE: TAVANASA, 1902-1905 34 Billwil and Zuoz 34 The Return to Zuoz 35 The Tavanasa Breakthrough 38 Melan, Morsch, and Ritter 40 A FAREWELL TO BRIDGES, 1904-1909 41 From Basel to Davos 41 Building a Reputation 44 Builder and Architect 47 The Safety of Reinforced Concrete 48 Maillart Transforms the Floor 49 The Hidden Wall 52 Zurich University 52 CHAPTER THREE Builder and Millionaire, 1909-1914 56 THE BIG BRIDGE COMPETITIONS, 1909-1912 56 Surprise at Rheinfelden 56 Laufenburg 58 Aarburg 60 The Perils of Bridge Construction 63 The Stone Hand of Moser 64 The Lorraine Bridge Competition 66 Moser and Maillart 67 The Outward Turn 68 THE TENSIONS OF SUCCESS 69 Business and Family 69 Voltrastrasse: Maillart as Patron 72 Career Conflicts 73 Personalities and the Code: Practice or Research? 74 Teaching and the Conflict of Ideals 76 THE MOVE TOWARD RUSSIA 77 St. -

Robert Maillart (1872-1940) Ingenieur
Research Collection Other Publication Robert Maillart (1872-1940) Ingenieur Author(s): Rigassi, Clemente; Maillart, Robert Publication Date: 1988 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000482170 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library INHALT I. ~läne,Berechnungen, Photographien, Akten Sachregister Ortsregister Bauherren-Register Projektnummern-Register 11. Manuskripte 111, Korrespondenz , IV. Biographisches Y. Bibliographie Publikationen von Robert Maillart Publikationen Über Maillarts Leben und Werk 197 Autorenregister Bh. Bauherr Cl. ~liches Dok. Dokumentation Doss. Dossier Ph. Photographien PN Proj ektnummer P P P -- S. I. socie¿e ~mmobiliere P- PP - P- Herkunft der Dokumente : (BM) Frau Marie-Claire Blumer-Maillart ~Ürich (BW) Bernet & Weyeneth Ingenieurbüro für Hoch-u,Tiefbau Bern Tremblet & Cie,SA Bureau dtlngenieurs ~eneve Veyron-Brücke bei Pampigny. Bh.: Biere-Apples-Morges- Bahn. 40 Pläne 4 1 Doss. Berechnungen (BM), Dok. Stollen Stolzenmühle - Hüseren, Situationskizze 1:2000 April 1894 (BM). Stauffacher-Brücke, Zürich. Bh: Tiefbauamt der Stadt Zürich, Ausführung: Fietz 8 Leuthold AG Bauunternehmung, Zürich und Favre & Co., Zürich-Wallisellen. 10 Pläne (Kopien) + 1 Doss. Berechnungen, 2 Ph., 15 Akten, 8 Briefe (BM), Dok. Hadlaub-Brücke für die Drahtseilbahn des Rigiviertels in Zürich. 5 Pläne (Kopien), 1 Ph. (BM), Dok. Innbrücke bei Zuoz. Rh,: Gemeinde Zuoz. Ausführung: Frotk B Westermann, Zürich. C 4 Pläne (Kopien), 5 Ph., 9 Berichte U, Akten, 2 Briefe (BM), Dok. Kabelpanzer, Schweiz, Pat. 23 953. Bh,: Ways B Freytag AG, Neustadt a./d. Haardt D. Projekt für eine Brücke über die Baye de Clarens bei Brent.