Otto Von Faber Du Faur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Relevance of Drawing for Artistic Education at the Academy of Fine Arts Munich and Its Significance in International Contexts
“You Have to Draw with More Attention, More Dedication” The Relevance of Drawing for Artistic Education at the Academy of Fine Arts Munich and its Significance in International Contexts Johannes Kirschenmann and Caroline Sternberg Throughout the Age of Enlightenment in Europe in the late eighteenth century, radical changes occurred in the understanding of art.1 From then on, the general and esthetic education of the human being have been emphasized and one was convinced of the teachability of art. The reason was twofold: drawing was supposed to shape the taste of future producers, and the arts were ascribed ethical, moral and political functions. In numerous art schools, drawing lessons were now being taken up that not only fine arts benefited from but also craft: over 100 academies were founded in Europe during this period.2 In 1770 in Munich, for instance, Elector Max III. Joseph decided to turn a private artistic circle gathered for life drawing and modeling sessions into an official “drawing school” (» Fig. 1).3 The Munich art academy as a public institution was formed relatively late in the Eu- ropean context. Following the example of the Parisian academy, the first art schools were founded in German countries in the seventeenth century – in Augsburg, Nuremberg, Vienna and Berlin.4 In the eighteenth century a huge number of art schools followed. Several European capitals installed art schools in the first half of the eighteenth century, 1 For the quotation in the title, see footnote 29. 2 Pevsner 1986, p. 144; Heilmann/Nanobashvili/Teutenberg 2015, pp. 5–8; Kemp 1979, pp. -

Van Gogh Museum Journal 1995
Van Gogh Museum Journal 1995 bron Van Gogh Museum Journal 1995. Waanders, Zwolle 1995 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_van012199501_01/colofon.php © 2012 dbnl / Rijksmuseum Vincent Van Gogh 6 Director's Foreword The Van Gogh Museum shortly after its opening in 1973 For those of us who experienced the foundation of the Van Gogh Museum at first hand, it may come as a shock to discover that over 20 years have passed since Her Majesty Queen Juliana officially opened the Museum on 2 June 1973. For a younger generation, it is perhaps surprising to discover that the institution is in fact so young. Indeed, it is remarkable that in such a short period of time the Museum has been able to create its own specific niche in both the Dutch and international art worlds. This first issue of the Van Gogh Museum Journal marks the passage of the Rijksmuseum (National Museum) Vincent van Gogh to its new status as Stichting Van Gogh Museum (Foundation Van Gogh Museum). The publication is designed to both report on the Museum's activities and, more particularly, to be a motor and repository for the scholarship on the work of Van Gogh and aspects of the permanent collection in broader context. Besides articles on individual works or groups of objects from both the Van Gogh Museum's collection and the collection of the Museum Mesdag, the Journal will publish the acquisitions of the previous year. Scholars not only from the Museum but from all over the world are and will be invited to submit their contributions. -

Kat. Lithographie 30.#1BF1E.Qxd
. r J r e d i e n h c S . P . J www.j-p-schneider.com Herausgeber: J. P. Schneider jr. Kunsthandlung Katalogbeiträge: Max Andreas (MA) Dr. Eva Habermehl (EH) Dr. Roland Dorn (RD) Fotografie: Marthe Andreas Im Trutz Frankfurt 2 Layout und Reproduktion: D-60322 Frankfurt am Main Michael Imhof Verlag, Petersberg Termin nach Vereinbarung Druck: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe +49 (0)69 281033 [email protected] www.j-p-schneider.com © J. P. Schneider jr. Verlag 2018 ISBN 978-3-9802873-5-7 Preise auf Anfrage INHALT Vorwort ......................................................................................... 7 9 Simon-Joseph-Alexandre-Clément Denis Blick auf die Sabiner Berge .............................................. 26 10 Théodore Étienne Pierre Rousseau 1 Johann Wilhelm Schirmer Künstler, skizzierend im Forst von Fontainebleau ...... 28 Badende in italienischer Landschaft ................................ 9 11 Wilhelm Trübner 2 Eduard Wilhelm Pose Selbstbildnis nach rechts, 1876 ......................................... 31 Italienische Landschaft ..................................................... 12 3 Carl Maria Nicolaus Hummel 12 Wilhelm Trübner Italienische Landschaft Wildenten ............................................................................. 35 (Blick von den Albaner Bergen über Nemisee 13 Carl Schuch und Campagna zum Meer) .............................................. 14 Stillleben mit Lauch, Zwiebeln und Käse ..................... 39 4 Carl Morgenstern 14 Otto Scholderer Cadenabbia am Comer -

Global Vistas: American Art and Internationalism in the Gilded Age
Global Vistas: American Art and Internationalism in the Gilded Age Nicole Williams Honorary Guest Scholar and Postdoctoral Teaching Fellow (2019–2020) in the Department of Art History & Archaeology in Arts & Sciences at Washington University in St. Louis Global Vistas: American Art and Internationalism in the Gilded Age explores the importance of international travel and exchange to American art of the late nineteenth century, a period of transition for the United States marked by the rise of global trade, international tourism, massive waves of immigration, and forces of orientalism and imperialism. Through a selection of paintings, prints, photographs, and decorative arts from the Mildred Lane Kemper Art Museum, as well as other collections at Washington University in St. Louis, this Teaching Gallery exhibition reveals how Americans increasingly defined their nation by looking to the foreign cultures and landscapes of Asia, the Middle East, Europe, and the Caribbean basin. They imbued their art with a modern, multicultural spirit that also announced the country’s emerging status as a global power. In the decades following the Civil War, many Americans eagerly turned away from recent violence at home toward new vistas of adventure and opportunity abroad. A boom in international travel was facilitated by improvements to communication and transportation networks, such as the laying of the first transatlantic cable, the completion of the transcontinental railroad, the opening of the Suez Canal, and the introduction of regular steamship service between San Francisco and Yokohama, Japan. Young American artists flocked to study in Europe’s great art centers, often staying overseas for many years and establishing vibrant expatriate communities. -

Frauenbilder Bei Hans Makart“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Frauenbilder bei Hans Makart“ Verfasserin Cornelia Eleonore Zerovnik angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuer: HR Dr. Werner Kitlitschka Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .................................................................................................................. 5 1.1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit ................................................................. 6 1.2. Forschungsstand ............................................................................................... 8 1.3. Methodik .......................................................................................................... 11 2. Grundprinzipien des Schaffens Makarts .................................................................. 15 2.1. Das Prinzip Dekor ........................................................................................... 15 2.1.1. Gesamtkunstwerk „Makart“ ....................................................................... 16 2.1.2. Selbstdarstellung und Inszenierung ........................................................... 19 2.1.3. Zwischen Traum und Wirklichkeit .............................................................. 21 2.1.4. Weiblichkeit als Dekor ............................................................................... 24 2.2. Das Prinzip Schönheit .................................................................................... -
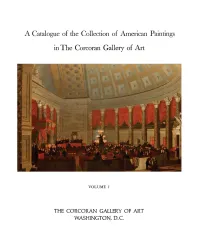
A Catalogue of the Collection of American Paintings in the Corcoran Gallery of Art
A Catalogue of the Collection of American Paintings in The Corcoran Gallery of Art VOLUME I THE CORCORAN GALLERY OF ART WASHINGTON, D.C. A Catalogue of the Collection of American Paintings in The Corcoran Gallery of Art Volume 1 PAINTERS BORN BEFORE 1850 THE CORCORAN GALLERY OF ART WASHINGTON, D.C Copyright © 1966 By The Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. 20006 The Board of Trustees of The Corcoran Gallery of Art George E. Hamilton, Jr., President Robert V. Fleming Charles C. Glover, Jr. Corcoran Thorn, Jr. Katherine Morris Hall Frederick M. Bradley David E. Finley Gordon Gray David Lloyd Kreeger William Wilson Corcoran 69.1 A cknowledgments While the need for a catalogue of the collection has been apparent for some time, the preparation of this publication did not actually begin until June, 1965. Since that time a great many individuals and institutions have assisted in com- pleting the information contained herein. It is impossible to mention each indi- vidual and institution who has contributed to this project. But we take particular pleasure in recording our indebtedness to the staffs of the following institutions for their invaluable assistance: The Frick Art Reference Library, The District of Columbia Public Library, The Library of the National Gallery of Art, The Prints and Photographs Division, The Library of Congress. For assistance with particular research problems, and in compiling biographi- cal information on many of the artists included in this volume, special thanks are due to Mrs. Philip W. Amram, Miss Nancy Berman, Mrs. Christopher Bever, Mrs. Carter Burns, Professor Francis W. -
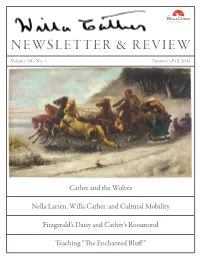
Newsletter & Review
NEWSLETTER & REVIEW Volume 58 z No. 1 Summer z Fall 2015 Cather and the Wolves Nella Larsen, Willa Cather, and Cultural Mobility Fitzgerald’s Daisy and Cather’s Rosamond Teaching “The Enchanted Bluff ” Willa Cather NEWSLETTER & REVIEW Volume 58 z No. 1 | Summer z Fall 2015 2 9 17 31 24 30 33 CONTENTS 1 Letters from the Executive Director and the President 17 More Than Beautiful Little Fools: Fitzgerald’s Daisy, Cather’s Rosamond, and Postwar Images of 2 “Never at an End”: The Search for Sources of Cather’s American Women z Mallory Boykin Wolves Story z Michela Schulthies 24 Upwardly Mobile: Teaching “The Enchanted Bluff ” 4 New Life for a Well-known Painting to Contemporary Students z Christine Hill Smith 5 Describing the Restoration z Kenneth Bé 30 New Beginnings for National Willa Cather Center 9 Meanings of Mobility in Willa Cather’s The Song of 31 In Memoriam: Charlene Hoschouer the Lark and Nella Larsen’s Quicksand Amy Doherty Mohr 33 Willa Cather and the Connection to Kyrgyzstan Max Despain On the cover: Sleigh with Trailing Wolves by Paul Powis. Photo courtesy of the Nebraska State Historical Society’s Gerald R. Ford Conservation Center. Letter from the City of Red Cloud, and the area Chamber of Commerce the Executive Director to further develop and enhance the visitor experience. Through Ashley Olson the hire of a Heritage Tourism Development Director, the partnership will increase Red Cloud’s appeal as a destination for tourists through creation of new services and amenities. Jarrod As I write this, a productive and busy summer at the Willa Cather McCartney, a scholar and Red Cloud native, has already settled Foundation is drawing to a close and we are celebrating the success of into this position comfortably. -

Catalogue of Modern Paintings and Sculpture :|Bcollected by the Late
THE ART COLLECTION OF THE LATE J. W. KAUFFMAN ON VIEW DAY AND EVENING AT THE AMERICAN ART GALLERIES FROM SATURDAY, JANUARY 28th UNTIL THE MORNING OF THE DAY OF SALE, INCLUSIVE SALE AT MENDELSSOHN HALL FORTIETH STREET, EAST OF BROADWAY FRIDAY EVENING, FEBRUARY 3rd BEGINNING PROMPTLY AT 8.15 O’CLOCK ! CATALOGUE OF MODERN PAINTINGS AND SCULPTURE COLLECTED BY THE LATE J. W. KAUFFMAN > % • OF ST. LOUIS TO BE SOLD AT UNRESTRICTED PUBLIC SALE BY ORDER OP MRS. N. B. KAUFFMAN, EXECUTRIX, ON THE DATE HEREIN STATED THE SALE WILL BE CONDUCTED BY THOMAS E. KIRBY OF THE AMERICAN ART ASSOCIATION, MANAGERS NEW YORK: 1905 Copyright, 1905, by THE AMERICAN ART ASSOCIATION Press of J. J. Little & Co. Astor Place, New York . , CONDITIONS OF SALE 1. The highest Bidder to he the Buyer, and if any dispute arise between two or more Bidders, the Lot so in dispute shall be im- mediately put up again and re-sold. 2. The Auctioneer reserves the right to reject any bid which is merely a nominal or fractional advance, and therefore, in his judgment, likely to affect the Sale injuriously 3. The Purchasers to give their names and addresses, and to pay down a cash deposit, or the whole of the Purchase-money if required, in default of which the Lot or Lots so purchased to be immediately put up again and re-sold. 4. The Lots to be taken away at the Buyer’s Expense and Risk within twenty-four hours from the conclusion of the Sale, and the remainder of the Purchase-money to be absolutely paid, or other- wise settled for to the satisfaction of the Auctioneer, on or before delivery; in default of which the undersigned will not hold them- selves responsible if the lots be lost, stolen, damaged, or destroyed, but they will be left at the sole risk of the Purchaser. -

19Th Century European, Victorian and British Impressionist Art New Bond Street, London I 26 September 2018
19th Century European, Victorian and British Impressionist Art New Bond Street, London I 26 September 2018 19th Century European, Victorian and British Impressionist Art Wednesday 26 September 2018 at 2pm New Bond Street, London VIEWING ENQUIRIES REGISTRATION PHYSICAL CONDITION OF Thursday 20 September Peter Rees (Head of Sale) IMPORTANT NOTICE LOTS IN THIS AUCTION 9am to 4.30pm +44 (0) 20 7468 8201 Please note that all customers, PLEASE NOTE THAT THERE IS Friday 21 September [email protected] irrespective of any previous NO REFERENCE IN THIS 9am to 4.30pm activity with Bonhams, are Sunday 23 September Charles O’Brien CATALOGUE TO THE PHYSICAL 11am to 3pm (Head of Department) required to complete the Bidder CONDITION OF ANY LOT. Monday 24 September +44 (0) 20 7468 8360 Registration Form in advance of INTENDING BIDDERS MUST 9am to 4.30pm [email protected] the sale. The form can be found SATISFY THEMSELVES AS TO Tuesday 25 September at the back of every catalogue THE CONDITION OF ANY LOT 9am to 4.30pm Emma Gordon and on our website at www. AS SPECIFIED IN CLAUSE 14 Wednesday 26 September +44 (0) 20 7468 8232 bonhams.com and should be OF THE NOTICE TO BIDDERS 9am to 12pm [email protected] returned by email or post to the CONTAINED AT THE END OF THIS CATALOGUE. specialist department or to the SALE NUMBER Alistair Laird bids department at 24742 +44 (0) 20 7468 8211 As a courtesy to intending [email protected] [email protected] bidders, Bonhams will provide a written Indication of the physical CATALOGUE To bid live online and / or leave condition of lots in this sale if a £25.00 Deborah Cliffe internet bids please go to +44 (0) 20 7468 8337 request is received up to 24 www.bonhams.com/ ILLUSTRATIONS [email protected] hours before the auction starts. -

Kuns T De S Kuns T De S
24. MAI 2017 KUNST DES 19. JAHRHUNDERTS Ketterer Kunst Auktion 446 24. Mai 2017 KUNST DES 19. JAHRHUNDERTS 24. MAI 2017 KUNST DES 19. JAHRHUNDERTS 446. AUKTION Kunst des 19. Jahrhunderts inkl. Sonderkatalog „Tradition und Secession“ Auktion | Auction Mittwoch, 24. Mai 2017, ab 16 Uhr (from 4 pm on) Los 1-35 Tradition und Secession – eine süddeutsche Privatsammlung Los 36-207 Kunst des 19. Jahrhunderts Ketterer Kunst München Joseph-Wild-Straße 18 81829 München Vorbesichtigung | Preview Hamburg Ketterer Kunst, Holstenwall 5, 20355 Hamburg Mo. 8. Mai 10 – 20 Uhr | 10 am – 8 pm Di. 9. Mai 10 – 16 Uhr | 10 am – 4 pm Düsseldorf Ketterer Kunst, Malkastenstraße 11, 40211 Düsseldorf Do. 11. Mai 11 – 19 Uhr | 11 am – 7 pm Fr. 12. Mai 11 – 18 Uhr | 11 am – 6 pm Berlin Ketterer Kunst, Fasanenstraße 70, 10719 Berlin Mo. 15. Mai 10 – 20 Uhr | 10 am – 8 pm Di. 16. Mai 10 – 15 Uhr | 10 am – 3 pm München Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Straße 18, 81829 München Fr. 19. Mai 10 – 18 Uhr | 10 am – 6 pm Sa. 20. Mai 11 – 17 Uhr | 11 am – 5 pm So. 21. Mai 11 – 17 Uhr | 11 am – 5 pm Mo. 22. Mai 10 – 18 Uhr | 10 am – 6 pm Di. 23. Mai 10 – 18 Uhr | 10 am – 6 pm Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,10 US Dollar (Richtwert). Vorderer Umschlag: Los 19 - F. v. Stuck – Frontispiz: Los 80 - E.T. Compton – Seite 2: Los 188 - F. Kallmorgen – Hinterer Umschlag innen: Los 143 - J. Grünenwald – Hinterer Umschlag außen: Los 185 - H. Thoma 3 ANSPRECHPARTNER FRÜHJAHRSAUKTIONEN 2017 Kunst des 19. -

Frye Art Museum 2014 Annual Report
Frye Art Museum 2014 Annual Report CONTENTS LETTER FROM THE PRESIDENT AND DIRECTOR 3 STEWARDSHIP Collections and Acquisitions and Gifts of Art to the Museum 4 Artworks on Loan 12 EXHIBITIONS Exhibitions 14 Lenders 18 Publications 19 Selected Reviews 20 ARTS ENGAGEMENT PROGRAMS Youth 24 Educators 26 Lifelong Learners 26 Events 28 Community Partners 29 SUPPORT Foundations, Funding Agencies, Corporations, Media Sponsors, In- Kind Contributors, and Individual Donors 30 Sustained Support 32 Membership 35 Volunteers 40 STAFF 42 Cover: Franz von Stuck. Lucifer (detail), 1890. Oil on canvas. 63 3/8 x 60 1/16 in. The National Gallery for Foreign Art, Sofi a, Bulgaria. FRYE ART MUSEUM 2014 ANNUAL REPORT 1 MISSION STATEMENT The Frye Art Museum is a living legacy of visionary patronage and civic responsibility, committed to Photos: John Ulman and Assaye Abunie artistic inquiry and a rich visitor experience. A catalyst for our engagement with contemporary art and artists is the Founding Collection of Charles and Emma Frye, access to which shall always be free. 2 FRYE ART MUSEUM 2014 ANNUAL REPORT LETTER FROM THE PRESIDENT AND DIRECTOR 2014 was a wonderful year for the Frye. Support for the Museum has Art, New York, and the Museum of Fine Arts, Boston. We are indebted to never been greater, broader, or deeper. Our ongoing commitment to serve these museums, and other important private and public lenders, for their our diverse communities was received with remarkable enthusiasm and generous loans. curiosity. As attendance in our galleries soared to new heights, we also reached thousands of virtual visitors in dozens of countries around the We were pleased to be selected by the Andy Warhol Foundation for the world through our website and on social media. -

A Short History of Germany
CTV » |-aill|||lK-4JJ • -^ V •^ VmOO^* «>^ "^ * ©IIS * •< f I * '^ *o • ft *0 * •J' c*- ^oV^ . "^^^O^ 4 o » 3, 9 9^ t^^^ 5^. ^ L^' HISTORY OF GERMANY. A SHORT HISTORY OF GERMANY BY Mrs. H. C. HAWTREY WITH ADDITIONAL CHAPTERS BY AMANDA M. FLATTERY 3 4i,> PUBLISHED FOR THE BAY VIEW READING CLUB Central Office, 165 Boston Boulevard DETROIT, MICH. 1903 iTI --0 H^ THE LIBRARY OF CONGRESS. Two Copies Received JUL to 1903 •J Copyrigiil Entry Buss OL XXc N» COPY B. Copyright, 1903, by LONGMANS, GREEN, AND CO. r t" t KOBERT DRUMMOND, PRINTER, NEW YORK. PREFACE. It would be absurd to suppose that a History of Germany could be written within the compass of 300 pages. The merest outline is all that could be given in this little book, and very much of vast interest and im- portance has necessarily been omitted. But some knowledge of the political events of former days is necessary for all persons—more especially trav- ellers—who desire to understand and appreciate the customs, buildings, paintings, etc., of any country, and it is hoped that short continental histories may be useful to many who have not time or opportunity for closer study. My aim in the present volume has been simply to give one marked characteristic of each King or Emperor's reign, so as to fix it in the memory; and to show how Prussia came to hold its present position of importance amongst the continental powers of Europe. Emily Hawtrey. iiL BOOK I. HISTORY OF GERMANY. INTRODUCTION. CHAPTER I. The mighty Teutonic or German race in Europe did not begin to play its part in history until the decline of the Roman Empire ; but we must all of us feel the warm- est interest in it when it does begin, for it represents not only the central history of Europe in the Middle Ages, but also the rise of our own forefathers in their home and birthplace of Germany.