Evaluierung Wiener Wohnungslosenhilfe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pilot Study; the Child Welfare System and Homelessness Among
Pilot Study: The Child Welfare System and Homelessness among Canadian Youth Luba Serge, Margaret Eberle, Michael Goldberg, Susan Sullivan and Peter Dudding December 2002 The views expressed in this document do not necessarily reflect the views of the National Secretariat on Homelessness of the Government of Canada Pilot Study: The Child Welfare System and Homelessness among Canadian Youth December 2002 Luba Serge Margaret Eberle Michael Goldberg, Research Director Social Planning and Research Council of BC Susan Sullivan, Communications Co-ordinator Centre of Excellence for Child Welfare and Peter Dudding, Executive Director Child Welfare League of Canada Executive Summary Pilot Study: The Child Welfare System and Homelessness among Canadian Youth Introduction The issue of youth homelessness is particularly disturbing for it not only touches on a population that is vulnerable with relatively little control over its situation, but it also implies the failure of key components of society – families, schools, employment, and the various safety nets that have been instituted. One of the “systems” that has been set up to protect vulnerable youth is child welfare. However, there is evidence that some youth who have had experience with the child welfare system eventually become homeless, and that the numbers may be increasing. Several profiles of the urban homeless have discovered that many homeless youth and adults have a history of involvement with child welfare, including having been ‘in care’ and are over-represented among the homeless. While this group of youth is still a relatively small proportion of youth who have been through the child welfare system, this does suggest that some, very vulnerable youth, are not getting the kind of support that they need. -

GOVERNING HOMELESSNESS: the Discursive and Institutional Construction of Homelessness in Australia
GOVERNING HOMELESSNESS: The Discursive and Institutional Construction of Homelessness in Australia Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Faculty of Arts and Social Sciences University of Technology, Sydney 2010 Jane Bullen Certificate of Authorship and Originality I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text. I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis. Jane Bullen May 2010 i Acknowledgement I would like to express my gratitude to my thesis supervisors (in chronological order): Eva Cox, Dr Peter Caldwell, Dr Catherine Robinson and Dr Virginia Watson whose advice, support, comment and encouragement have made it possible for me to undertake this research journey. My thesis started with a series of raw questions that arose from my work experiences related to homelessness policy and services, and the assistance and critique of my supervisors has enabled me to formulate my initial curiosity into this research project. Many thanks go to all those that I have worked with in homelessness services: management, staff and people facing homelessness. It was as a result of our collaborative experiences and the obstacles we found in trying to respond to the devastating problems associated with homelessness that I originally decided to investigate why it seemed that ‘the causes of homelessness had changed’. -

THE CULTURE of HOMELESSNESS: an Ethnographic Study
THE CULTURE OF HOMELESSNESS: An ethnographic study Megan Honor Ravenhill London School of Economics PhD in Social Policy UMI Number: U615614 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615614 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 I V|£:S H S f <§195 I O I S S 4 -7 ABSTRACT The thesis argues that homelessness is complex and synergical in nature. It discusses the life events and processes that often trigger, protect against and predict the likelihood of someone becoming homeless (and/or roofless). It argues, that people’s routes into homelessness are complex, multiple and interlinked and are the result of biographical, structural and behavioural factors. This complexity increases with the age of the individual and the duration of their rooflessness. The thesis explores the homeless culture as a counter-culture created through people being pushed out of mainstream society. It argues, that what happened to people in the past, created the nature of the homeless culture. Furthermore it is argued that any serious attempt at resettling long-term rough sleepers needs to consider what it is that the homeless culture offers and whether or how this can be replicated within housed society. -

International Homelessness Policy Review: a Report to Inform the Review of Homelessness Legislation in Wales
Heriot-Watt University Research Gateway International Homelessness Policy Review: a Report to Inform the Review of Homelessness Legislation in Wales Citation for published version: Fitzpatrick, S, Johnsen, S & Watts, B 2012, International Homelessness Policy Review: a Report to Inform the Review of Homelessness Legislation in Wales. Welsh Government, Cardiff. <http://www.cplan.cf.ac.uk/homelessness> Link: Link to publication record in Heriot-Watt Research Portal Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record General rights Copyright for the publications made accessible via Heriot-Watt Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy Heriot-Watt University has made every reasonable effort to ensure that the content in Heriot-Watt Research Portal complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 02. Oct. 2021 International Homelessness Policy Review A report to inform the review of homelessness legislation in Wales Professor Suzanne Fitzpatrick and Dr. Sarah Johnsen Institute for Housing, Urban and Real Estate Research, Heriot‐Watt University and Beth Watts Centre for Housing Policy, University of York January 2012 1 International Homelessness Policy Review Introduction As part of this review of the homelessness legislation in Wales, the research team undertook a targeted review of relevant UK and international literature, as well as an in‐depth analysis of a selection of other countries with promising approaches that may provide useful lessons for Wales (England, Finland, France, Germany, Ireland, Scotland and US)1. -

Homelessness Prevention for Women and Children Who Have Experienced
Homelessness prevention for women and children who have experienced domestic and family violence: innovations in policy and practice authored by Angela Spinney and Sarah Blandy for the Australian Housing and Urban Research Institute Swinburne–Monash Research Centre June 2011 AHURI Positioning Paper No. 140 ISSN: 1834-9250 ISBN: 978-1-921610-73-8 ACKNOWLEDGEMENTS This material was produced with funding from the Australian Government and the Australian states and territory governments. AHURI Limited gratefully acknowledges the financial and other support it has received from these governments, without which this work would not have been possible. AHURI comprises a network of universities clustered into Research Centres across Australia. Research Centre contributions—both financial and in-kind—have made the completion of this report possible. David Hudson of the Institute for Social Research at Swinburne University is gratefully acknowledged for his help in editing this Positioning Paper. DISCLAIMER AHURI Limited is an independent, non-political body which has supported this project as part of its programme of research into housing and urban development, which it hopes will be of value to policy-makers, researchers, industry and communities. The opinions in this publication reflect the views of the authors and do not necessarily reflect those of AHURI Limited, its Board or its funding organisations. No responsibility is accepted by AHURI Limited or its Board or its funders for the accuracy or omission of any statement, opinion, advice or information in this publication. AHURI POSITIONING PAPER SERIES AHURI Positioning Papers is a refereed series presenting the preliminary findings of original research to a diverse readership of policy-makers, researchers and practitioners. -

Care, Control, Or Criminalization? Discourses on Homelessness and Social Responses
Old Dominion University ODU Digital Commons Sociology & Criminal Justice Theses & Dissertations Sociology & Criminal Justice Fall 2016 Care, Control, or Criminalization? Discourses on Homelessness and Social Responses Lindsey L. Upton Old Dominion University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.odu.edu/sociology_criminaljustice_etds Part of the Criminology Commons Recommended Citation Upton, Lindsey L.. "Care, Control, or Criminalization? Discourses on Homelessness and Social Responses" (2016). Doctor of Philosophy (PhD), Dissertation, Sociology & Criminal Justice, Old Dominion University, DOI: 10.25777/q5an-ey21 https://digitalcommons.odu.edu/sociology_criminaljustice_etds/9 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Sociology & Criminal Justice at ODU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Sociology & Criminal Justice Theses & Dissertations by an authorized administrator of ODU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. CARE, CONTROL, OR CRIMINALIZATION? DISCOURSES ON HOMELESSNESS AND SOCIAL RESPONSES by Lindsey L. Upton B.S. May 2009, Iowa State University M.S. May 2011, Eastern Kentucky University A Dissertation Submitted to the Faculty of Old Dominion University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE OLD DOMINION UNIVERSITY December 2016 Approved by: Ruth A. Triplett (Director) Randolph R. Myers (Member) Travis W. Linnemann (Member) ABSTRACT CARE, CONTROL, OR CRIMINALIZATION? DISCOURSES ON HOMELESSNESS AND SOCIAL RESPONSES Lindsey L. Upton Old Dominion University, 2016 Director: Dr. Ruth A. Triplett There has been a resurgence of political and media interest in homelessness, particularly in major urban areas throughout the United States. This interest is credited to a number of cities that declared a State of Emergency (SOE) due to their homelessness crisis in 2015. -

IT COULD BE YOU: Female, Single, Older and Homeless
domestic violence do job loss job loss job female, single, older and homeless homeIt could ownership be you: ho poverty poverty po- gender inequity gen living alone living alo crisis crisis crisis crisi renting renting rentin addiction addiction a divorce divorce divor medicalLudo McFerran medical med no income no income . IT COULD BE YOU: female, single, older and homeless. > 1 ISBN: 978-0-9751994-5-9 ©August 2010 This study and report was a collaborative project of Homelessness NSW, the Older Women’s Network NSW and the St Vincent de Paul Society, with support provided by the Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse. Researched and authored by Ludo McFerran with assistance from Sonia Laverty. The project was funded by the Office for Women’s Policy, Department of Premier and Cabinet, NSW Government and the St Vincent de Paul Society (NSW). The author wishes to thank Sonia Laverty and Sue Cripps for their support and friendship through this project. Other important contributors have been Trish O’Donohue, Trish Bramble and Bobbie Townsend, and many thanks to the support team in the Older Women’s Network NSW, including Matina Mottee, Jane Mears, Joy Ross and Penne Mattes. We all want to thank the women who were interviewed for this report. We hope that their lives continue to improve and that their stories contribute to better policy and housing supply to prevent homelessness for older women in the future. Sue Cripps CEO Homelessness NSW 99 Forbes Street Woolloomooloo NSW 2011 | PO Box 768 Strawberry Hills NSW 2012 (02) 9331 2004 | 0417 112 311 [email protected] | www.homelessnessnsw.org.au Older Women’s’ Network NSW Inc. -

Hidden Homelessness’ Nicholas Pleace and Koen Hermans
Articles 35 Counting All Homelessness in Europe: The Case for Ending Separate Enumeration of ‘Hidden Homelessness’ Nicholas Pleace and Koen Hermans University of York, UK University of Leuven, Belgium \ Abstract_ This paper explores the challenges around the measurement of all homelessness in Europe. The paper begins by reviewing challenges in relation to definition and measurement and moves on to consider the political and ethical dimensions of measuring homelessness that occurs within housing. The paper concludes by proposing new definitions, including dropping the term ‘hidden homelessness’, and advocates properly resourced and directed social research. It is argued that physical-legal definitions have proven unsat- isfactory in the face of evidence about the importance of the psychological and emotional dynamics around the meaning of home, and that there are ethical questions around imposing categorisations of homelessness on popu- lations who might not see themselves or their situation in such terms. However, while it is argued that there is a need to acknowledge these challenges, there is also an imperative to create a concise, practical and measurable European definition of homelessness. \ Keywords_ homelessness enumeration, hidden homelessness ISSN 2030-2762 / ISSN 2030-3106 online 36 European Journal of Homelessness _ Volume 14, No. 3_ 2020 Introduction: Challenges in Definition and Measurement To define someone as homeless requires a working definition of what constitutes a home. The practical challenges for defining and measuring all homelessness, which is not a precise concept, as this paper will go on to explore, have always been twofold. The first problem centres on agreeing the definitional lines around where homelessness starts and stops. -

Homelessness Services in Europe : EOH Comparative Studies on Homelessness
This is a repository copy of Homelessness Services in Europe : EOH Comparative Studies on Homelessness. White Rose Research Online URL for this paper: https://eprints.whiterose.ac.uk/142819/ Monograph: Pleace, Nicholas orcid.org/0000-0002-2133-2667, Baptista, Isabel, Benjaminsen, Lars et al. (1 more author) (2018) Homelessness Services in Europe : EOH Comparative Studies on Homelessness. Research Report. FEANTSA , Brussels. Reuse ["licenses_typename_other" not defined] Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ European Observatory on Homelessness Homelessness Services in Europe EOH Comparative Studies on Homelessness Brussels 2018 n n n n n Acknowledgements This research was based on questionnaire responses from 16 European Union member states. Each questionnaire was completed by an expert in homelessness, with additional expertise being drawn upon where necessary. Our sincere thanks to everyone who supported this piece of research. It is not possible to include every detail of the information collected through the questionnaires, though the authors have worked to try to ensure equal representation of each country and every effort has been made to report the information shared with us accurately. The respond- ents to the questionnaires in each country were as follows (the lead respondent is shown first): Austria Marc Diebäcker; Sarah Barta; Christian Beiser; Cornelia Kössldorfer Czech Republic Kateřina Glumbíková; Marek Mikulec; Dana Nedělníková Denmark Lars Benjaminsen France Carole Lardoux Germany Volker Busch Geertsema Hungary Boróka Fehér; Nóra Teller Ireland Daniel Hoey; Eoin O’Sullivan Italy Caterina Cortese; Cristina Avonto; Alessandro Carta; Egle Faletto. -

European Journal of Homelessness
European Observatory on Homelessness European Journal of Homelessness Quality and Standards in Homelessness Services and Housing for Marginal Groups Volume 1 _ December 2007 194, Chaussée de Louvain n 1210 Brussels n Belgium Tel.: + 32 2 538 66 69 n Fax: + 32 2 539 41 74 [email protected] n www.feantsa.org EUROPEAN JOURNAL OF HOMELESSNESS Journal Philosophy The European Journal of Homelessness provides a critical analysis of policy and practice on homelessness in Europe for policy makers, practitioners, researchers and academics. The aim is to stimulate debate on homelessness and housing exclusion at the European level and to facilitate the development of a stronger evidential base for policy development and innovation. The journal seeks to give international exposure to significant national, regional and local developments and to provide a forum for comparative analysis of policy and practice in preventing and tackling homelessness in Europe. The journal will also assess the lessons for Europe which can be derived from policy, practice and research from elsewhere. The European Journal of Homelessness is produced by FEANTSA’s European Observatory on Homelessness. Co-ordinator Bill Edgar, European Housing Research Ltd, Dundee, UK Editorial Team Joe Doherty, Centre for Housing Research, St Andrews University, UK Suzanne Fitzpatrick, Centre for Housing Policy, University of York, UK Eoin O’Sullivan, Trinity College, Dublin, Ireland Core Research Team Lars Benjaminsen, SFI, The Danish National Centre for Social Research, Copenhagen, Denmark. -

Homeless in Europe Do Not Necessarily Reflect the Views of FEANTSA
The Magazine of FEANTSA - The European Federation of National Organisations Working with the Homeless AISBL omeless in Europe H Spring 2010 Gender Perspectives on Homelessness Editorial by Suzannah Young Gender Perspectives on Homelessness IN THIS ISSUE 2 Editorial 4 Homelessness in Europe: The Role of Gender Equality Policies Bea Chityil 6 Gender and Homelessness: Homeless Women in Lisbon Ana Martins 9 Male Homelessness as an Apparent Matter of Course Dr. Jörg Fichtner 12 Women and Homelessness in Germany Dr. Uta Enders-Dragässer 15 Transient women, The theme of gender is a lesser-explored area of often neglected when talking about homelessness suffering women, homelessness research and may be neglected as a in general.1 However, the relative lack of articles on beyond appearances: the factor that can shed light on homeless experiences. male experiences of homelessness could suggest a association Femmes SDF by However, the articles in this edition of Homeless in need for further research in this area, and a need their side Europe demonstrate that homelessness and housing to accept that male homelessness is not necessarily Marie-Claire Vanneuville exclusion can indeed be highly gendered experi- the ‘default position’ but is rather one aspect of a ences and suggest that efforts to end homelessness gendered phenomenon. The articles also suggest 17 Homeless Women in would do well to take gender into account. overwhelmingly that gender-specific provision is a Hungary way to address inequalities in homeless people’s Katalin Szoboszlai The link between gender and homelessness can contact with service providers and can go towards have several interpretations and relate to varying preventing homelessness in the first place. -
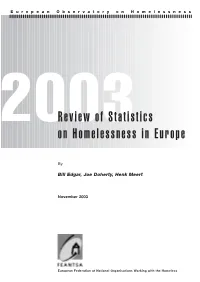
2003Review of Statistics on Homelessness in Europe
European Observatory on Homelessness 2003Review of Statistics on Homelessness in Europe By Bill Edgar, Joe Doherty, Henk Meert November 2003 European Federation of National Organisations Working with the Homeless European Observatory on Homelessness Review of Statistics on Homelessness in Europe Contents Why collect statistics on homelessness?........................................................................ p. 3 Measuring Homelessness ................................................................................................. p. 4 Official Sources and Methods of Data Collection........................................................... p. 8 NAPs/Incl and Developing indicators on homelessness at EU and national level .... p. 11 Statistical update on homelessness in the European Member States....................... p. 13 Conclusions ...................................................................................................................... p. 25 Appendices Appendix 1 The FEANTSA definition of homelessness................................................... p. 27 Appendix 2 The European Observatory on Homelessness Correspondents.................. p. 28 Appendix 3 Homelessness Statistics by Country – sources and summary.................... p. 29 Tables Table 1 Definition of homelessness employed in primary data sources ......................... p. 5 Table 2 The domains of homelessness............................................................................ p. 6 Table 3 The operational definition of homelessness.......................................................