Research Collection
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

FORGOTTEN ADLERIANS� �Harry Dowling� Ever Since Being Attracted by Adlerian Ideas I Have Been Curious About the People Who Made up the Movement Around Adler
! FORGOTTEN ADLERIANS! !Harry Dowling! Ever since being attracted by Adlerian ideas I have been curious about the people who made up the movement around Adler. Did they just make up the numbers? Just form attentive audiences at public meetings? Did they just accept the ideas from above and distribute them !like postmen?! Adlerians recognise the deep need of every human being to belong to humanity and to feel recognised for their independent contributions. It was therefore not surprising to me that those Adlerians whose stories I was able to trace were the very model of the independent, creative mind, inspired to change the world. These people were not mere distributors of another man’s ideas. They made these ideas their own in deep discussion and argument. They also had a hand in forming and developing those ideas, extending their reach into every area of !society, where discouraged people needed help.! As time went on I began to feel that viewing the Adlerian Movement in its first generation as a stage, Adler standing alone in a spotlight, and a chorus behind and an audience in front in darkness obscured the truth. If it irks us as Adlerians that Adler has been largely forgotten outside our ranks, then it ought to make us feel uncomfortable about significant contributors, !who have been left in the darkness.! The Adlerians I discuss below, it must be stressed, are a small, almost random sample. They are !not al the forgotten Adlerians, just some of them.! When I gave a talk on this subject at a recent London meeting, I asked how many of the audience could complete the phrase: the courage to be … Of course all the Adlerians present had no di"culty supplying the word imperfect. -

MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES to MODERN PSYCHOLOGY Dissertation Submitted to the College of Arts and Sciences Of
MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO MODERN PSYCHOLOGY Dissertation Submitted to The College of Arts and Sciences of the UNIVERSITY OF DAYTON In Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in Theology By Matthew Glen Minix UNIVERSITY OF DAYTON Dayton, Ohio December 2016 MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO MODERN PSYCHOLOGY Name: Minix, Matthew G. APPROVED BY: _____________________________________ Sandra A. Yocum, Ph.D. Dissertation Director _____________________________________ William L. Portier, Ph.D. Dissertation Reader. _____________________________________ Anthony Burke Smith, Ph.D. Dissertation Reader _____________________________________ John A. Inglis, Ph.D. Dissertation Reader _____________________________________ Jack J. Bauer, Ph.D. _____________________________________ Daniel Speed Thompson, Ph.D. Chair, Department of Religious Studies ii © Copyright by Matthew Glen Minix All rights reserved 2016 iii ABSTRACT MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO MODERN PSYCHOLOGY Name: Minix, Matthew Glen University of Dayton Advisor: Dr. Sandra A. Yocum This dissertation considers a spectrum of five distinct approaches that mid-twentieth century neo-Thomist Catholic thinkers utilized when engaging with the tradition of modern scientific psychology: a critical approach, a reformulation approach, a synthetic approach, a particular [Jungian] approach, and a personalist approach. This work argues that mid-twentieth century neo-Thomists were essentially united in their concerns about the metaphysical principles of many modern psychologists as well as in their worries that these same modern psychologists had a tendency to overlook the transcendent dimension of human existence. This work shows that the first four neo-Thomist thinkers failed to bring the traditions of neo-Thomism and modern psychology together to the extent that they suggested purely theoretical ways of reconciling them. -

Fundamentos Antropológicos De La Psicoterapia Según Rudolf Allers
Fundamentos antropológicos de la psicoterapia según Rudolf Allers TRABAJO FIN DE GRADO Autor: Oriol Correa Nuño Tutor: Martín F. Echavarría Grado en: Psicología Año: 2018 DECLARACIÓN El que suscribe declara que el material de este documento, que ahora presento, es fruto de mi propio trabajo. Cualquier ayuda recibida de otros ha Sido citada y reconocida dentro de este documento. Hago esta declaración en el conocimiento de que un incumplimiento de las normas relativas a la presentación de trabajos puede llevar a graves consecuencias. Soy consciente de que el documento no será aceptado a menos que esta declaración haya Sido entregada junto al mismo. Firma: Oriol CORREA NUÑO 2 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Evangelio de Juan 8, 32 3 4 Resumen Este documento recoge la propuesta antropológica del médico y filósofo austriaco Rudolf Allers como una manera de acercarse al tratamiento psicoterapéutico. En el texto, se aborda un primer apartado sobre las influencias y críticas del autor a las propuestas psicológicas ya existentes, una segunda parte dedicada a su conceptualización antropológica en base a las facultades del conocimiento y la voluntad, y, en último lugar, una explicación acerca del concepto del carácter y del desarrollo de este según la visión del autor. Partiendo de la explicación adleriana acerca de la neurosis y aprovechando los fundamentos aristotélico-tomistas, desarrolló una conceptualización espiritual del vivir humano capaz de superar las limitaciones materialistas de otras propuestas contemporáneas. Resum Aquest document recull la proposta antropològica del metge i filòsof austríac Rudolf Allers com una manera d'acostar-se al tractament psicoterapèutic. -

Viktor Frankl— Advocate for Humanity
Journal of Humanistic Psychology Volume 46 Number 1 10.1177/0022167805281150AdvocateAlfried Längle, for Humanity Britt-Mari Sykes January 2006 1-11 © 2006 Sage Publications 10.1177/0022167805281150 VIKTOR FRANKL— http://jhp.sagepub.com hosted at ADVOCATE FOR http://online.sagepub.com HUMANITY: ON HIS 100TH BIRTHDAY Summary Viktor Frankl founded the psychotherapeutic school known as Logotherapy and Existential Analysis. Frankl was a medical doctor whose interest in the burgeoning field of psychology and psychoanalysis brought him into contact with the theories of Freud and Adler. Frankl’s familiarity with these two schools of psychotherapy combined with his own philosophical approach to human nature became motivating factors in his desire to reduce “reductionism” and promote a more humanistic approach to the fields of psy- chology, psychotherapy, and medicine. Frankl dedicated both his life and the better part of his career to the topic of meaning. Frankl’s unique contribution to the field of psychology focuses on the effect that meaning, possibility, free- dom, and decision have on an individual’s psychological well-being and devel- opment. This article aims to illustrate Frankl’s unique contribution to psychol- ogy by providing a brief biography and highlighting the contexts in which Logotherapy as a theory emerged. Keywords: Viktor Frankl; biography; logotherapy; existential analysis; meaning; psychoanalysis ALFRIED LÄNGLE, M.D., Ph.D., Dr. h.c.mult., was born in 1951 in Austria and has studied medicine and psychology. He currently works in private practice in Vienna as a psychotherapist. He had a close collaboration with Viktor Frank from 1983 to 1991. He is the founder and presi- dent (since 1983) of the InternationalSociety for Logotherapy and Existential Analysis (Vienna), the founder of the state-approved training school of Existential-Analytical Psychotherapy, and the secretary general of the International Federation of Psychotherapy (IFP). -
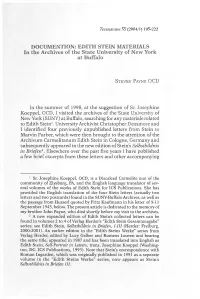
DOCUMENTIONS EDITH STEIN MATERIALS in the Archives of the State University of New York at Buffalo
Teresianum 55 (2004/1) 195-222 DOCUMENTIONS EDITH STEIN MATERIALS In the Archives of the State University of New York at Buffalo S t e v e n P a y n e O C D In the summer of 1998, at the suggestion of Sr. Josephine Koeppel, OCD, I visited the archives of the State University of New York (SUNY) at Buffalo, searching for any materiale related to Edith Stein1. University Archivist Christopher Densmore and I identified four previously unpublished lettere from Stein to Marvin Farber, which were then brought to the attention of the Archivum Carmelitanum Edith Stein in Cologne, Germany and subsequently appeared in the new edition of Stein's Selbstbildnis in Briefen2. Elsewhere over the past five years I have published a few brief excerpts from these letters and other accompanying 1 Sr. Josephine Koeppel, OCD, is a Discalced Carmelite nun of the community of Elysburg, PA, and the English language translator of sev eral volumes of the works of Edith Stein for ICS Publications. She has provided the English translation of the four Stein letters (actually two letters and two postcards) found in the SUNY-Buffalo Archives, as well as the passage from Husserl quoted by Fritz Kaufmann in his letter of 9-11 September 1945, below. The present article is dedicated to the memory of my brother John Payne, who died shortly before my visit to the archives. 2 A new expanded edition of Edith Steins collected letters can be found in volumes 2 to 4 of Verlag Herder s "Edith Stein Gesamtausgabe” series; see Edith Stein, Selbstbildnis in Briefen, I-III (Herder: Freiburg, 2000-2001). -

Introduction Viktor Frankl and Man’S Search for Meaning
Introduction Viktor Frankl and Man’s Search for Meaning Viktor Frankl was born on 26 March 1905 in the Jewish district of Leopold- stadt in Vienna. After living a remarkable life that was shaped by the major intellectual and cultural trends of the twentieth century, he died at the age of ninety-two of heart failure on 2 September 1997 in Vienna. Frankl is best known for writing the highly acclaimed Holocaust testimony Man’s Search for Meaning, and he is also recognized as the founder of his own school of psychotherapy— logotherapy. As the proclaimed successor to Freud’s psychoanalysis and Adler’s individual psychology, logotherapy is promoted as the “third Viennese school of psychotherapy.”1 Defi ned succinctly, logotherapy is a form of existential psychotherapy that is conceived as “therapy through meaning.”2 Frankl’s third school of Logotherapy therefore complements the Freudian will to pleasure, and the Adlerian will to power, by considering the primary motivational force in humans to be the will to meaning. In Freudian and Adlerian therapies the focus is on personal introspection, uncovering character structures, and remem- bering signifi cant (often traumatic) events in the past. In contrast, logotherapy focuses on concrete life conditions and guides the patient to fi nd what is con- sidered the unique and specifi c meaning to their existence. Since his death, three biographies of Frankl have been published. In Vi- enna, Frankl’s disciple Alfred Längle published Viktor Frankl Ein Porträt in 1998. Längle, the head of the International Society for Logotherapy and Existential Analysis, was Frankl’s right-hand man from 1982 until 1991. -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -
RICE UNIVERSITY the Revolt of Sigmund Freud
RICE UNIVERSITY The Revolt of Sigmund Freud (1856-1900) by Allen David Pace, Jr. A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF Master of Arts Thesis Director's Signature: Houston, Texas June, 1968 THE REVOLT OF SIGMUND FREUD (I856-I9OO) Allen David Pace., Jr. Abstract There are few men in the history of man who have so revolutionized man's view of himself as Sigmund Freud. The development of psychoanalysis represented a great intellectual revolution, which overthrew the most cherished concepts of Freud's age. Yet, Freud's personality seems, at least on the surface to contain very little which would impel himself towards such a massive assault on the culture of his times. Unlike so many of the intellectual innovators of the nine¬ teenth century, he was not radically alienated from his society. He accepted the general mores and conventions of his time and seemed to be relatively satisfied with his position in society. Yet there were in his character elements which could give him the strength to rebel, if it became necessary. Freud's position of dominance in his family during his childhood helped to establish his stubborn and inner-directed personality. His enormous ambition found expression in his scientific research, but his hopes of becoming a great physiologist were thwarted by the anti-Semitism at the University of Vienna and by personal financial difficulties. These tendencies were intensified by Freud's belief in the ethnic superiority of the Jew. This combined with Freud's self-image as a pioneer of science made him impervious to social opposition. -

And Edith Stein's Commentary
PHAVISMINDA Journal Volume 18 (2019 Special Issue) Pages: 28-51 Martin Heidegger’s Metaphysical Question of the Nothing (das Nichts) and Edith Stein’s Commentary Jose Conrado A. Estafia Dean of Studies Immaculate Heart of Mary Seminary Tagbilaran City, Bohol [email protected] Abstract Heidegger’s philosophy is a departure from Western metaphysics. In Heidegger’s analysis, the nothing is a manifestation of the fundamental situation of Dasein. Heidegger claims that the nothing is revealed in anxiety. This is explicated in his lecture “What is Metaphysics?” Edith Stein however goes farther: the question of the nothing (das Nichts) leads us to the question of the eternal foundation of finite being. This is the suggestion of Edith Stein in her commentary to the 1929 inaugural lecture of Martin Heidegger at Freiburg University. Accordingly, the manifestation of the nothing in our own being only gives us a hint to a being beyond our finite being. Thus, Heidegger’s question has contributed a solid foundation for Stein’s own inquiry into the eternal being. Keywords: metaphysics, nothing, anxiety, eternal being. In 1929, Heidegger delivered his famous inaugural lecture (Antrittsvorlesung) “What is Metaphysics?” at Freiburg University. The title itself suggests an expectation that the audience would be hearing about metaphysics. Instead, it was a discussion about a particular metaphysical question. For Heidegger this is the right means (die rechte Möglichkeit) to 29 Martin Heidegger's Metaphysical Question introduce metaphysics itself.1 This -

Aportes De Rudolf Allers a La Fundamentación Antropológica De La Psicoterapia
Aportes de Rudolf Allers a la fundamentación antropológica de la psicoterapia Martín F. Echavarría I. Datos biográficos Se cumplen este año los ciento treinta años del nacimiento y los 50 del fallecimiento del psiquiatra y filósofo austríaco Rudolf Allers (1883-1963). Este autor, que en su momento se hizo conocido para el público de habla española por el libro del filósofo francés Louis Jugnet, Rudolf Allers o el Anti-Freud1, es hoy casi completamente desconocido para el público ge- neral, incluidos psicólogos y psiquiatras. No obstante lo cual, sus méritos propios y su lugar en la historia de la psicología y de la psicoterapia hacen que merezca la pena recordar algunas de sus ideas, en este doble aniversario. De él dijo su antiguo discípulo Viktor Frankl, creemos que justamente, que “ha anticipado la psicoterapia del futuro”2. Allers tuvo el mérito de ser el principal representante de una cosmo- visión católica en la época clásica de la psicoterapia. Nació en Viena con el apellido de Abeles, que cambió en 1907 por Allers3. Estudió medicina 1 L. Jugnet. (1975). Rudolf Allers o el Anti-Freud. Madrid: Speiro. 2 V. E. Frankl. (1994). Rudolf Allers como filósofo y psiquiatra, Discurso conmemorativo pronunciado el 24 de marzo de 1964 en la 14ª Reunión ordinaria de la Sociedad Austríaca de Médicos para la Psicoterapia. Logoterapia y análisis existencial. Barcelona: Herder, 239. 3 Ignoramos el motivo exacto del cambio de apellido. Abeles es un apellido judío, a pesar de lo cual Allers niega en su correspondencia con Louis Jugnet ser un converso y afirma que ya, por lo menos, sus padres eran católicos: “D’abord une note d’histoire personnelle. -

The Modern Schoolman
THE MODERN SCHOOLMAN TABLE OF CONTENTS January, 1945 TWO CATHOLIC CRITIQUES OF PERSONALISM 5, Jules A. Baisnee REMARKS ON SOME PROBLEMS CONCERNING SENSATION ,, Rudolf Allers PROFESSOR MARITAIN ON PHILOSOPHICAL CO-OPERATION 8g Wilmon H. Sheldon SCIENCE AND EDUCATION 98 Maximilian Beck EDITORIAL _ „.: _ 105 BOOK REVIEW.... 107 The Philosophy of Bertrand Russell, edited by Paul A Schillp. James Collins BOOK NOTES „ 113 CONTRIBUTORS JULES A. BAISNfiE, S.S., is Associate Professor of Philosophy at the Catholic University of America. He received his Doctorate in Philosophy and in Theology from the University of the Minerva in Rome, and was one of the original members of the Executive Council of the American Catholic Philosoph ical Association. RUDOLF ALLERS is Professor of Psychology in the School of Philosophy of the Catholic University of America. He holds the degree of Doctor of Medicine from the University of Vienna and the University of Munich, and the Doctorate in Philosophy from the Catholic University of Milan. WILMON H. SHELDON is Emeritus Professor of Philosophy in Yale University. MAXIMILIAN BECK, recently a Research Fellow at Yale University, is Assistant Professor of Philosophy at Wilson College. JAMES COLLINS holds a Doctorate in Philosophy from the Catholic University of America. At present he is a Research Fellow in Philosophy at Harvard University. Editor: James A. McWUliams; Executive Editor: Harry R. Klocker; Business Manager: Donald N. Barrett Associate Editors: Leroy E. Endres, James F. Kaufman, F. Christian Keeler, Robert J. Kelly, William G. Kelly, Thomas W. Leahy, Edward L. MaginniB, Vincent-L. Muchlinski, Thomas G. Nottage, Matthew J. O'Connell, Richard M. -

Forty Weeks ~ Sacred Story
Forty Weeks ~ Sacred Story Week Thirty Seven Encouragements & Wisdom E & W reflections are additional helps for your Sacred Story prayer journey. Reflect on them ahead of your prayer exercises for the week or outside of your fifteen- minute prayer windows during the week. Understanding Temptations as Spiritual and Psychological Events Ignatius overcame much in his life with the help of God’s grace. He did not have the benefit we do today of all the medical and psychological insights into the human person. Yet he was a wise and compassionate judge of human nature. In his own way, especially in his discernment rules, he anticipated modern human psychology and its interplay with the spiritual dimension of human nature. This was God’s gift to him and to the Church through him. With his military background, he described the enemy of human nature as a commander of an opposing force who examines the defenses of his opponent. After he has taken inventory, the enemy commander throws all his force at the weakest point in the defense system of his opponent. This was Ignatius’ experience of how the enemy of our human nature attacks us. Those attacks will take advantage of elements in our life history where we are weakened spiritually, morally, psychologically and physically. The attacks are designed to keep our broken hearts—the true effect of all sin and evil—in the dark. The pain of Original Sin, early life trauma and lost innocence fuel your narcissism. The narcissistic ego is closed to the Spirit. It rationalizes, self-empowers, defends, and legitimizes whatever it needs to fill its painful void—to find security.