4260294892477.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
ARSC Journal
A Discography of the Choral Symphony by J. F. Weber In previous issues of this Journal (XV:2-3; XVI:l-2), an effort was made to compile parts of a composer discography in depth rather than breadth. This one started in a similar vein with the realization that SO CDs of the Beethoven Ninth Symphony had been released (the total is now over 701). This should have been no surprise, for writers have stated that the playing time of the CD was designed to accommodate this work. After eighteen months' effort, a reasonably complete discography of the work has emerged. The wonder is that it took so long to collect a body of information (especially the full names of the vocalists) that had already been published in various places at various times. The Japanese discographers had made a good start, and some of their data would have been difficult to find otherwise, but quite a few corrections and additions have been made and some recording dates have been obtained that seem to have remained 1.Dlpublished so far. The first point to notice is that six versions of the Ninth didn't appear on the expected single CD. Bl:lhm (118) and Solti (96) exceeded the 75 minutes generally assumed (until recently) to be the maximum CD playing time, but Walter (37), Kegel (126), Mehta (127), and Thomas (130) were not so burdened and have been reissued on single CDs since the first CD release. On the other hand, the rather short Leibowitz (76), Toscanini (11), and Busch (25) versions have recently been issued with fillers. -

From the Violin Studio of Sergiu Schwartz
CoNSERVATORY oF Music presents The Violin Studio of Sergiu Schwartz SPOTLIGHT ON YOUNG VIOLIN VIRTUOSI with Tao Lin, piano Saturday, April 3, 2004 7:30p.m. Amamick-Goldstein Concert Hall de Hoernle International Center Program Polonaise No. 1 in D Major ..................................................... Henryk Wieniawski Gabrielle Fink, junior (United States) (1835 - 1880) Tambourin Chino is ...................................................................... Fritz Kreisler Anne Chicheportiche, professional studies (France) (1875- 1962) La Campanella ............................................................................ Niccolo Paganini Andrei Bacu, senior (Romania) (1782-1840) (edited Fritz Kreisler) Romanza Andaluza ....... .. ............... .. ......................................... Pablo de Sarasate Marcoantonio Real-d' Arbelles, sophomore (United States) (1844-1908) 1 Dance of the Goblins .................................................................... Antonio Bazzini Marta Murvai, senior (Romania) (1818- 1897) Caprice Viennois ... .... ........................................................................ Fritz Kreisler Danut Muresan, senior (Romania) (1875- 1962) Finale from Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 ......................... Max Bruch Gareth Johnson, sophomore (United States) (1838- 1920) INTERMISSION 1Ko<F11m'1-za from Violin Concerto No. 2 in d minor .................... Henryk Wieniawski ten a Ilieva, freshman (Bulgaria) (1835- 1880) llegro a Ia Zingara from Violin Concerto No. 2 in d minor -

[email protected] CHRISTOPH ESCHENBACH to CO
FOR IMMEDIATE RELEASE March 7, 2018 Contact: Katherine E. Johnson (212) 875-5700; [email protected] CHRISTOPH ESCHENBACH TO CONDUCT THE NEW YORK PHILHARMONIC MOZART’s Piano Concerto No. 22 with TILL FELLNER in His Philharmonic Debut BRUCKNER’s Symphony No. 9 April 19, 21, and 24, 2018 Christoph Eschenbach will conduct the New York Philharmonic in a program of works by Austrian composers: Mozart’s Piano Concerto No. 22, with Austrian pianist Till Fellner as soloist in his Philharmonic debut, and Bruckner’s Symphony No. 9 (Ed. Nowak), Thursday, April 19, 2018, at 7:30 p.m.; Saturday, April 21 at 8:00 p.m.; and Tuesday, April 24 at 7:30 p.m. German conductor Christoph Eschenbach began his career as a pianist, making his New York Philharmonic debut as piano soloist in Mozart’s Piano Concerto No. 24 in 1974. Both Christoph Eschenbach and Till Fellner won the Clara Haskil International Piano Competition, in 1965 and 1993, respectively. Mr. Fellner subsequently recorded Mozart’s Piano Concerto No. 22 on the Claves label in collaboration with the Clara Haskil Competition. The New York Times wrote of Mr. Eschenbach’s conducting Bruckner’s Symphony No. 9 with the New York Philharmonic in 2008: “Mr. Eschenbach, a compelling Bruckner interpreter, brought a sense of structure and proportion to the music without diminishing the qualities of humility and awe that make it so gripping. … the orchestra responded with playing of striking power and commitment.” Artists Christoph Eschenbach is in demand as a distinguished guest conductor with the finest orchestras and opera houses throughout the world, including those in Vienna, Berlin, Paris, London, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Milan, Rome, Munich, Dresden, Leipzig, Madrid, Tokyo, and Shanghai. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 116, 1996-1997
SEIJI OZAWA- MUSIC DIRECTOR »-^uLUlSm*L. 1996-97 SEASON lIMNMSi '"•' Si"* *«£* 1 . >* -^ I j . *• r * The security of a trust, Fidelity service and expertise. A CLkwic Composition - A conductor and his orchestra — together, they perform masterpieces. Fidelity Now Fidelity Personal Trust Services Pergonal can help you achieve the same harmony for your trust portfolio of Trudt $400,000 or more. Serviced You'll receive superior trust services through a dedicated trust officer, with the added benefit of Fidelity's renowned money management expertise. And because Fidelity is the largest privately owned financial services firm in the nation, you Can rest assured that we will be there for the long term. Call JS*^ Fidelity Pergonal Trust Serviced at 1-800-854-2829. You'll applaud our efforts. Trust Services offered by Fidelity Management Trust Company For more information, visit a Fidelity Investor Center near you: Boston - Back Bay • Boston - Financial District • Braintree, MA • Burlington, MA Fidelity Investments' 17598.001 This should not be considered an offer to provide trust services in every state. Trust services vary by state. To determine whether Fidelity may provide trust services in your state, please call Fidelity at 1-800-854-2829. Investor Centers are branches of Fidelity Brokerage Services, Inc. Member NYSE, SIPC. Seiji Ozawa, Music Director Bernard Haitink, Principal Guest Conductor One Hundred and Sixteenth Season, 1996-97 Trustees of the Boston Symphony Orchestra, Inc. R. Willis Leith, Jr., Chairman Nicholas T. Zervas, President Peter A. Brooke, Vice-Chairman William J. Poorvu, Vice-Chairman and Treasurer Mrs. Edith L. Dabney, Vice-Chairman Ray Stata, Vice-Chairman Harvey Chet Krentzman, Vice-Chairman Harlan E. -

FRENCH SYMPHONIES from the Nineteenth Century to the Present
FRENCH SYMPHONIES From the Nineteenth Century To The Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman NICOLAS BACRI (b. 1961) Born in Paris. He began piano lessons at the age of seven and continued with the study of harmony, counterpoint, analysis and composition as a teenager with Françoise Gangloff-Levéchin, Christian Manen and Louis Saguer. He then entered the Paris Conservatory where he studied with a number of composers including Claude Ballif, Marius Constant, Serge Nigg, and Michel Philippot. He attended the French Academy in Rome and after returning to Paris, he worked as head of chamber music for Radio France. He has since concentrated on composing. He has composed orchestral, chamber, instrumental, vocal and choral works. His unrecorded Symphonies are: Nos. 1, Op. 11 (1983-4), 2, Op. 22 (1986-8), 3, Op. 33 "Sinfonia da Requiem" (1988-94) and 5 , Op. 55 "Concerto for Orchestra" (1996-7).There is also a Sinfonietta for String Orchestra, Op. 72 (2001) and a Sinfonia Concertante for Orchestra, Op. 83a (1995-96/rév.2006) . Symphony No. 4, Op. 49 "Symphonie Classique - Sturm und Drang" (1995-6) Jean-Jacques Kantorow/Tapiola Sinfonietta ( + Flute Concerto, Concerto Amoroso, Concerto Nostalgico and Nocturne for Cello and Strings) BIS CD-1579 (2009) Symphony No. 6, Op. 60 (1998) Leonard Slatkin/Orchestre National de France ( + Henderson: Einstein's Violin, El Khoury: Les Fleuves Engloutis, Maskats: Tango, Plate: You Must Finish Your Journey Alone, and Theofanidis: Rainbow Body) GRAMOPHONE MASTE (2003) (issued by Gramophone Magazine) CLAUDE BALLIF (1924-2004) Born in Paris. His musical training began at the Bordeaux Conservatory but he went on to the Paris Conservatory where he was taught by Tony Aubin, Noël Gallon and Olivier Messiaen. -

Regulations & Programme 2021
XXIXe CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO CLARA HASKIL 27.08.-03.09.2021 VEVEY (SWITZERLAND) REGULATIONS & PROGRAMME 2021 REGISTRATION CLOSES: WEDNESDAY 28 APRIL 2021 1 RegulationsFONDATION SI BÉMOL and programme, April 2020, Concours International de Piano Clara Haskil CLARA HASKIL PRIZE WINNERS 1963 No prize awarded 1965 Christoph Eschenbach Germany 1967 Dinorah Varsi Uruguay 1969 No prize awarded 1971 No competition 1973 Richard Goode United States 1975 Michel Dalberto France 1977 Evgeni Koroliov USSR 1979 Cynthia Raim United States 1981 Konstanze Eickhorst Germany 1983 No prize awarded 1985 Nataša Veljković Yugoslavia 1987 Hiroko Sakagami Japan 1989 Gustavo Romero United States 1991 Steven Osborne Scotland 1993 Till Fellner Austria 1995 Mihaela Ursuleasa Romania 1997 Delphine Bardin France 1999 Finghin Collins Ireland 2001 Martin Helmchen Germany 2003 No prize awarded 2005 Sunwook Kim South Korea 2007 Hisako Kawamura Japan 2009 Adam Laloum France 2011 Cheng Zhang China 2013 Cristian Budu Brazil 2015 No prize awarded 2017 Mao Fujita Japan 2019 No prize awarded 2 Regulations and programme, April 2020, Concours International de Piano Clara Haskil I. GENERAL INFORMATION THE CLARA HASKIL COMPETITION The Competition’s purpose is to discover a young musician capable of representing the Competition’s va- lues: musicality, sensitivity, humility, constant re-evaluation, continual striving for excellence, attention to chamber music partners and respect for the composer’s musical text. These values are inspired by the life and career of Clara Haskil, a Swiss pianist born in Bucharest, Romania in 1895 and who died in Brussels in 1960. The programme reflects Clara Haskil’s vast repertoire through a recital, a chamber music performance and a concerto with orchestra. -

Season 2012-2013
27 Season 2012-2013 Sunday, October 28, at 3:00 The Philadelphia Orchestra 28th Season of Chamber Music Concerts—Perelman Theater Mozart Duo No. 1 in G major, K. 423, for violin and viola I. Allegro II. Adagio III. Rondo: Allegro William Polk Violin Marvin Moon Viola Dvorˇák String Quintet in E-flat major, Op. 97 I. Allegro non tanto II. Allegro vivo III. Larghetto IV. Finale: Allegro giusto Kimberly Fisher Violin William Polk Violin Marvin Moon Viola Choong-Jin Chang Viola John Koen Cello Intermission Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25 I. Allegro II. Intermezzo: Allegro ma non troppo III. Andante con moto IV. Rondo alla zingarese: Presto Cynthia Raim Piano (Guest) Paul Arnold Violin Kerri Ryan Viola Yumi Kendall Cello This program runs approximately 2 hours. 228 Story Title The Philadelphia Orchestra Jessica Griffin Renowned for its distinctive vivid world of opera and Orchestra boasts a new sound, beloved for its choral music. partnership with the keen ability to capture the National Centre for the Philadelphia is home and hearts and imaginations Performing Arts in Beijing. the Orchestra nurtures of audiences, and admired The Orchestra annually an important relationship for an unrivaled legacy of performs at Carnegie Hall not only with patrons who “firsts” in music-making, and the Kennedy Center support the main season The Philadelphia Orchestra while also enjoying a at the Kimmel Center for is one of the preeminent three-week residency in the Performing Arts but orchestras in the world. Saratoga Springs, N.Y., and also those who enjoy the a strong partnership with The Philadelphia Orchestra’s other area the Bravo! Vail Valley Music Orchestra has cultivated performances at the Mann Festival. -

19Th September 2021
ZERMATT FESTIVAL ACADEMY 4 TH –19TH SEPTEMBER 2021 The village of Zermatt at the foot of the Matterhorn offers peace and relaxation in one of the most beautiful places in the world. This unique atmosphere, in the middle of a breath-taking natural landscape, enchanted Pablo Casals who regularly spent his summer holidays here in the 1950s and 60s. Together with Franz Seiler, General Manager of the Seiler Hotels Zermatt at that time, Casals founded the Zermatt summer concerts and master classes, to which he invited almost all of the famous musicians of his day as chamber music partners and teachers. This tradition in Zermatt was revived in 2005 with the creation of the Zermatt Music Festival. Chamber music and orchestral concerts are performed by the Scharoun Ensemble and other soloists of the Berliner Philharmoniker in the beautiful Riffelalp Kapelle located at 2’222 meters above sea level, as well as at other locations in Zermatt. Each year, highly gifted students are invited to take part in the Zermatt Festival Academy where they take lessons with members of the Scharoun Ensemble Berlin and perform alongside them in the Zermatt Festival Orchestra. Working intensively with these members of the Berliner Philharmoniker provides a unique educational experience at the highest possible level. After successfully participating in their first year of the academy, students have the opportunity to return for a second edition. By renewing this experience, they can continue to build on what they learnt the previous year. This year, Zermatt Festival Academy 2021 students will have the opportunity to perform in the run-up to the Zermatt Festival by accompanying the finalists of the Clara Haskil Piano Competition under the direction of Stanley Dodds in Vevey (1st–4th September 2021). -

Pressetext 23421 E Clara Haskil.Indd
MUSIKPRODUKTION Press Info: MASTERst RELEASE W A. Mozart: Piano Concerto No. 19 K459 1 Piano Concerto No. 20 K466 R. Schumann: Bunte Blätter Op. 99 Drei Stücklein • Albumblätter Abegg-Variations Op. 1 L. v. Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op. 58* W A. Mozart: Piano Concerto No. 20 K466* CLARA HASKIL, piano RIAS-Symphonie-Orchester FERENC FRICSAY, conductor DEAN DIXON, conductor (Beethoven) studio recording, Berlin, 1953/1954 • *live in Berlin, 1954 Clara Haskil’s recordings from the 1950s enjoy a cult status. In these historically, as well as artistically, impor- tant audio documents, her connection to the best features of the French piano tradition – to whom Haskil be- longed, having studied under Lazare Lévy and Alfred Cortot – can be surveyed, along with the charisma of an unusual personality, whose performances were once described by the critic Antoine Goléa with the words that music herself had been to visit. Haskil’s subtle interpretations of Mozart, Beethoven and Schumann enjoyed particular fame. These studio recordings and live recordings of concert performances of great piano concertos by Mozart (K459 and K466) and Beethoven (Op 58) as well as of two solo works by Schumann (Abegg Varia- tions Op 1 and a selection from “Bunte Blätter” Op 99), released for the first time using the original tapes and re-mastering them, reveal Haskil’s sensitive and natural playing which Ferenc Fricsay compared to the ability to sing on the piano. In addition, this Audite release offers the opportunity to compare and contrast Mozart’s famous concerto in D minor, K466, in the form of a hitherto unpublished live recording from a concert per- formance and in the form of a studio recording made only one day later in January 1954. -

Artes 21-22.Docx
DOI: 10.2478/ajm-2020-0004 Artes. Journal of Musicology Constantin Silvestri, the problematic musician. New press documents ALEX VASILIU, PhD “George Enescu” National University of Arts ROMANIA∗ Abstract: Constantin Silvestri was a man, an artist who reached the peaks of glory as well as the depths of despair. He was a composer whose modern visions were too complex for his peers to undestand and accept, but which nevertheless stood the test of time. He was an improvisational pianist with amazing technique and inventive skills, and was obsessed with the score in the best sense of the word. He was a musician well liked and supported by George Enescu and Mihail Jora. He was a conductor whose interpretations of any opus, particularly Romantic, captivate from the very first notes; the movements of the baton, the expression of his face, even one single look successfully brought to life the oeuvres of various composers, endowing them with expressiveness, suppleness and a modern character that few other composers have ever managed to achieve. Regarded as a very promising conductor, a favourite with the audiences, wanted by the orchestras in Bucharest in the hope of creating new repertoires, Constantin Silvestri was nevertheless quite the problematic musician for the Romanian press. Newly researched documents reveal fragments from this musician’s life as well as the features of a particular time period in the modern history of Romanian music. Keywords: Romanian press; the years 1950; socialist realism. 1. Introduction The present study is not necessarily occasioned by the 50th anniversary of Constantin Silvestri’s death (23rd February 1969). -

Three Great Pianists
Three Great Pianists Clara Haskil (1895-1960) The international piano pedagogue Peter Feuchtwanger pays tribute to the great pianist, one of the foremost Mozart players of the 20th- century, on the occasion of the 50th anniversary of her death. Never, even amongst my most illustrious colleagues, have I met with that incredible and disconcerting facility and pianistic ease, which manifested itself always with a spontaneous, uncalculated, natural flow of the music. That which others achieve by work, research and reflection, seems to come to Clara from Heaven without problems.' Thus wrote Clara Haskil's close friend, Nikita Magaloff. Other colleagues and critics were no less enthusiastic: Dinu Lipatti described her playing as 'the sum of perfection on earth' whilst Rudolf Serkin, much to her embarrassment, nicknamed her 'the perfect Clara'. Despite such admir ation from the twentieth-century's musicians, international fame came to Haskil late in her career due to a tragic life beset by ill health and adversity. Born in Bucharest on January 7, 1895 of Sephardic Jewish parentage, Haskil's precocious musical talent was evident in early childhood. After the death of her father, her uncle brought her to the atten tion of a celebrated piano teacher in Vienna, Anton Door, who described meeting this girl in the Neue Freie Presse in 1902: 'This child is a miracle. She has never had any music lessons beyond being shown the value and names of the notes. More did not seem necessary, for every piece of music that is played to her she repeats by ear without mistake ... [and] .. -
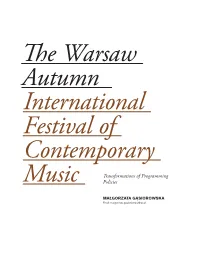
Transformations of Programming Policies
The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Transformations of Programming Music Policies Małgorzata gąsiorowska Email: [email protected]???? Email: The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music Transformations of Programming Policies Musicology today • Vol. 14 • 2017 DOI: 10.1515/muso-2017-0001 ABSTRACT situation that people have turned away from contemporary art because it is disturbing, perhaps necessarily so. Rather than The present paper surveys the history of the Warsaw Autumn festival confrontation, we sought only beauty, to help us to overcome the 1 focusing on changes in the Festival programming. I discuss the banality of everyday life. circumstances of organising a cyclic contemporary music festival of international status in Poland. I point out the relations between The situation of growing conflict between the bourgeois programming policies and the current political situation, which in the establishment (as the main addressee of broadly conceived early years of the Festival forced organisers to maintain balance between th Western and Soviet music as well as the music from the so-called art in the early 20 century) and the artists (whose “people’s democracies” (i.e. the Soviet bloc). Initial strong emphasis on uncompromising attitudes led them to question and the presentation of 20th-century classics was gradually replaced by an disrupt the canonical rules accepted by the audience and attempt to reflect different tendencies and new phenomena, also those by most critics) – led to certain critical situations which combining music with other arts. Despite changes and adjustments in marked the beginning of a new era in European culture. the programming policy, the central aim of the Festival’s founders – that of presenting contemporary music in all its diversity, without overdue In the history of music, one such symbolic date is 1913, emphasis on any particular trend – has consistently been pursued.