Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Radical Failure. the Reinvention of German Identity in the Films of Christian Schlingensief
XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2017. Radical Failure. The Reinvention of German Identity in the Films of Christian Schlingensief. Tindemans, Klass. Cita: Tindemans, Klass (2017). Radical Failure. The Reinvention of German Identity in the Films of Christian Schlingensief. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-019/621 Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. para publicar en actas Radical Failure. German Identity and (Re)unification in the Films of Christian Schlingensief. Bertolt Brecht, the German playwright, made a note about his play The Resistible Rise of Arturo Ui, written in 1941. The play depicts a Chicago gangster boss, clearly recognizable as a persiflage of Adolf Hitler. Brecht writes: “The big political criminals should be sacrificed, and first of all to ridicule. Because they are not big political criminals, they are perpetrators of big political crimes, which is something completely different.” (Brecht 1967, 1177). In 1997 the German filmmaker, theatre director and professional provocateur Christoph Schlingensief created the performance Mein Filz, mein Fett, mein Hase at the Documenta X – the notoriously political episode of the art manifestation in Kassel, Germany – as a tribute to Fluxus-artist Joseph Beuys. -
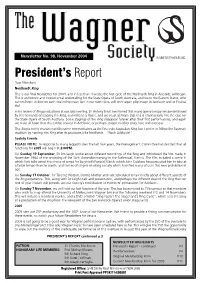
Wagner Oct 04.Indd
Wagner Society in NSW Inc. Newsletter No. 98, November 2004 IN NEW SOUTH WALES INC. President’s Report Dear Members Neidhardt Ring This is our final Newsletter for 2004, and in less than 4 weeks the first cycle of the Neidhardt Ring in Adelaide will begin. This is an historic and monumental undertaking for the State Opera of South Australia, and we in the Eastern States, who cannot hope to dine on such exalted operatic fare in our own cities, will once again pilgrimage to Adelaide and its Festival Hall. In his review of Ring productions at our July meeting, Dr Antony Ernst mentioned that many opera companies are destroyed by the demands of staging the Ring, as moths to a flame, and we must all hope that this is emphatically not the case for the State Opera of South Australia. Some stagings of the Ring disappear forever after their first performances, and again we must all hope that this can be revived in Adelaide, or perhaps staged in other cities here and overseas. This Ring is being characterised by some commentators as the first truly Australian Ring, but I prefer to follow the Bayreuth tradition by naming this Ring after its producer, Elke Neidhardt. “Nach Adelaide!” Society Events PLEASE NOTE: In response to many requests over the last few years, the Management Committee has decided that all functions for 2005 will begin at 2:00PM. On Sunday 19 September, Dr Jim Leigh spoke about different recordings of the Ring and introduced the film made in November 1964 of the recording of the Solti Gotterdammerung in the Sofiensaal, Vienna. -

B Or P 23-01-2012 00:33 Pagina 57
Concepten en objecten - proef 1:B or P 23-01-2012 00:33 Pagina 57 A Campsite for the Avant-Garde and a Church in Cyberspace: Christoph Schlingensief’s Dialogue with Avant-Gardism Anna Teresa Scheer Atta-Atta: a Melancholic Evocation of the Avant-Garde In [19]68 I was eight years old, but I demand that here and now, in 2001, I am allowed to try things out. Christoph Schlingensief (quoted in Heineke & Umathum, eds. 2002: 33) Berlin, January 2003: Christoph Schlingensief’s theatre performance Atta-Atta: Art has Broken Out! premieres in the Volksbühne. A motley group of ‘artists’, including Schlin- gensief, record themselves on video as they make an impassioned appeal for the Ober- hausen short film festival committee to accept their submission. The scene, which ref- erences Schlingensief’s beginnings in experimental film, appears to parody the beliefs its protagonists hold with regard to the radical potential of their own filmmaking vi- sions. The next section of the performance sees Schlingensief as a wild ‘action’ painter, charging at canvases in his studio as his parents look on dubiously from the sofa in the TV room next door. The mise-en-scène – with the parents still visible in their small liv- ing room stage left – then opens out onto a camping site with tents, a setting which could be variously interpreted as a cheap vacation site, a place of temporary habitation, a vulnerable site exposed to the elements or possibly to an attack, a terrorist training site, or a mobile military encampment. In this semiotically ambiguous location, Schlingensief situates a group of artists and eccentrics. -

Practising the Art of Wagnis
Practising the Art of Wagnis An introduction Since mid-2014, we at Iwalewahaus, University of Bayreuth, became increasingly in- terested in the works of Christoph Schlingensief and in what we call the “Schlingensief approach”: a practice more focused on the process instead of the outcomes, without fixed expectations for results – an adventuresome artistic practice. Schlingensief lived this approach as a filmmaker, action artist, director for theatre and opera productions and as a visual artist in as far-flung places as Berlin, Vienna, Bayreuth, Manaus in Brazil, Lüderitz in Namibia, in Zimbabwe or in Burkina Faso. Our research on Schlingensief coincided with exhaustive retrospective exhibitions in both Berlin and New York in 2013 and 2014, which enabled us to conduct an extended overview of his work. Also the impressive exhibition at the German pavilion for the Venice Bienniale in 2011 and the increase in comprehensive text collections and mono- graphs over the last years greatly helped our understanding of Schlingensief’s extensive oeuvre. To date, research on Schlingensief had been mainly conducted within German discourses, but the international exhibitions opened the doors to a more international discussion. A fruitful contribution in this context was the book Christoph Schlingensief: Art Without Borders (Intellect, 2010), edited by Tara Forrest and Anna Teresa Scheer, as it was the first comprehensive publication on Schlingensief in English. With this background in mind, we want to contribute to the still limited interna- tional awareness of the work of Christoph Schlingensief but this time focus on particular topics within his oeuvre. What could have been more fitting than to start with obvious relations? As an institution in Bayreuth, we are confronted with the cult on Richard Wagner every year. -

CINEMA 12 76 the AFRICAN TWIN TOWERS UNVEILING the CREATIVE PROCESS in CHRISTOPH SCHLINGENSIEF's LATE FILM WORK Jeremy Hamers
CINEMA 12 76 THE AFRICAN TWIN TOWERS UNVEILING THE CREATIVE PROCESS IN CHRISTOPH SCHLINGENSIEF’S LATE FILM WORK Jeremy Hamers1 (University of Liège) In 1999, during one of Christoph Schlingensief’s appearances in the German talk show “Grüner Salon” (N-TV), journalist Erich Böhme blamed the director, political performer and dramatic author for having invited Horst Mahler, an (in)famous member of the far right party NPD2, to give a public speech at the Berlin Volksbühne. The interview soon became very tense. But during this short conflictual exchange, Schlingensief made a remarkable statement about broadcasted pictures, the material body and the political. - Böhme: “Don’t you run the risk of promoting the right-wing scene? After all, they could say, ‘Aha! He even includes us in his performance. He gives Mahler, who’s closely linked to the NPD, excellent publicity!” - Schlingensief [interrupting Böhme]: “Mr Böhme, I didn’t want to say this, but when you, in your show… that was interesting… I had Mr Mahler and Mr Oberlercher3 down here at the Volksbühne, on the stage – and one could jump on the stage, and some people actually did. And Oberlercher shouted at some point, ‘Leibstandarte, Leibstandarte!’4 and whatever else. This man is completely nuts. This man is running on empty. Mr Mahler is also running on empty. They are all people who are running on empty. And I’m absolutely not.” - B.: “But why do you put them on the stage?” - S.: “But sitting in your show, Mr Böhme, was Mr Haider.5 And you just played with your glasses while asking in a jokey way, ‘Are you a populist? Are you a neonazi?’ Right? And I was sitting in front of my television screen, I was sitting there – and I wished I could put my hand inside the television! I thought, ‘That just can’t be true. -

The Team of the German Pavilion Welcomes You at the 54Rd International Art Exhibition – La Biennale Di Venezia 2011
The team of the German Pavilion welcomes you at the 54rd International Art Exhibition – La Biennale di Venezia 2011 Our press kit comprises the following information: · Factsheet about the exhibition at German Pavilion · Press information: Christoph Schlingensief at the German Pavilion · Curator‘s Foreword, Susanne Gaensheimer · Curator‘s Acknowledgments, Susanne Gaensheimer · Biography of Christoph Schlingensief · Biography of Susanne Gaensheimer · The German Pavilion from 1948 to 2011 · Press information of the Commissioner Federal Foreign Office (Auswärtiges Amt) · Press information of the Cooperating Partner Institute of Foreign Cultural Relations (ifa) · Press information of the Partner Goethe-Institut · Press information of the Partner AXA Art Insurance The German Pavilion 54rd International Art Exhibition – La Biennale di Venezia 2011 Duration: 4 June – 27 November 2011 Press preview: 1 – 3 June 2011 Press conference German Pavilion: 1 June 2011, 11 am, German Pavilion, Giardini della Biennale Opening of the German Pavilion: 1 June 2011, 2.30 pm, German Pavilion, Giardini della Biennale Official opening of the Biennale di Venezia: 4 June 2011, 10 am, Giardini della Biennale Director of the Bienniale: Bice Curiger Curator of the German Pavilion: Susanne Gaensheimer, Director of MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main Artist at the German Pavilion: Christoph Schlingensief Exhibition title: Christoph Schlingensief Publication: Christoph Schlingensief Susanne Gaensheimer (ed.) The book presents texts by over thirty authors, -

Christoph Schlingensief and the Bad Spectacle
Theron Schmidt, ‘Christoph Schlingensief and the Bad Spectacle’, Performance Research, 16.4 (2011), 27–33 <http://dx.doi.org/10.1080/13528165.2011.606047> accepted author final draft version Christoph Schlingensief, the enfant terrible of contemporary political art, died in August 2010, four years after being diagnosed with lung cancer and just months after the publication in English of a major survey of his work (Forrest and Scheer 2010). Schlingensief’s provocative work blurred the boundaries of artistic genres, as well as easy distinctions between ‘art’ and ‘politics’ – but his work can be grouped into roughly three phases: early work for film and television in the 1980s and 1990s, public actions and interventions in the 1990s and 2000s, and finally pieces that engaged with more traditional theatrical and operatic forms, such as his controversial productions of Hamlet in 2001 and Parsifal from 2004 to 2007. In this short article, I will focus on one of the most famous of his public interventions: a week-long action in Vienna titled Bitte Liebt Österreich! (Please Love Austria!, 2000), which outlives Schlingensief thanks to the availability of an excellent documentary film by Paul Poet (2002). In this action, Schlingensief responded to a far-right turn in Austrian politics by constructing a simulation of a detention centre in a prominent public square in Vienna, populating it with twelve people whom Schlingensief claimed were seeking asylum in Austria at that time. Mimicking the Big Brother TV-show format, the project invited audiences and website visitors to vote each day to ‘evict’ two of the hopeful ‘asylum seekers’; at the end of the week, it was claimed that the remaining contestant would receive a cash prize and the option to marry an Austrian citizen in order to gain the right to remain in the country. -

Tom Tykwer As Auteur
Welcome to Tykwer-World: Tom Tykwer as Auteur David Clarke, Bath ISSN 1470 – 9570 Tom Tykwer as Auteur 7 Welcome to Tykwer-World: Tom Tykwer as Auteur 1 David Clarke, Bath This article argues that German director Tom Tykwer represents a new type of auteur distinct from the model prevalent in the New German Cinema. His films foreground a personal style and rework a limited number of themes, but lack the critical dimension of the New German Cinema’s Autorenfilm . Instead, it can be argued that his status as auteur is more a performative gesture that seeks to establish a particular and recognizable brand in the domestic and international marketplace. The article shows how Tykwer’s films create a unique and consistently recognizable filmic world that is presented as entirely artificial and that bears only a loose connection to contemporary social reality. It is argued that this self- conscious artificiality constitutes both a key component of Tykwer’s personal style and a foregrounding of the creative presence of the director in his films. 1. What Kind of Auteur is Tom Tykwer? Since Tom Tykwer’s international success with Lola rennt in 1998, it has become common to regard this filmmaker as an auteurist , a maker of personal films that can be aligned with a specifically German or European tradition of artistic self-expression in the medium of cinema. The director himself has also stressed the importance of personal self-expression in his filmmaking practice: “was mich am meisten reizt, ist mich selber einzubringen. Nicht so zu tun, als sei ich nicht da. -

The Transformative Power of Art (London, 5-6 Feb 16)
The Transformative Power of Art (London, 5-6 Feb 16) The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN, Feb 5–06, 2016 Jessica Akerman The Transformative Power of Art: Richard Wagner's Gesamtkunstwerk and Christoph Schlingen- sief's participatory experiment Opera Village Africa The aim of this conference is to explore Christoph Schlingensief's participatory art project Opera Village Africa against the backdrop of Richard Wagner's idea of the Gesamtkunstwerk. We wish to approach this topic from the perspective of multiple disciplines including anthropology, art histo- ry, cultural studies, history, musicology, philosophy, postcolonial studies and theatre studies. The founding of the Opera Village Africa in Burkina Faso is inextricably linked with Schlingensief's critical engagement with the writing and music of Richard Wagner, who served Schlingensief throughout his career as a touch-stone for a process of working through the heritage of the German past. The soundtrack to Salvador Dali and Luis Buñuel's Un Chien Andalou (1928) initially evoked Schlingensief's ambiguous fascination for Wagner, which carried through his career work as filmmaker, theatre and opera director, actionist and performance artist. Schlingensief's Parsifal production for the Bayreuth Festival on which he collaborated with the conductor Pierre Boulez in 2004 became pivotal to his subsequent projects. Disillusioned about the elitism and inaccessibility of opera, Schlingensief desired to do justice to the young Wagner's anarchist ideas of a Gesamtkunstwerk that is accessible for everyone. His strategy to enable a diversity of audiences to participate in the Gesamtkunswerk was the Animatograph - a travelling rotating stage, which he developed out of his stage set for Parsifal and toured to a diversity of locations, such as Iceland, Namibia and Neuhardenberg. -

Kunstfestspiele Herrenhausen 2019 Press Kit
KUNSTFESTSPIELE HERRENHAUSEN 2019 PRESS KIT Content 1 Press release: KunstFestSpiele Herrenhausen – Programme 2019 2 Fact sheet 3 Festivalcampus Niedersachsen 4 Festival tent 5 The Herrenhausen Gardens 6 Biography of Ingo Metzmacher 7 Sponsors and partners Content Hendrik von Boxberg Hanover, 16.01.2019 – Press Release PR & Marketing Mobil +49 177 7379207 The KunstFestSpiele Herrenhausen are celebrating their 10th [email protected] birthday in a big way. The star directors Peter Sellars and [email protected] Romeo Castellucci, the performance legend Sylvia Palacios Whitman, the world-class musicians Pierre-Laurent Aimard, Håkan Hardenberger and Gidon Kremer, and the composers Rebecca Saunders und Brigitta Muntendorf are among the Landeshauptstadt Hannover many other artists coming to Hanover for the jubilee festival. KunstFestSpiele Herrenhausen Its events include an addictive Shakespeare marathon and a Alte Herrenhäuser Straße 6b, D-30419 Hannover Frank Zappa concert with the Ensemble Modern, conducted by Ingo Metzmacher. The free-entry big birthday party on 12 May is the highlight of these 10th KunstFestSpiele. Director Ingo Metzmacher introduced the programme of this international festival of the contemporary arts today. Around 90 cross-genre events can be seen in Hanover’s famous gardens, and in the city itself, from 10–26 May 2019. A total of 26 productions and two specially commissioned site-specific installations will be shown, including one own production, a revival for Herrenhausen and an international co-production. 16. January 2019 Advance booking for all events starts today, 16 January 2019, online and by telephone, at the Künstlerhaus Hannover and all major booking offices. The festival’s major venues – the Galerie and Orangerie, the Arne Jacobsen Foyer, the Palace and Ehrenhof and the Großer Garten – are all situated in the opulent setting of the Herrenhausen Gardens. -

Press Kit: Christoph Schlingensief. Kaprow City
Press kit Stiftung Kunstsammlung April 22, 2021 Nordrhein-Westfalen page 1/8 Grabbeplatz 5 40213 Düsseldorf +49 (0) 211 83 81 730 [email protected] Press kit: Christoph Schlingensief. Kaprow City April 24 – October 17, 2021 K20 Press conference and preview Wednesday, May 26, 2021, 10 am, K20 Es sprechen: Prof. Dr. Susanne Gaensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Kathrin Bessen, Curator of the exhibition Aino Laberenz, Estate Christoph Schlingensief Contents Press text “Christoph Schlingensief. Kaprow City” 2 Short biography Christoph Schlingensief 5 Schlingensief in Düsseldorf, Opening day 7 Exhibition preview Download press information and images www.kunstsammlung.de/presse #K20Schlingensief #K20 Press kit 22. April 2021 page 2/8 Christoph Schlingensief Kaprow City April 24 – October 10, 2021 (tbc.) K20 The Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is presenting the multimedia artwork Kaprow City by Christoph Schlingensief (1960–2010): one of the few installations by this important filmmaker, political action artist, and theater and opera director that has survived. The large-scale work, which plays a central role in Schlingensief’s cross-genre oeuvre, was created for a solo exhibition at the Migros Museum für Gegenwartskunst in Zurich in 2007 and has been part of the collection there ever since. The artwork, which has been preserved in its entirety, is now being presented at K20 in Düsseldorf and thus for the first time in a German museum. “Christoph Schlingensief was always active at the interface between genres and did not believe in the unambiguousness of the world. With his dissecting and at the same time generous manner, uninhibitedly critical and simultaneously humorous, as well as with, on the one hand, his tendency to overload and, on the other hand, his directness and above all his profoundly social concern, he has commented more aptly than anyone else on the political and social events of his time. -

E.A. Mccaffrey. Ph D Thesis. Incapacity and Theatricality Copy Including
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UC Research Repository i INCAPACITY AND THEATRICALITY: POLITICS AND AESTHETICS IN THEATRE INVOLVING ACTORS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Theatre and Film Studies in the University of Canterbury by Edward Anthony McCaffrey University of Canterbury 2015 ii Abstract This thesis examines the relationship between people with intellectual disabilities and theatrical performance. This type of performance has emerged from marginalized origins in community arts and therapeutic practices in the 1960s to a place at the forefront of commercial and alternative theatre in the first two decades of the twenty first century. This form of theatre provokes an interrogation of agency, presence, the construction and performance of the self, and the ethics of participation and spectatorship that locates it at the centre of debates current in performance studies and performance philosophy. It is a form of theatre that fundamentally challenges how to assess the aesthetic values and political efficacies of theatrical performance. It offers possibilities for thinking about and exploring theatrical performance in a conceptual and practical space between incapacity and theatricality that looks toward new and different ecologies of meaning and praxis. The methodology of the thesis is a detailed analysis of the presence and participation of people with intellectual disabilities in specific performances that include a 1963 US film, a 1980 Australian documentary, the collaboration of Robert Wilson with autistic poet Christopher Knowles, and recent performances by Christoph Schlingensief, Back To Back Theatre and Jérôme Bel’s collaboration with Theater HORA.