Albertopen Blog Zu Wissenschaftlichem Publizieren 2010–2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
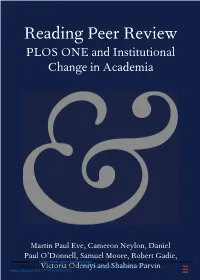
Reading Peer Review
EVE This Element describes for the first time the database of peer review reports at PLOS ONE, the largest scientific journal in ET AL. the world, to which the authors had unique access. Specifically, Reading Peer Review this Element presents the background contexts and histories of peer review, the data-handling sensitivities of this type PLOS ONE and Institutional of research, the typical properties of reports in the journal Change in Academia to which the authors had access, a taxonomy of the reports, and their sentiment arcs. This unique work thereby yields a compelling and unprecedented set of insights into the evolving state of peer review in the twenty-first century, at a crucial political moment for the transformation of science. It also, though, presents a study in radicalism and the ways in which Reading Peer Review Peer Reading PLOS’s vision for science can be said to have effected change in the ultra-conservative contemporary university. This title is also available as Open Access on Cambridge Core. Cambridge Elements in Publishing and Book Culture Series Editor: Samantha Rayner University College London Associate Editor: Leah Tether University of Bristol Publishing and Book Culture Academic Publishing Martin Paul Eve, Cameron Neylon, Daniel ISSN 2514-8524 (online) ISSN 2514-8516 (print) Paul O’Donnell, Samuel Moore, Robert Gadie, Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.33.14, on 25 Sep 2021 at 19:03:04, subject to the Cambridge CoreVictoria terms of use, available Odeniyi at https://www.cambridge.org/core/terms and Shahina Parvin. https://doi.org/10.1017/9781108783521 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. -

Draft 3 August 2010 Jorge L
DATA SHARING, LATENCY VARIABLES AND THE SCIENCE COMMONS Draft 3 August 2010 Jorge L. Contreras* ABSTRACT Over the past decade, the rapidly decreasing cost of computer storage and the increasing prevalence of high-speed Internet connections have fundamentally altered the way in which scientific research is conducted. Led by scientists in disciplines such as genomics, the rapid sharing of data sets and cross-institutional collaboration promise to increase scientific efficiency and output dramatically. As a result, an increasing number of public “commons” of scientific data are being created: aggregations intended to be used and accessed by researchers worldwide. Yet, the sharing of scientific data presents legal, ethical and practical challenges that must be overcome before such science commons can be deployed and utilized to their greatest potential. These challenges include determining the appropriate level of intellectual property protection for data within the commons, balancing the publication priority interests of data generators and data users, ensuring a viable economic model for publishers and other intermediaries and achieving the public benefits sought by funding agencies. In this paper, I analyze scientific data sharing within the framework offered by organizational theory, expanding existing analytical approaches with a new tool termed “latency analysis.” I place latency analysis within the larger Institutional Analysis and Development (IAD) framework, as well as more recent variations of that framework. Latency analysis exploits two key variables that characterize all information commons: the rate at which information enters the commons (its knowledge latency) and the rate at which the knowledge in the commons becomes be freely utilizable (its rights latency). -
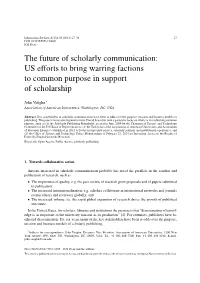
The Future of Scholarly Communication: US Efforts to Bring Warring Factions to Common Purpose in Support of Scholarship
Information Services & Use 33 (2013) 27–36 27 DOI 10.3233/ISU-130689 IOS Press The future of scholarly communication: US efforts to bring warring factions to common purpose in support of scholarship John Vaughn ∗ Association of American Universities, Washington, DC, USA Abstract. Key stakeholders in scholarly communication have been at odds over the purpose, mission and business models of publishing. This piece reviews developments in the United States but with a particular focus on efforts at reestablishing common purpose, such as (1) the Scholarly Publishing Roundtable created in June 2009 by the Chairman of Science and Technology Committee of the US House of Representatives; (2) the Task force of the Association of American Universities and Association of Research Libraries established in 2012 to focus on university presses, scholarly journals and institutional repositories; and (3) the Office of Science and Technology Policy Memorandum of February 22, 2013 on Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research. Keywords: Open Access, Public Access, scholarly publishing 1. Towards collaborative action Anyone interested in scholarly communication probably has noted the parallels in the conduct and publication of research, such as • The importance of quality, e.g. the peer review of research grant proposals and of papers submitted to publication; • The increased internationalization, e.g. scholars collaborate in international networks and journals recruit editors and reviewers globally; and • The increased volume, i.e. the rapid global expansion of research drives the growth of published outcomes. In the United States, for scholars, libraries and institutions the premise is that “dissemination of knowl- edge is as important to the university mission as its production” [4]. -
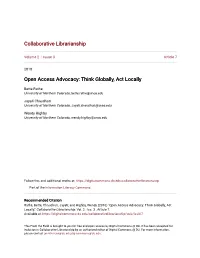
Open Access Advocacy: Think Globally, Act Locally
Collaborative Librarianship Volume 2 Issue 3 Article 7 2010 Open Access Advocacy: Think Globally, Act Locally Bette Rathe University of Northern Colorado, [email protected] Jayati Chaudhuri University of Northern Colorado, [email protected] Wendy Highby University of Northern Colorado, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship Part of the Information Literacy Commons Recommended Citation Rathe, Bette; Chaudhuri, Jayati; and Highby, Wendy (2010) "Open Access Advocacy: Think Globally, Act Locally," Collaborative Librarianship: Vol. 2 : Iss. 3 , Article 7. Available at: https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship/vol2/iss3/7 This From the Field is brought to you for free and open access by Digital Commons @ DU. It has been accepted for inclusion in Collaborative Librarianship by an authorized editor of Digital Commons @ DU. For more information, please contact [email protected],[email protected]. Rathe, Chaudhuri & Highby: Open Access Advocacy Open Access Advocacy: Think Globally, Act Locally Bette Rathe, University of Northern Colorado ([email protected]) Jayati Chaudhuri, University of Northern Colorado ([email protected]) Wendy Highby, University of Northern Colorado ([email protected]) Abstract While the open access movement is a global movement, University of Northern Colorado libra- rians acted locally and collaboratively to make changes to their scholarly communication system. Authors of this article describe how global advocacy affected their local, institutional open access activities that resulted in a library faculty open access resolution at University of Northern Colo- rado Libraries. This article is based on the “Advocating for Open Access on Your Campus” pres- entation at the Colorado Academic Library Consortium Summit on May 21, 2010. -

Open Publications
Open publications Research Services Essential Series Open Research Team 10th Feb 2021 1 Open Research team Caroline Huxtable (Open Access Repository Officer) Imogen Ward-Smith (Open Access Publications Officer) Chris Tibbs (Research Data Officer) Sofia Fernandes (Open Research Manager) www.exeter.ac.uk/research/openresearch/support/contact 2 http://www.exeter.ac.uk/research/researchdatamanagement/support/contact/ 2 Agenda • What is open research? • Why publish open access? • Open access, Symplectic and ORE • Open access policies • Publishing open access on the publisher website [email protected] 3 3 Open research Open research involves openness throughout the research lifecycle: • Openness as part of project planning / concept • Open notebook science • Making research methodology, software, code freely available • Open peer review • Open access to publications • Open data doi.org/10.5281/zenodo.49960 4 Open research lifecycle: Grigorov, Ivo. et al. (2016) ‘Research Lifecycle enhanced by an "Open Science by Default" Workflow’, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.49960 Wikipedia: Open-notebook science is the practice of making the entire primary record of a research project publicly available online as it is recorded. This involves placing the personal, or laboratory, notebook of the researcher online along with all raw and processed data, and any associated material, as this material is generated. Open peer review includes e.g. the author and reviewer identities are disclosed to each other during the peer review process, unlike the traditional peer review process where reviewers are anonymous except to the editors; making reviewers' reports public, rather than disclosing to the authors only, (this may include publishing authors' replies and editors' recommendations); allowing self-selected reviewers to comment on an article, rather than (or in addition to) having reviewers selected by the editors. -

Joe Mcarthur - @Mcarthur Joe Assistant Director, Right to Research Coalition Co-Founder and Co-Lead of the Open Access Button
Barriers and Impact Joe McArthur - @Mcarthur_Joe Assistant Director, Right to Research Coalition Co-founder and Co-Lead of the Open Access Button openaccessbutton.org @OA_Button These slides, videos and more: bit.ly/OI9OAB openaccessbutton.org @OA_Button openaccessbutton.org @OA_Button Launched in Summer 2009. Built around the Student Statement on the Right to Research: access to research is a student right International alliance of 77 graduate & undergraduate student organizations, representing nearly 7 million students We Educate + Advocate for Open Access openaccessbutton.org @OA_Button Todays talk Barriers and impact for: •the Open Access Button; •Open Access. openaccessbutton.org @OA_Button openaccessbutton.org @OA_Button openaccessbutton.org @OA_Button openaccessbutton.org @OA_Button How the Button Works openaccessbutton.org @OA_Button Desktop App Mobile App openaccessbutton.org @OA_Button openaccessbutton.org @OA_Button Mobile Login openaccessbutton.org @OA_Button Mobile Follow the instructions openaccessbutton.org @OA_Button Mobile Menu openaccessbutton.org @OA_Button Mobile Do some research .. browser openaccessbutton.org @OA_Button Mobile Hit paywall openaccessbutton.org @OA_Button Mobile FAQ bit openaccessbutton.org @OA_Button Web Hit paywall openaccessbutton.org @OA_Button The Firefox Web App openaccessbutton.org @OA_Button Web openaccessbutton.org @OA_Button Web Same image, circled button image openaccessbutton.org @OA_Button Web openaccessbutton.org @OA_Button Web Click wishlist. openaccessbutton.org @OA_Button Web Story -

Enabling Research Through Open Access Policies
THE SCHOLARLY PUBLISHING & ACADEMIC RESOURCES COALITION 21 Dupont Circle NW, Suite 800 Washington, DC 20036 (202) 296-2296 www.arl.org/sparc Enabling Research through Open Access Policies Heather Joseph, Executive Director SPARC Washington, DC USA The Issue • Funders invest in research with the expectation that it will result in improvements to the public good. • They increasingly recognize that dissemination is an essential component of the research process. • Research is cumulative - it advances through sharing results. The value of an investment in research is maximized only through use of its findings. www.arl.org/sparc 2 The Issue • Too often, the research results (either publicly or privately funded ) are simply not widely available to the community of potential users. • Internet provides new opportunity to bring information broader audience at virtually no marginal cost, and use it new, innovative ways. Result: Call for new framework designed to allow research results to be more easily accessed and used. www.arl.org/sparc 3 Without Open Access But Article Isn’t Available….. Usability is Key “By open access, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full text of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose…” - The Budapest Open Access Initiative www.arl.org/sparc 6 Greater Access is a Policy Concern “Governments would boost innovation and get a better return on their investment in publicly funded research by making research findings more widely available…. -

Download Full White Paper
Open Access White Paper University of Oregon SENATE SUB-COMMITTEE ON OPEN ACCESS I. Executive Summary II. Introduction a. Definition and History of the Open Access Movement b. History of Open Access at the University of Oregon c. The Senate Subcommittee on Open Access at the University of Oregon III. Overview of Current Open Access Trends and Practices a. Open Access Formats b. Advantages and Challenges of the Open Access Approach IV. OA in the Process of Research & Dissemination of Scholarly Works at UO a. A Summary of Current Circumstances b. Moving Towards Transformative Agreements c. Open Access Publishing at UO V. Advancing Open Access at the University of Oregon and Beyond a. Barriers to Moving Forward with OA b. Suggestions for Local Action at UO 1 Executive Summary The state of global scholarly communications has evolved rapidly over the last two decades, as libraries, funders and some publishers have sought to hasten the spread of more open practices for the dissemination of results in scholarly research worldwide. These practices have become collectively known as Open Access (OA), defined as "the free, immediate, online availability of research articles combined with the rights to use these articles fully in the digital environment." The aim of this report — the Open Access White Paper by the Senate Subcommittee on Open Access at the University of Oregon — is to review the factors that have precipitated these recent changes and to explain their relevance for members of the University of Oregon community. Open Access History and Trends Recently, the OA movement has gained momentum as academic institutions around the globe have begun negotiating and signing creative, new agreements with for-profit commercial publishers, and as innovations to the business models for disseminating scholarly research have become more widely adopted. -

Interactive Open Access Publishing & Collaborative Peer Review for Improved Scientific Communication and Quality Assurance
Interactive Open Access Publishing & Collaborative Peer Review for Improved Scientific Communication & Quality Assurance Ulrich Pöschl Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz www.mpch-mainz.mpg.de/~poeschl European Geosciences Union www.egu.eu EGU Outline Introduction ¾ challenges & perspectives Interactive Open Access Publishing & Collaborative Peer Review ¾ concepts & effects Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) & European Geosciences Union (EGU) ¾ aims & achievements Conclusions ¾ summary & outlook EGU Motivation of Open Access Scientific, educational & economic advantages of free online availability of scientific research publications Educational: ¾ inform & stimulate students & general public ¾ equal opportunities in the information society (global & social) Economic: ¾ liberate distorted scientific information market (subscription/usage, cost/benefit, library budget crisis) ¾ enhance efficiency & facilitate innovation (formatting, distribution, evaluation, archiving, etc.) Scientific: ¾ enhance research impact & productivity ¾ improve quality assurance: bigger need, larger gain and higher importance than “mere increase of impact & productivity” EGU Open Access & Quality Assurance Open Access not a threat to scientific quality assurance but an urgently needed opportunity for improvement Traditional Peer Review: fully compatible with OA ¾ successful OA journals with traditional peer review, e.g.: PLoS Biology, BMC Structural Biology, New J. Physics, etc. Information for Reviewers: strongly enhanced by OA ¾ unlimited & interdisciplinary -

Index of /Sites/Default/Al Direct/2012/June
AL Direct, June 6, 2012 Contents American Libraries Online | ALA News | Booklist Online Anaheim Update | Division News | Awards & Grants | Libraries in the News Issues | Tech Talk | E-Content | Books & Reading | Tips & Ideas Great Libraries of the World | Digital Library of the Week | Calendar The e-newsletter of the American Library Association | June 6, 2012 American Libraries Online Transforming libraries—and ALA— continued When Maureen Sullivan becomes ALA president on June 26, one thing that is certain to continue ALA Annual Conference, from Molly Raphael’s presidency is the thematic Anaheim, June 21–26. If focus on transforming libraries. “Our shared you can’t attend the vision around community engagement and whole ALA Annual transforming libraries will move forward without a break,” Raphael Conference, the Exhibits said. She added that ALA is uniquely positioned to contribute to Only passes starting at efforts underway all over the country—indeed the world—to transform $25 are ideal. In addition libraries into places that engage with the communities they serve.... to the 800+ booths to American Libraries feature explore, the advance Happy Birthday, Prop. 13 reading copy giveaways, the many authors, and Beverly Goldberg writes: “Proposition 13, the the knowledgeable California property tax–cap initiative that unleashed vendors, you can enjoy an era of fervent antitax sentiment and activism dozens of events. You can across the US, is 34 years old today. It wasn’t that attend ALA Poster Californians had tired of government services, Sessions, visit the ALA explains Cody White in his award-winning essay in Conference Store, or drop Libraries & the Cultural Record. -

Ddawson2012.Pdf (700.6Kb)
Open Science and Crowd Science: Selected Sites and Resources Diane (DeDe) Dawson Natural Sciences Liaison Librarian University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan, Canada [email protected] Table of Contents Introduction Open Science Crowd Science Methods and Scope Open Science – Definitions and Principles Open Science – Open Lab Notebooks of Individuals and Lab Groups Open Science – Blogs Crowd Science – Projects for Individuals or Small Teams Crowd Science – Volunteer Distributed Computing Projects The Main Software Organizations Selected Projects Further Sources for Projects Selected Examples of Collaborative Science Sites for Specialists Main Software & Online Tools for Open Science Open Science Conferences and Community Conferences Further Reading/Viewing Videos Reports and White Papers Open e-Books Selected Essays, Articles, and Interviews References Introduction “To take full advantage of modern tools for the production of knowledge, we need to create an open scientific culture where as much information as possible is moved out of people’s heads and laboratories, and onto the network” (Nielsen 2011, p.183). New Internet technologies are radically enhancing the speed and ease of scholarly communications, and are providing opportunities for conducting and sharing research in new ways. This webliography explores the emerging “open science” and “crowd science” movements which are making use of these new opportunities to increase collaboration and openness in scientific research. The collaboration of many researchers on a project can enhance the rate of data-collection and analysis, and ignite new ideas. In addition, since there are more eyes to spot any inaccuracies or errors, collaborative research is likely to produce better quality results. Openness early in the research process alerts others to the work resulting in less duplication of efforts. -

Strategische Und Operative Handlungsoptionen Für Wissenschaftliche Einrichtungen Zur Gestaltung Der Open-Access-Transformation
! ! ! !"#$"%&'()*%+,-.+/0%#$"'1%+2$-.3,-&(/0"'/-%-+ 45#+6'((%-()*$4"3')*%+7'-#')*",-&%-+8,#+ 9%("$3",-&+.%#+:0%-;<))%((;=#$-(4/#>$"'/-+ ! "#$$%&'('#)*! "#$!%$&'()#()!*+,!'-'*+./,01+(!2$'*+,! ")+')&!,-#.)$),-#(%! /"&0!,-#.01! ! +/()+$+/013! '(!*+$!41/&5,561/,01+(!7'-#&383! *+$!9#.:5&*3;<(/=+$,/383!"#!>+$&/(! ! =5(!9+/("!4'.6+&! ! ! ?/+!4$8,/*+(3/(!*+$!9#.:5&*3;<(/=+$,/383!"#!>+$&/(@!! 4$5AB!?$B;C()B!?$B!D':/(+!E#(,3! ! ?/+!?+-'(/(!*+$!41/&5,561/,01+(!7'-#&383@! 4$5AB!?$B!2':$/+&+!F+3"&+$! ! ! 2#3'013+$! %$,3)#3'013+$@!! ! 4$5AB!?$B!4+3+$!D01/$.:'01+$! GH+/3)#3'013+$@!! 4$5AB!?$B!I5&A$'.!95$,3.'((! ! ?'3#.!*+$!?/,6#3'3/5(@!JKB!F'/!LMLJ! !"#$%&'()*+),-#",'. G#,'..+(A',,#()!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!NC! O:,3$'03!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!NCC! ?'(-,')#()!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!NCCC! O:-P$"#(),=+$"+/01(/,!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!CQ! R':+&&+(=+$"+/01(/,!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!QCC! O::/&*#(),=+$"+/01(/,!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!QCCC!