C108 Von Der Groebencover23.07.02.Cdr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Macroeconomic and Monetary Policy-Making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Maes, Ivo Working Paper Macroeconomic and monetary policy-making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit NBB Working Paper, No. 58 Provided in Cooperation with: National Bank of Belgium, Brussels Suggested Citation: Maes, Ivo (2004) : Macroeconomic and monetary policy-making at the European Commission, from the Rome Treaties to the Hague Summit, NBB Working Paper, No. 58, National Bank of Belgium, Brussels This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/144272 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu NATIONAL BANK OF BELGIUM WORKING PAPERS - RESEARCH SERIES MACROECONOMIC AND MONETARY POLICY-MAKING AT THE EUROPEAN COMMISSION, FROM THE ROME TREATIES TO THE HAGUE SUMMIT _______________________________ Ivo Maes (*) The views expressed in this paper are those of the author and do not necessarily reflect the views of the National Bank of Belgium. -

Beihefte Der Francia Bd. 42 1997
Beihefte der Francia Bd. 42 1997 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver- folgt werden. HANNS JÜRGEN KÜSTERS KONRAD ADENAUER UND DIE IDEE EINE R WIRTSCHAFTLICHEN VERFLECHTUN G MI T FRANKREIC H »Ich möchte Ihnen die psychologische Lage in Deutschland erläutern«, begann Bun- deskanzler Adenauer seine Unterredung mit dem französischen Außenminister An- toine Pinay a m 29. April 195 5 in Bonn. »Die Verständigung mit Frankreich is t fü r Deutschland scho n ein alter Gedanke und wurde nicht erst nach dem Zusammen- bruch erfunden. Scho n 192 5 hat die Reichsregierung au f Grundlage eines von zwei Großindustriellen und von mir selbst ausgearbeiteten Vorschlags es versucht, zu ei- ner Zusammenarbeit mit Frankreich zu kommen. Leider ist nichts daraus geworden. Dann kam der Nationalsozialismus. Sie kennen meine Stellungnahme dazu, und Sie kennen auc h di e Einstellun g Hitler s z u Frankreich . Nac h de m Krie g ka m Her r Schuman mit seine m Vorschlag eine r Montangemeinschaft. I n eine m persönliche n Brief erklärte er mir, das Wesentliche an diesem Vorschlag sei die enge Zusammenar- beit zwischen Frankreich und Deutschland. -

José Manuel Barroso's Leadership of the European Commission
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kassim, Hussein Working Paper A new model presidency: José Manuel Barroso's leadership of the European Commission WZB Discussion Paper, No. SP IV 2013-502 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Kassim, Hussein (2013) : A new model presidency: José Manuel Barroso's leadership of the European Commission, WZB Discussion Paper, No. SP IV 2013-502, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/103427 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence -
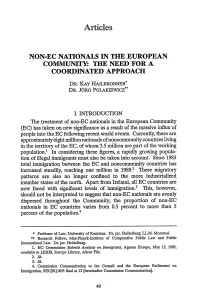
Non-Ec Nationals in the European Community: the Need for a Coordinated Approach
Articles NON-EC NATIONALS IN THE EUROPEAN COMMUNITY: THE NEED FOR A COORDINATED APPROACH DR. KAY HAILBRONNER" DR. JORG POLAKIEWICZ** I. INTRODUCTION The treatment of non-EC nationals in the European Community (EC) has taken on new significance as a result of the massive influx of people into the EC following recent world events. Currently, there are approximately eight million nationals of noncommunity countries living in the territory of the EC, of whom 3.5 million are part of the working population.' In considering these figures, a rapidly growing popula- tion of illegal immigrants must also be taken into account. Since 1983 total immigration between the EC and noncommunity countries has increased steadily, reaching one million in 1989.2 These migratory patterns are also no longer confined to the more industrialized member states of the north. Apart from Ireland, all EC countries are now faced with significant levels of immigration.3 This, however, should not be interpreted to suggest that non-EC nationals are evenly dispersed throughout the Community; the proportion of non-EC nationals in EC countries varies from 0.5 percent to more than 5 percent of the population.4 * Professor of Law, University of Konstanz. Dr. jur. Heidelberg; LL.M. Montreal. ** Research Fellow, Max-Planck-Institute of Comparative Public Law and Public International Law. Dr. jur. Heidelberg. 1. EC: Commission Submits Analysis on Immigrants, Agence Europe, May 15, 1992, available in LEXIS, Europe Library, Alleur File. 2. Id. 3. IL 4. Commission Communication to the Council and the European Parliament on Immigration, 8EC(91)1855 final at 13 [hereinafter Commission Communication]. -

Maes Cover.Indd 1 19/06/2004 22:58:47 EUI Working Paper RSCAS No
EUI WORKING PAPERS RSCAS No. 2004/01 Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s Ivo Maes EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Robert Schuman Centre for Advanced Studies Pierre Werner Chair on European Monetary Union Maes Cover.indd 1 19/06/2004 22:58:47 EUI Working Paper RSCAS No. 2004/01 Ivo Maes, Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s The Robert Schuman Centre for Advanced Studies carries out disciplinary and interdisciplinary research in the areas of European integration and public policy in Europe. It hosts the annual European Forum. Details of this and the other research of the centre can be found on: http://www.iue.it/RSCAS/Research/. Research publications take the form of Working Papers, Policy Papers, Distinguished Lectures and books. Most of these are also available on the RSCAS website: http://www.iue.it/RSCAS/Publications/. The EUI and the RSCAS are not responsible for the opinion expressed by the author(s). EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, FLORENCE ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES Macroeconomic and Monetary Thought at the European Commission in the 1960s IVO MAES EUI Working Paper RSCAS No. 2004/01 BADIA FIESOLANA, SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI) All rights reserved No part of this publication may be reproduced, distributed or utilised in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior permission in writing from the Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Download and print of the electronic edition for teaching or research non commercial use is permitted on fair use grounds—one readable copy per machine and one printed copy per page. -

And the Case of Gas Sector
Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl Data: 25/09/2021 18:48:30 DOI:10.17951/h.2015.59.2.159 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA VOL. XLIX, 2 SECTIO H 2015 Jean Monnet ad personam Chair of Economics of European Integration Yildirim Beyazit University, Ankara ANGELO SANTAGOSTINO The Liberal Bases of EU Competition Policy and the Case of Gas Sector Liberalne podstawy polityki konkurencji UE a rynek gazu Keywords: liberalization, EU, competition, gas Słowa kluczowe: liberalizacja, UE, konkurencja, gaz Introduction The European constructionUMCS has given a fundamental contribution to increase competition among irms. Market exchanges have been hugely facilitated through the creation of the Single European Market. The SEM has given impetus to the economic development. The sequence of enlargements has progressively widened the dimension of the SEM since 1973, giving the enterprises more commercial op- portunities and creating more competition. Firstly, this paper examines the liberal bases of EU competition policy. Secondly, it focuses on liberalizations, speciically on gas market liberalization. 1. Competition in the liberal thought: entry freedom, competition order, state aid, and cartels. In the present section, in order to explore the liberal bases of EU competition policy, attention is concentrated on four aspects of competition theory: I) entry freedom and potential competition; Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl Data: 25/09/2021 18:48:30 160 ANGELO SANTAGOSTINO II) effective competition and the correlated concept of competition order; III) state aid; IV) cartels. Not surprisingly, these elements are also a part of the deinition of competition that can be drawn from the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). -

Final Report Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector
Final Report Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector Study for the European Commission, Directorate Information Society and Media Unit A1 Audiovisual and Media Policies Tender DG EAC 03/04 Contract No.: 2004-5091/001-001 DAVBST Draft: 13 January 2006 Editorial note on the draft of the final report The purpose of this draft is to provide a document for Seminar 2 in January 2006. All empiri- cal data available as of 1 January have been incorporated in the draft. However, the intention of the contractor is to complete the assessment for the final version. At the same time an im- pact assessment focussing on crucial points of the systems found within the EU will be car- ried out on the systems of nominated non-EU countries. Dr. Wolfgang Schulz Project leader III Table of Contents 1. Introduction.......................................................................................................................................................................................... 1 1.1. Objective of the study ................................................................................................................................................................ 1 1.2. Approach and method................................................................................................................................................................ 2 1.2.1. Theoretical background....................................................................................................................................................... -

REY Commission (1967-1970)
COMPOSITION OF THE COMMISSION 1958-2004 HALLSTEIN Commission (1958-1967) REY Commission (1967-1970) MALFATTI – MANSHOLT Commission (1970-1973) ORTOLI Commission (1973-1977) JENKINS Commission (1977-1981) THORN Commission (1981-1985) DELORS Commission (1985) DELORS Commission (1986-1988) DELORS Commission (1989-1995) SANTER Commission (1995-1999) PRODI Commission (1999-2004) HALLSTEIN COMMISSION 1 January 1958 – 30 June 1967 TITLE RESPONSIBLITIES REPLACEMENT (Date appointed) Walter HALLSTEIN President Administration Sicco L. MANSHOLT Vice-President Agriculture Robert MARJOLIN Vice-President Economics and Finance Piero MALVESTITI Vice-President Internal Market Guiseppe CARON (resigned September 1959) (24 November 1959) (resigned 15 May 1963) Guido COLONNA di PALIANO (30 July 1964) Robert LEMAIGNEN Member Overseas Development Henri ROCHEREAU (resigned January 1962) (10 January 1962) Jean REY Member External Relations Hans von der GROEBEN Member Competition Guiseppe PETRILLI Member Social Affairs Lionello LEVI-SANDRI (resigned September 1960) (8 February 1961) named Vice-president (30 July 1064) Michel RASQUIN (died 27 April 1958) Member Transport Lambert SCHAUS (18 June 1958) REY COMMISSION 2 July 1967 – 1 July 1970 TITLE RESPONSIBLITIES REPLACEMENT (Date appointed) Jean REY President Secretariat General Legal Service Spokesman’s Service Sicco L. MANSHOLT Vice-president Agriculture Lionelle LEVI SANDRI Vice-president Social Affairs Personnel/Administration Fritz HELLWIG Vice-president Research and Technology Distribution of Information Joint -

Europäischen Hauses« Vollenden. Die Europapolitik Ludwig Erhards
1 2 3 Den Bau des »europäischen Hauses« vollenden. 4 Die Europapolitik Ludwig Erhards (1963–1966) 5 6 Von Ulrich Lappenküper 7 8 »Funktionale Integration« der Volkswirtschaften des ganzen freien Europa 9 10 Als Ludwig Erhard1 am 16. Oktober 1963 zum zweiten Bundeskanzler der 11 Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde, trat in der Fortführung der Bon- 12 ner Europapolitik kein Kurswechsel, aber eine Klimaveränderung ein. Gewiss, 13 die Vorstellungen des neuen Regierungschefs über die Gestaltung einer freien 14 europäischen Ordnung2 wiesen durchaus Berührungspunkte mit denen seines 15 Vorgängers auf. Wie Konrad Adenauer3 begriff Erhard Europa als geistige 16 Einheit; beide erkannten, dass der Subkontinent seine Rolle als politischer Mit- 17 telpunkt der Welt nach 1945 verloren hatte, dass seine Kräfte nicht ausreichten, 18 um sich vor äußerer Bedrohung zu schützen. Übereinstimmend meinten sie, 19 die politisch-wirtschaftliche Organisation Europas müsse den veränderten Ge- 20 gebenheiten angepasst werden. Einmütig vertraten sie die Auffassung, man 21 könne dessen Einigung nicht ohne Lösung der »deutschen Frage« erreichen. 22 23 24 1 Zu Person und Politik Erhards vgl. Michael K. CARO, Der Volkskanzler Ludwig Erhard, 25 Köln–Berlin 1965; Klaus HILDEBRAND, Ludwig Erhard, 1897–1977, in: Lothar GALL (Hg.), 26 Die großen Deutschen unserer Epoche, Berlin 1985, S. 368–378; Volker HENTSCHEL, Ludwig Erhard. Ein Politikerleben, München–Landsberg am Lech 1996; Volkhard LAITENBERGER, 27 Ludwig Erhard. Der Nationalökonom als Politiker, Göttingen–Zürich 1986; Jess M. LUKOM- 28 SKI, Ludwig Erhard. Der Mensch und der Politiker. Aus dem Amerikanischen von Eva Bor- 29 nemann, Düsseldorf–Wien 1965. 2 Ulrich LAPPENKÜPER, »Ich bin ein wirklich guter Europäer«. -

EUI Working Papers
ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES EUI Working Papers RSCAS 2010/80 ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES THE RISE OF EUROPEAN COMPETITION POLICY, 1950-1991: A CROSS-DISCIPLINARY SURVEY OF A CONTESTED POLICY SPHERE Laurent Warlouzet EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, FLORENCE ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES The Rise of European Competition Policy, 1950-1991: A Cross-Disciplinary Survey of a Contested Policy Sphere LAURENT WARLOUZET EUI Working Paper RSCAS 2010/80 This text may be downloaded only for personal research purposes. Additional reproduction for other purposes, whether in hard copies or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working paper, or other series, the year and the publisher. ISSN 1028-3625 © 2010 Laurent Warlouzet Printed in Italy, October 2010 European University Institute Badia Fiesolana I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy www.eui.eu/RSCAS/Publications/ www.eui.eu cadmus.eui.eu Robert Schuman Centre for Advanced Studies The Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), directed by Stefano Bartolini since September 2006, is home to a large post-doctoral programme. Created in 1992, it aims to develop inter-disciplinary and comparative research and to promote work on the major issues facing the process of integration and European society. The Centre hosts major research programmes and projects, and a range of working groups and ad hoc initiatives. The research agenda is organised around a set of core themes and is continuously evolving, reflecting the changing agenda of European integration and the expanding membership of the European Union. -

Ben... Ch Mit F))
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSFORSCHUNG MAX PLANCK INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETIES MPIfG Discussion Paper 04/6 European Social Policy PDF-Export per Menü and Europe’s Party-Political Center of Gravity, Datei / Als PDF freigeben... 1957–2003 ((Das Blau wird dadurch Philip Manow, Armin Schäfer and Hendrik Zorn besser dargestellt als mit Druck nach Adobe PDF)). PDF-Stil: PDF für r Dokumentverteilung. e p a P n o CS i s s u c s i D G f I P M Philip Manow, Armin Schäfer and Hendrik Zorn European Social Policy and Europe’s Party-Political Center of Gravity, 1957–2003 MPIfG Discussion Paper 04 /6 Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln Max Planck Institute for the Study of Societies Cologne Oktober 2004 © 2004 by the author(s) MPIfG Discussion Paper | ISSN 0944-2073 MPIfG Discussion Papers are refereed scholarly papers of the kind that are publishable in a peer-reviewed disciplinary journal. Their objective is to contribute to the cumulative improvement of theoretical knowl- edge. The papers can be ordered from the institute for a small fee (hard copies) or downloaded free of charge (PDF). Downloads www.mpifg.de Go to Publications / Discussion Papers Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Max Planck Institute for the Study of Societies Paulstr. 3 | 50676 Cologne | Germany Tel. +49 221 2767-0 Fax +49 221 2767-555 www.mpifg.de [email protected] Abstract Europe’s ‘political space,’ its dimensionality and its impact on European policies have received increased academic attention lately. Yet, one very basic element of this politi- cal space, the party composition of EU member states’ governments, has never been studied in a systematic way in the rich literature on European integration. -

EEC Competition Policy in the Early Phase of European Integration
237 EEC Competition Policy in the Early Phase of European Integration Sibylle HAMBLOCH Besides the Common Agricultural Policy (CAP), competition policy was an area of major importance for the European Economic Community (EEC) as it was there that first successes in the European integration process were achieved. With the creation of the EEC in 1958, the Directorate General for Competition (DG IV)1 was not only put in charge of competition policy in a narrower sense, i.e. restrictive practices and monopoly policy, but it was also responsible for state aids and the ensuing discrim- ination between states, and the harmonisation of laws and taxation (EEC Treaty, articles 85-99). In the 1960s the EEC’s first Commissioner for competition policy, Hans von der Groeben, drafted a firmly focused conception. This was crucial as it enabled the supranational authorities to agree on common regulations, or at least approaches, at a high level despite the differences in national competition policies. Cartel and tax harmonisation policies in particular are examples of successful competition policy integration. The aim of this paper is to analyse the circumstances under which EEC compe- tition policy was successful, success being measured by whether common European laws, i.e. regulations and directives,2 were passed. For this purpose we will use the hypothesis that law was passed at a high level if the following requirements were met: (i) a clear conception of competition policy had been established by the DG in charge within the European Commission; (ii)