Table Des Matières / Contents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapports Financiers 2007
Nestlé – Rapports fi Rapports fi nanciers 2007 nanciers 2007 Comptes consolidés du groupe Nestlé Comptes annuels de Nestlé S.A. Nestlé – Rapports fi Rapports fi nanciers 2007 nanciers 2007 Comptes consolidés du groupe Nestlé Comptes annuels de Nestlé S.A. Comptes consolidés du groupe Nestlé Principaux cours de conversion .....................................2 17. Provisions ...............................................................54 Compte de résultat consolidé de l’exercice 2007 .......3 18. Instruments fi nanciers ............................................55 Bilan consolidé au 31 décembre 2007 ........................4 19. Risques fi nanciers ..................................................58 Tableau de fi nancement consolidé pour 20. Capital-actions de Nestlé S.A. ................................67 l’exercice 2007....................................................... 6 21. Actions détenues en propre ...................................67 Mouvements de fonds propres consolidés................. 8 22. Diminution/(augmentation) du fonds de Annexe ...................................................................... 12 roulement ...............................................................68 Principes comptables .................................................. 12 23. Acquisitions d’activités ...........................................68 Modifi cations du périmètre de consolidation ..............23 24. Cessions d’activités ................................................69 Notes ...........................................................................24 -

Corporate Governance Report 30 June 2008
Corporate Governance Report 30 June 2008 Board of Directors Executive Board Contents Preliminary remarks 3 1. Board of Directors 4 1.1 Members of the Board of Directors 4 1.2. Professional background and other activities and functions 6 1.3 Cross-involvement 8 1.4 Internal organisational structure 9 2. Executive Board 12 2.1 Members of the Executive Board 12 2.2. Professional background and other activities and functions 14 General Organisation of Nestlé S.A. 15 Situation at 30 June 2008 © 2008, Nestlé S.A., Cham and Vevey (Switzerland) Concept: Nestlé S.A., Group Governance, Vevey (Switzerland) Design: Nestec Ltd., Corporate Identity and Design, Vevey (Switzerland) 2 Nestlé | Corporate Governance Report June 2008 Preliminary remarks Nestlé S.A. publishes a full Corporate Governance Report, including a separate Compensation Report, which forms an integral part of the annual Management Report. We therewith comply with the requirements of the SWX Swiss Exchange (SWX) and its Corporate Governance Directive. The present document is a partial update of the Nestlé Corporate Governance Report 2007, indicating changes occurred on the Board of Directors and the Executive Board up to 30 June 2008. The annual Management Report is available on-line as a PDF file at http://www.nestle.com in English, French and German. Copies can be ordered at: http://www.nestle.com/MediaCenter/Order. Contact for Media: Nestlé S.A. Corporate Media Relations Avenue Nestlé 55 CH - 1800 Vevey (Switzerland) tel. +41 (0)21 924 22 00 fax +41 (0)21 922 63 34 e-mail: [email protected] Contact for Investors: Nestlé S.A. -

Swiss Re Nominates Former Federal Councillor of Switzerland Kaspar Villiger for Election to Its Board of Directors
News release ab Swiss Re nominates former Federal Councillor of Switzerland Kaspar Villiger for election to its Board of Directors Contact: Zurich, 14 January 2004 – Swiss Re’s Board of Directors will Group Media Relations, Zurich propose Kaspar Villiger, former President of the Swiss Telephone +41 43 285 7171 Confederation and Federal Councillor of Switzerland, for election Investor Relations, Zurich to the Board at its Annual General Meeting on 14 May 2004. Telephone +41 43 285 4444 Kaspar Villiger will be nominated for a four year term of office as an additional non-executive and independent director to its current Board of ten. Peter Forstmoser, Chairman of the Board of Directors of Swiss Re Swiss Reinsurance Company Mythenquai 50/60 said: “I am delighted that Kaspar Villiger has agreed to his nomination. P.O. Box Given his outstanding experience as a former President and CH-8022 Zurich Councillor of the Swiss Confederation and as an entrepreneur he will Telephone +41 43 285 2121 be an excellent addition to our Board of Directors.” Fax +41 43 285 2999 www.swissre.com Kaspar Villiger, a Swiss citizen born in 1941, served as Federal Councillor to Switzerland since his election in 1989 until the end of 2003. During his service he first headed the Federal Military Department until he took over the Federal Department of Finance in 1995, which he led until his retirement in 2003. He was President of the Swiss Confederation in 1995 and 2002. Kaspar Villiger holds a degree in mechanical engineering from the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. -

Machtgier Wer Die Schweiz Wirklich Regiert
Viktor Parma Machtgier Wer die Schweiz wirklich regiert ISBN-10: 3-312-00399-7 ISBN-13: 978-3-312-00399-0 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.nagel-kimche.ch/978-3-312-00399-0 sowie im Buchhandel Machtgier | Viktor Parma Es lächelt der See, doch er ladet nicht zum Bade: Das Wasser ist zu kalt, 6,4 Grad heute, am 5.Februar 2007, und Peter Brabeck ist in Eile. Der Nestlé-Chef springt, leicht verspätet, im Gebäude des Konzernsitzes in Vevey in den sechsten Stock hinauf. Oben angekommen, am Eingang zum großen Mehrzwecksaal, bei herrlicher Aussicht auf Genfersee und Savoyer Alpen, muss er die Schweizer Machtelite zu ihrer jährlichen Geheimkonferenz empfangen. Erste Gäste tun sich an Brötchen gütlich, nippen Fruchtsaft, schlürfen Nespresso. Jeden Februar strömen hier auf leisen Sohlen ganz verstohlen die Spitzen von Politik und Wirtschaft des Landes zusammen. Zu den Geladenen der letzten Jahre gehören zum Beispiel Marcel Ospel (UBS), Daniel Vasella (Novartis), Franz Humer (Roche), Walter Kielholz (CS) und weitere Spitzenverdiener, Christoph Blocher (SVP), Doris Leuthard (CVP), Hans-Rudolf Merz (FDP), Pascal Couchepin (FDP) und andere Bundesräte, Rolf Dörig (Swiss Life), Peter Forstmoser (Swiss Re), Ulrich Gygi (Post) und weitere Konzernchefs, nicht zuletzt Rainer E. Gut (CS-Ehrenpräsident), Gerold Bührer (Economiesuisse) sowie Jean-Pierre Roth (Nationalbank), ferner Fulvio Pelli (FDP), Hans-Jürg Fehr (SP) und die übrigen Spitzen der Regierungsparteien. 2007 stieß, kaum gewählt, der jüngste Parteichef natürlich auch sofort zur Runde, Christophe Darbellay (CVP). Wirtschaftsführer, Politiker und Mandarine nehmen sich für ihre große Jahreskonferenz zur Strategie der Schweiz in der Globalisierung jedes Mal anderthalb Tage Zeit. -
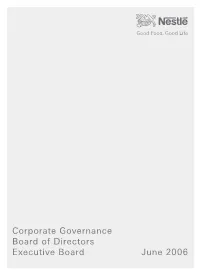
Corporate Governance Board of Directors Executive Board June 2006 Contents
Corporate Governance Board of Directors Executive Board June 2006 Contents Preliminary remarks 3 1. Board of Directors 4 1.1 Members of the Board of Directors 4 1.2 Other activities and functions 6 1.3 Cross-involvement 8 1.4 Elections and terms of office 8 1.5 Internal organisational structure 9 2. Executive Board 12 2.1 Members of the Executive Board 12 2.2 Other activities and functions 14 General Organisation of Nestlé S.A. 16 © 2006, Nestlé S.A., Cham and Vevey (Switzerland) Concept: Nestec Ltd., Corporate Identity and Design, Vevey (Switzerland) 2 Nestlé Corporate Governance Report June 2006 Preliminary remarks Nestlé S.A. publishes a full Corporate Governance Report, which forms an integral part of the annual Management Report. We therewith comply with the requirement of the SWX Swiss Exchange (SWX) and its Corporate Governance Directive, obliging issuers to make key information, with regard to corporate governance practices within their company, available to investors. The full Corporate Goverance Report follows the structure of the SWX Directive. Texts in italics indicate quotations from this Directive. The present document is a partial update of the Nestlé Corporate Governance Report 2005, indicating changes occured on the Board of Directors, the Committes of the Board of Directors and the Executive Board up to 1 June 2006. The annual Management Report is available on-line as a PDF file at www.ir.nestle.com in English, French and German. Copies can be ordered at: http://www.nestle.com/Media_Center/Order.aspx Contact for Media: Nestlé S.A. Corporate Communications Avenue Nestlé 55 CH - 1800 Vevey (Switzerland) tel. -

Transformational Challenge Nestlé 1990–2005
I wanted to stimulate your creative thinking and give Our goal is to earn consumers’ trust as their preferred you a more in-depth feeling of some of the resources Food, Beverage, Nutrition, Health and Wellness Company available in the Group, which are not always suffi ciently both for their own needs and those of their family mem- exploited. We have therefore again organised, not only bers, including their pets. We understand consumers’ the very much appreciated Product Exhibition, but also Nestlé 1990–2005 Challenge Transformational nutritional and emo- a visit to IMD, where we will be exposed to the latest tional needs/prefer- thinking on relevant business issues seen from the aca- TTransformational ransformational ences and provide demic point of view. A visit to our Research Centre at CChallenge hallenge them with innova- Lausanne, which, by the way, celebrates its 10th anni- tive branded prod- versary, will give you the opportunity to get a better idea NNestléestlé 11990–2005990–2005 ucts and services of how those 650 people can help you to achieve a AAlbertlbert PPfifi fffnerfner based on superior higher degree of competitiveness in the market place. HHans-Jörgans-Jörg RRenkenk science and technol- But before starting on the specifi c issues, let me make ogy. By serving our a preliminary remark: it is only fair that I should explain consumers and im- to you how most of our subjects for discussion fi t into proving their quality a broader framework, namely the development strategy of life, everywhere in of our Group. Over the past years, I have had more than the world, we ensure once the opportunity to refl ect on the shape of things profi table, sustain- to come, to use H.G. -

Nestle 55 Vevey, Switzerland Tel: 41-21-924-21-11 Fax: 41-21-924-28-13
P r o f il e e t profile a Coffee, Water and Ki bbl e: r A P r of ile of the F ood and Bever age Giant po r o Nestlé c p r o Oct ober 2005 f P r epar ed by Richard Gir ar d P olar is Institute R esear cher il e corporate Table of Contents Introduction .........................................................................................................1 Chapter One: Organizational Profile .................................................................3 1.1 Operations .....................................................................................................3 1.2 Brands............................................................................................................4 1.3 Executives .....................................................................................................6 1.4 Board of Directors.........................................................................................7 1.5 Public Relations ............................................................................................8 1.6 University Links ............................................................................................8 Chapter Two: Economic Profile .......................................................................11 2.1 Financial Data..............................................................................................11 2.2 Joint Ventures/Alliances.............................................................................11 2.3 Lawsuits.......................................................................................................12 -

Nutritional Needs and Quality Diets
Creating Report Shared Value 2008 – Nutritional needs and quality diets Nutritional Table of contents needs and quality diets Chairman’s message: Creating Shared Value 2 CEO’s message: Creating Shared Value and nutrition 3 The state of nutrition in the world 4 Creating Shared Value About this report 11 Science-based solutions to nutrition needs 14 Report 2008 Improving the quality of food and diets 22 Obesity prevention and weight management 30 Meeting the nutrition requirements of groups with specifi c needs 38 Improving nutrition awareness, knowledge and understanding 48 Improving nutrition in developing countries 60 Future directions and challenges 70 Independent assurance statement 71 Other Creating Shared Value information, including environmental management and health & safety at work, is summarised in our 2008 Management Report and at www.nestle.com/csv Accompanying documents This report is published alongside the following documents: Management Report 2008 Corporate Governance Report 2008 2008 Financial Statements The World’s Corporate 2008 Financial leading Nutrition, Governance Statements Health and Report 2008 Wellness Company including Compensation Consolidated Financial Report 2008 Statements Management of the Nestlé Group Report 2008 Financial Statements In case of doubt or differences of interpretation, of Nestlé S.A the English version shall prevail over the French, German and Spanish text The brands in italics are registered trademarks of the Nestlé Group WorldReginfo - 7854e428-be6c-4705-a32e-9645389684d5 Creating Report -

Consolidated Accounts of the Nestlé Group 137Th Annual Report Of
Consolidated accounts of the Nestlé Group 3 Consolidated income statement for the year ended 31st December 2003 4 Consolidated balance sheet as at 31st December 2003 6 Consolidated cash flow statement for the year ended 31st December 2003 8 Consolidated statement of changes in equity 11 Annex 11 Accounting policies 12 Financial risk management and commodity price risk management 13 Valuation methods and definitions 18 Changes in accounting policies and modification of the scope of consolidation 19 Notes 60Principal exchange rates 61 Report of the Group auditors 62 Financial information – five year review 64 Companies of the Nestlé Group 137th Annual report of Nestlé S.A. 86 Income statement for the year 2003 87 Balance sheet as at 31st December 2003 88 Annex to the annual accounts of Nestlé S.A. 88 Accounting policies 91 Notes to the annual accounts 99 Proposed appropriation of profit 100 Report of the statutory auditors 101 Agenda for the 137th Ordinary General Meeting of Nestlé S.A. 102 Important dates 2004 103 Shareholder information 1 Nestlé Consolidated accounts of the Nestlé Group Consolidated income statement for the year ended 31st December 2003 In millions of CHF Notes 2003 2002 Sales to customers 1 87 979 89 160 Cost of goods sold (37 583) (38 521) Distribution expenses (7 104) (7 112) Marketing and administration expenses (31 081) (31 379) Research and development costs (1 205) (1 208) EBITA (a) 1 11 006 10940 (a) Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation Net other income (expenses) 2 (534) 1 686 of goodwill. Amortisation -

Finanzielle Berichterstattung 2008
Finanzielle Berichterstattung 2008 Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe Jahresrechnung der Nestlé AG © 2009, Nestlé AG, Cham und Vevey (Schweiz) Konzept Nestlé AG, Group Accounting & Reporting Design Nestec AG, SGDU, Corporate Identity & Design Druck Neidhart + Schön Group AG (Schweiz) Papier Dieser Bericht ist auf LuxoArt gedruckt, einem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und anderen kontrollierten, vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifi zierten Quellen. Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe Umrechnungskurse der wichtigsten Währungen 2 15. Immaterielle Werte 38 Konsolidierte Erfolgsrechnung für das Jahr 2008 3 16. Leistungen an Arbeitnehmer 40 Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2008 4 17. Aktienbasierte Vergütungen 46 Konsolidierte Mittelfl ussrechnung für das Jahr 2008 6 18. Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 51 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals mit 19. Finanzanlagen und fi nanzielle Verbindlichkeiten 52 Aufstellung der erfassten Erträge und 20. Finanzrisiken 56 Aufwendungen für das Jahr 2008 7 21. Eigenkapital 65 Anmerkungen 9 22. Mittelfl ussrechnung 68 1. Grundsätze der Rechnungslegung 9 23. Erwerbungen von Geschäftsbereichen 70 2. Veränderung des Konsolidierungskreises 21 24. Veräusserungen von Geschäftsbereichen 71 3. Segmentinformationen 22 25. Verpfl ichtungen aus Leasingobjekten 72 4. Sonstige Erträge/(Aufwendungen), netto 26 26. Transaktionen mit nahestehenden 5. Nettofi nanzierungskosten 26 Gesellschaften oder Personen 73 6. Kosten pro Kostenarten 27 27. Joint Ventures 74 7. Steuern 27 28. Garantien 75 8. Assoziierte Gesellschaften 29 29. Group Risk Management 75 9. Gewinn pro Aktie 30 30. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 76 10. Forderungen aus Warenlieferungen und andere 31. Gesellschaften der Gruppe 76 Forderungen 31 32. Anpassung der Vergleichszahlen infolge der 11. Derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 32 Erstanwendung von IFRIC 14 76 12. Vorräte 33 Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung 77 13. -

Caffè, Acqua E Latte in Polvere Un Profilo Del Gigante Degli Alimenti E
Polaris Institute Caffè, acqua e latte in polvere Un profilo del Gigante degli alimenti e delle bevande NESTLE’ Febbraio 2005 Elaborato da Richard Girard Ricercatore del Polaris Institute www.polarisinstitute.org Tradotto e aggiornato al 30 marzo 2007 da Alberto Castagnola, Sara Symeonides, Giulio Sardi Ricercatori di Oppidum www.osservatorioimprese.org Con la collaborazione di Adriano Cattaneo Portavoce della RIBN www.ribn.it 1 Indice dei contenuti Introduzione Capitolo primo: Profilo organizzativo 1.1 Operazioni 1.2 Marchi 1.3 Dirigenti esecutivi 1.4 Comitato dei Direttori 1.5 Pubbliche relazioni 1.6 Collegamenti con Università Capitolo secondo: Profilo economico 2.1 Dati finanziari 2.2 Iniziative comuni e alleanze 2.3 Denunce legali 2.4 Sicurezza dei prodotti 2.5 Pubblicità Capitolo terzo: Profilo politico 3.1 Collegamenti politici 3.2 Collegamenti con il mondo degli affari 3.3 Contributi politici 3.4 Spese per pressioni sulle istituzioni Capitolo quarto: Profilo sociale 4.1 Impatto socio-economico 4.2 Impatto sulla salute del mondo 4.3 Andamento delle condizioni di lavoro 4.4 Ambiente Capitolo quinto: Profilo degli azionisti Appendice 2 INTRODUZIONE La Nestlé S.A. è stata fondata nel 1866 dal farmacista svizzero Henri Nestlé. Quando la Nestlé si fuse con la società anglo-svizzera Condensed Milk Co. nel 1905, ebbe inizio una espansione che continua ancora oggi. Il gruppo ha oggi assunto dimensioni colossali. Quando si parla di grandi imprese e del loro impatto globale, Nestlé può esserne considerata l’immagine più significativa. La presenza su scala mondiale della Nestlé, insieme ad un fatturato annuale dell’ordine dei 70 miliardi di dollari all’anno (circa 57 miliardi di Euro), le mette a disposizione il tipo di potere normalmente riservato agli Stati. -

Management Report 2005 2005: Excellent Growth; the Management Report Contains Forward Looking Statements Which Refl Ect Management’S Current Views and Estimates
Nestlé Nestlé Management Report 2005 2005: excellent growth; The Management Report contains forward looking statements which refl ect Management’s current views and estimates. The forward Wellness in action acceleration of the Group’s looking statements involve certain risks and The transformational opportunity uncertainties that could cause actual results to differ materially from those contained in transformation the forward looking statements. Potential risks and uncertainties include such factors as general economic conditions, foreign exchange fl uctuations, competitive product and pricing pressures and regulatory developments. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over the French Management ReportManagement 2005 and German text. Excellent growth and another year of delivery of the Nestlé Model > Sales increased 7.5% to CHF 91.1 bn > The Group’s organic growth reached 6.2%, above target of 5-6% > EBITA rose from CHF 10.8 bn to CHF 11.7 bn; margin increased from 12.7% to 12.9% > Net profi t rose 20.7% to CHF 8.0 bn; underlying EPS rose 12.9% Strong cash fl ow facilitates increased returns to shareholders > Strong operating cash fl ow, exceeding CHF 10 bn and free cash fl ow, exceeding CHF 6.5 bn > Completion of fi rst share buy-back programme, with value of CHF 1 bn > Launch of second share buy-back programme, with value of CHF 3 bn > Proposed dividend of CHF 9.– per share, an increase of 12.5% Major strategic brands drive Food & Beverage (F&B) to triple market’s growth rate > F&B achieved 6%