Lucien Favre Meister Mit Dem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Julian Nagelsmann
FFOOTBALLOOTBALL | Page 2 ATHLETICS | Page 6 Suwon grab All 32 last-16 spot as disciplines in ACL heads to 2021 Diamond knockouts League Saturday, December 5, 2020 CRICKET Rabia II 20, 1442 AH Concussion sub GULF TIMES Chahal fi res India to win over Aussies SPORT Page 4 FOOTBALL FOCUS Napoli’s San Paolo stadium Qatar cruise past renamed to honour Bangladesh to edge Maradona closer to Asian Cup Hatem, Afif and Almoez score in the hosts’ 5-0 victory AFC Doha In this November 26, 2020, picture, a man holds atar took a long-awaited a jersey of Diego Maradona outside the San step towards AFC Asian Paolo stadium in Naples. (AFP) Cup China 2023 qualifi ca- tion, scoring an emphatic Reuters Q5-0 win over Bangladesh at Abdullah Bengaluru, India Bin Khalifa Stadium yesterday. Abdulaziz Hatem opened the scoring before Akram Afi f and Al- talian side Napoli’s San Paolo stadium has moez Ali added two goals each as the been offi cially renamed the Diego Armando 2022 FIFA World Cup hosts took all Maradona Stadium after the late Argentina three points in 2020’s fi rst and only striker who led them to their only two Serie Asian Qualifi ers fi xture. IA titles and the UEFA Cup, the city’s council said Asia’s fi rst competitive interna- yesterday. tional match since the Covid-19 Maradona died last week after suff ering a pandemic began, the clash was at- heart attack at his home in the suburbs of Buenos tended by 1,044 socially-distanced Aires, less than a month after his 60th birthday. -

Kuwaitis Brave Coronavirus, Weather to Vote for Change
RABIA ALTHANI 20, 1442 AH SUNDAY, DECEMBER 6, 2020 16 Pages Max 21º Min 16º 150 Fils Established 1961 ISSUE NO: 18301 The First Daily in the Arabian Gulf www.kuwaittimes.net Amir welcomes momentous WHO warns crisis not over 12,638-diamond ring Man United into top four, City 4 agreement to heal Gulf rift 5 as vaccine rollout starts 13 sets new world record 16 stroll as fans welcomed back Kuwaitis brave coronavirus, weather to vote for change Veteran lawmakers punished • Voters turn out in large numbers KUWAIT: Marzouq Al-Ghanem celebrates with his supporters in Abdullah Al-Salem after his victory in the National Assembly elections early today. — Photos by Yasser Al-Zayyat Badr Al-Dahoum celebrates his election win with supporters in Jaber Al-Ali early today. By B Izzak According to unofficial results which place in the first and fifth constituencies could change, at least 14 pro-government respectively. The opposition, formed mainly KUWAIT: Kuwaiti voters defied rain and lawmakers failed to get re-elected in all the of Islamists, appears headed to win around coronavirus measures and turned out in large five constituencies. At the same time, at least 20 seats, and is expected to have a few more numbers yesterday to vote for a big change, seven opposition figures also failed to retain supporters. At least 10 Islamists are certain to reelecting only 18 of the 50 members of the their seats. The Islamic Constitutional have seats in the Assembly. Final results are outgoing National Assembly in what appears Movement (ICM), the political arm of the expected later today. -

Suwon Grab Last-16 Spot; ACL Heads to Knockouts Cannavaro on the Brink of Sack Again at China’S Guangzhou DOHA: Suwon Samsung Bluewings Grabbed the Last Park
Established 1961 15 Sports Sunday, December 6, 2020 Suwon grab last-16 spot; ACL heads to knockouts Cannavaro on the brink of sack again at China’s Guangzhou DOHA: Suwon Samsung Bluewings grabbed the last Park. “We were talking for the past couple of days that available round-of-16 spot in the Asian Champions the players should not give up and I think that played a League with a 2-0 win over Vissel Kobe in the compe- role in us winning today,” he added. tition’s final group stage game on Friday. The South Koreans needed to win by a two-goal margin to over- Jeonbuk save pride take China’s Guangzhou Evergrande on goal difference Earlier on Friday, Jeonbuk Hyundai Motors out- and that was exactly what they did as Kim Gun-hee classed Shanghai SIPG with a 2-0 victory, a result that and Lim Sang-Hyeob each struck in the second half at helped the two-time champions from South Korea bow the Khalifa International Stadium in Doha. out of the competition with some pride intact. Sydney Vissel Kobe were the first team to qualify for the FC meanwhile claimed a 1-1 draw with Yokohama F next phase in the three-team Group G while two-time Marinos by holding the group toppers from Japan champions Guangzhou Evergrande had already com- despite finishing bottom with five points from six pleted their four matches with five points and were matches, which included just one win. With Shanghai hoping Suwon slipped up in their last-gasp bid to make SIPG and Yokohama F. -

Servette Fc 1890
SERVETTE FC 1890 www.super-servette.ch Trainer / Entraîneur 1921-29 Teddy Duckworth ENG 1929 Frido Barth ENG 1930-31 Teddy Duckworth ENG 1931-35 Karl Rappan AUT/CH 1935-36 Leo Weisz UNG 1936-37 Robert Pache, Albert Guinchard CH/CH 1937 Otto Hoess (12.37) AUT 1937-42 André Trello Abegglen CH 1942-43 Léo Wionsowski CH 1943-48 Fernand Jaccard CH 1948-53 Karl Rappan AUT/CH 1953-54 Albert Châtelain CH 1954-55 Karl Rappan + Albert Châtelain AUT/CH, CH 1955-56 Karl Rappan + Théo Brinek AUT/CH,AUT 1956-57 Karl Rappan AUT/CH 1957-58 Jenö Vincze UNG 1958-59 Frank Séchehaye CH 1959-63 Jean Snella FRA 1963-66 Lucien Leduc FRA 1966-67 Roger Volanthen CH Bela Gutmann (10.66) UNG Gilbert Dutoit (03.67) CH 1967-72 Jean Snella FRA Henri Gillet (09.71) CH Jürgen Sundermann (01.72) GER 1972-76 Jürgen Sundermann GER 1976-82 Peter Pazmandy UNG/CH Guy Mathez (05.82) CH 1982-85 Guy Mathez CH 1985-87 Jean-Marc Guillou FRA Thierry De Choudens (09.86) CH 1987-88 Thierry De Choudens CH Jean-Claude Donzé (01.88) CH 1988-89 Jean-Claude Donzé CH 1989-90 Peter Pazmandy UNG Ruud Krol (03.90) NED 1990-91 Gilbert Gress FRA/CH 1991-92 Jean Thissen BEL Bernard Mocellin CH +Jacky Barlie CH +Heinz Hermann (Interim 09.91) CH Michel Renquin (10.91) BEL 1992-93 Michel Renquin BEL Ilija Petkovic (03.93) SRB 1993-95 Ilija Petkovic SRB Bernard Challandes (03.95) CH 1995-96 Bernard Challandes CH Umberto Barberis (10.95) CH 1996-97 Vujadin Boskov SRB Guy Mathez (01.97) CH 1997-00 Gérard Castella CH Bosko Djurovski (Interim 10.99) MKD René Exbrayat (11.99) FRA 2000-02 Lucien Favre CH 2002-03 Roberto Morinini CH Adrian Ursea (03.03) ROM 2003-05 Marco Schällibaum CH Adrian Ursea (Interim 08.04) ROM + Stefano Ceccaroni ITA/CH + Adrian Ursea (10.04) ROM 2004-05 Diego Sessolo (1. -
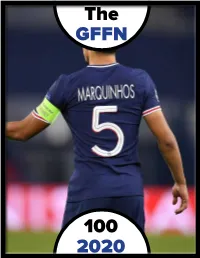
THE GFFN 100 2020 | TEN to WATCH Mohamed-Ali Cho | 16 | Angers SCO
The GFFN 44 Zinedine FERHAT Club: Nîmes Olympique Born: 03/03/1993 Position: Forward At Club Since: 2019 League 100Apps 2020: 21 2020 In a year unlike any other, we’re happy and proud to have come together to bring you the Get French Football News 100 2020. In a year when many may have endured heartbreak, loss, dejection, and grief in very real terms, putting what has happened on the football pitch in stark relief to the world around us. It is true, of course, that what we should be prioritising in a difficult time is our mental and physical health, as well as that of those around us, rather than football. But even if there are more important things in life (and there are), we should also acknowledge the positive role that sport can play in our lives. Even if virtually, fandom brings us together, connecting us with a global network of supporters, each of us as eager as the last to debate the merits of Memphis Depay, agonise over Dimitri Payet’s inconsis- tent form, or get into a lather over how Kylian Mbappé — isn’t — top of this list. To that end, we welcome debate and conjecture over these players rankings and inclusions, albeit with the caveat that with such a small sample size (most French-based teams played just 26 League Apps 2020), there is necessar- ily more variance, and a good (or poor) run of form stretching a half dozen matches or so can have an outsize effect on a player’s placement. Still, though, this was once again an enjoyable exercise in what was an historic year for French football, given the success of Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais in the Champions’ League. -

Statistiques Officielles Saison 2020/21
STATISTIQUES OFFICIELLES SAISON 2020/21 LES STATISTIQUES OFFICIELLES DE LA LIGUE 1 UBER EATS PAR Sommaire 5 SOMMAIRE 01 TOPS ÉQUIPES Page 25 02 TOPS JOUEURS Page 43 03 BILAN PAR ÉQUIPES Page 57 4 Statistiques Officielles de Ligue 1 Uber Eats - 2020/21 Bilan 7 RECORDS DE BUTS ENCAISSÉS PAR LE LOSC EN LIGUE 1 UBER EATS BUTS SAISON ENCAISSÉS/ MATCHS BUTS ENCAISSÉS MATCH 2020/21 0.61 38 23 1953/54 0.65 34 22 LOSC LILLE 2013/14 0.68 38 26 2015/16 0.71 38 27 RECORDS DE POINTS POUR LE LOSC 2004/05 0.76 38 29 EN LIGUE 1 UBER EATS SAISON POINTS DIFFÉRENCE CLASSEMENT DE BUTS FINAL Le LOSC Lille n’a encaissé que 23 buts en 2020/21 83 41 1ER Ligue 1 Uber Eats cette saison, son 2e meilleur total lors ER 2010/11 76 32 1 d’une même saison dans l’élite derrière 1953/54 (22). E 2018/19 75 35 2 C’est en revanche son meilleur total sur une saison à 20 2011/12 74 33 3E clubs. 2013/14 71 20 3E 4 Le LOSC Lille a remporté le 4e titre de champion de France de son histoire après 1946, 1954 et 7 2011. Le LOSC est le 3e club à remporter au moins Le LOSC n’a encaissé que 7 buts en seconde période en 2 titres de Ligue 1 Uber Eats au 21e siècle après Ligue 1 Uber Eats 2020/21. Depuis 1950/51, seul le FC l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain (7 Girondins de Bordeaux en 2005/06 a fait mieux après chacun).