Lepidoptera, Pterophoridae) 185-226 Beitr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Memoria Ambiental
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN REVISIÓN - ADAPTACIÓN A LEY 19/2003 DE DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS JUNIO 2012 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BETANCURIA MEMORIA AMBIENTAL GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y AYUNTAMIENTO ORDENACIÓN TERRITORIAL DE DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANEAMENTO BETANCURIA DE URBANISMO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN AYUNTAMIENTO DE REVISIÓN - ADAPTACIÓN A LEY 19/2003 DE BETANCURIA DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS ÍNDICE GENERAL. FUENTES CONSULTADAS Y BIBLIOGRAFÍA……………………………….…2 ÍNDICE………………….……………………………………….……………..……..4 MEMORIA AMBIENTAL…………………………………………………..………..5 ANEXO DE LA MEMORIA AMBIENTAL DE DETERMINACIONES INCORPORADAS EN EL ISA………………..………….…………………...…..52 MEMORIA AMBIENTAL 1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN AYUNTAMIENTO DE REVISIÓN - ADAPTACIÓN A LEY 19/2003 DE BETANCURIA DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS FUENTES CONSULTADAS AA.VV. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la provincia de Las Palmas. Escala 1:200.000. Dirección General de la Producción Agraria, 1988 AA.VV. Mapa Geológico de España. Instituto Tecnológico Geominero de España. Hojas de Betancuria, Telde y San Bartolomé de Tirajana. Mapas a Escala 1:25.000 y Memoria. Madrid. 1990 Documento de Avance – Normas Subsidiarias Municipales. Faustino García Márquez. 1998 Documento de Avance – Plan General de Ordenación de Betancuria. Gesplan, SA. Diciembre 1999 Documento del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, Informe de Sostenibilidad y Memoria Ambiental. Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 2009 Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, aprobado definitivamente y de forma parcial por Decreto 100/2001, de 2 de abril, subsanado de las deficiencias no sustanciales por Decreto 159/2001, de 23 de julio, y aprobado definitivamente en cuanto a las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística por Decreto 55/2003, de 30 de abril. -

Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista De Lepidopterología, Vol
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Rosete, J.; Gonçalves, A. R.; Nunes, J.; Pires, P.; Marabuto, E. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2015 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 44, núm. 176, diciembre, 2016, pp. 615-643 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45549852010 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 44 (176) diciembre 2016: 615-643 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2015 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, J. Rosete, A. R. Gonçalves, J. Nunes, P. Pires & E. Marabuto Abstract 39 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna and one species deleted, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors and others in 2015. In addition, second and third records for the country, new province records and new food-plant data for a number of species are included. A summary of recent papers affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2015 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores e outros, principalmente no ano de 2015, são adicionadas 39 espécies de Lepidoptera à fauna de Portugal e uma é retirada. -
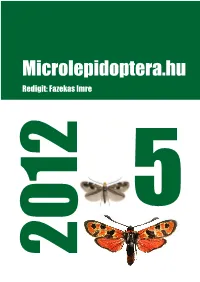
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Microlepidoptera.Hu 3. (2011.09.30.)
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 3 2011 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 3: 1–141. http://www.microlepidoptera.hu 2011.09.30. Tartalom – Contents BUSCHMANN, F., FAZEKAS, I. & PASTORÁLIS, G.: Tizenhárom új molylepkefaj Magyarországról – Thirteen new micro‐moths in Hungary (Lepidoptera: Tineidae, Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae) ……………………………………………………... 3–13 BUSCHMANN, F., FAZEKAS, I. & PASTORÁLIS, G.: A magyarországi Swammerdamia fajcsoport revíziója Revision of the Swammerdamia species‐group in Hungary (Microlepidoptera: Yponomeutidae) ………………………………………………………….. 15–24 FAZEKAS, I.: Az Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) új tápnövényei Magyarországon – New foodplants of Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) in Hungary (Lepidoptera: Tortricidae) ……………………………………………………………………………………….. 25–28 FAZEKAS, I. & LÉVAI, SZ.: A Chilo luteellus (Motschulsky, 1866), a Ch. suppressalis (Walker, 1863) és a Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) magyarországi előfordulásáról – On the occurrence of Chilo luteellus (Motschulsky, 1866), Ch. suppressalis (Walker, 1863) and Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) in Hungary -

Lepidoptera) of North-Eastern Sicily with New Distributional Records
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 15.viii.2008 Volume 48(1), pp. 197-208 ISSN 0374-1036 A survey of Pterophoridae (Lepidoptera) of North-Eastern Sicily with new distributional records Vera D’URSO1), Giovanni MARCHESE1) & Jacques NEL2) 1) Department of Animal Biology “Marcello La Greca”, University of Catania, Via Androne 81, 95124 Catania, Italy; e-mail: [email protected] 2) 8 Avenue Fernard Gassion, F-13600 La Ciotat, France Abstract. A survey of north-eastern Sicilian biotopes allowed us to increase the number of the Pterophoridae known on the island to a total of 59 species. The genus Adaina Tutt, 1905, and seven species, Adaina microdactyla (Hübner, 1813), Wheeleria spilodactyla (Curtis, 1827), Capperia celeusi (Frey, 1866), Capperia fusca (Hofmann, 1898), Stenoptilia grisescens Schawerda, 1933, Stenoptilia mariaeluisae Bigot & Picard, 2002, and Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837), are new for Sicily, and basic ecological data are given for these species. Some old records are confi rmed and notes and comments on others are given. Key words. Microlepidoptera, Pterophoridae, plume-moths, checklist, new records, faunistics, host plant, Italy, Sicily Introduction The Pterophoridae are called Plume Moths because of a feather-like appearance of their wings. They possess a cleft in the fore wing and a double cleft in the hind wing, lacking only in the subfamily Agdistinae with uncleft wings. Nearly 1,200 species of the Pterophoridae belonging to 90 genera are known worldwide, and are found in almost all biotopes (GIELIS 2003). The data on the pterophorid biology in the Mediterranean have been nearly entirely given from the south of France and Corsica by French authors (NEL 1986, 1987, 2002; GIBEAUX & NEL 1991). -

Plume Moths (Lepidoptera: Pterophoridae) of Israel
ISRAEL JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Vol. 50 (1), pp. 163–177 (31 December 2020) A review of the plume moth fauna (Lepidoptera: Pterophoridae) of Israel Petr Ya. Ustjuzhanin1,2*, Vasiliy N. Kovtunovich3, Vasiliy D. Kravchenko4, Aidas Saldaitis5, Günter C. Müller6 & Amir Weinstein4 1Altai State University, 61 Lenin Str., Barnaul, 656049 Russia. E-mail: [email protected] 2Biological Institute, Tomsk State University, 36 Lenin Prospekt, Tomsk, 634050 Russia 3Moscow Society of Nature Explorers, 2 Bolshaya Nikitskaya Str., Moscow, 125009 Russia. E-mail: [email protected] 4The Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University, Tel Aviv, 69978 Israel 5Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania 6Department of Microbiology and Molecular Genetics, IMRC, Kuvin Centre for the Study of Infections and Tropical Diseases, Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel *Corresponding author ABSTRACT Available information on the Israeli plume moths is rather scarce and outdated. Prior to our investigation, 41 species were recorded from the country. The material from the Steinhardt Museum of Natural History in Tel Aviv yielded another four species: Agdistis bellissima Arenberger, 1975; Marasmarcha ehrenbergiana (Zeller, 1841); Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758); and Wheeleria so- beidae (Arenberger, 1981). Five species are endemics or sub-endemics of Israel: Hellinsia aegyptiacus (Rebel, 1914); Hellinsia scholastica (Meyrick, 1924); Agdistis pygmaea Amsel, 1955; Agdistis nigra Amsel, 1955; Capperia fletcheri Adamczewski, 1951. The diversity of ecologies in Israel suggests that the plume moth fauna of the country may substantially increase through a targeted collection effort. KEYWORDS: Biodiversity, Pterophoridae, Israel, Mediterranean, Middle East, fauna, plume moths. INTRODUCTION Israel is situated at the eastern part of the Mediterranean Basin along the Levant Rift System (Picard 1943; Mart et al. -

Redalyc.The Lepidoptera of Parque Natural Do Tejo Internacional
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Marabuto, E.; Pires, P.; Corley, M. F. V. The Lepidoptera of Parque Natural do Tejo Internacional, Portugal (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 41, núm. 161, marzo, 2013, pp. 5-42 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45528755001 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 5-42 The Lepidoptera of Parque 14/3/13 20:38 Página 5 SHILAP Revta. lepid., 41 (161), marzo 2013: 5-42 CODEN: SRLPEF ISSN: 0300-5267 The Lepidoptera of Parque Natural do Tejo Internacional, Portugal (Insecta: Lepidoptera) E. Marabuto, P. Pires & M. F. V. Corley Abstract A project to identify hotspot areas in Portugal especially rich in Lepidoptera biodiversity has initiated field work in recent years in the Tejo Internacional Natural Park, in the extreme east of central Portugal. To date, this has confirmed the presence of 461 butterfly and moth (Rhopalocera and Heterocera) species belonging to 49 different families. This Natura 2000 site and Natural Park was selected for conservation for its birds of prey and steep ravines supporting well preserved Mediterranean scrubland. However, the Lepidoptera communities were previously unknown. This work is aimed at filling this knowledge-gap and raising the Lepidoptera profile in the area, which is moderately rich in butterflies and moths in a national context. -

Memoria Informativa
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN ADAPTACIÓN A LEY 19/2003 DE DIRECTRICES, A LA L6/2009 DE MEDIDAS URGENTES Y AL TR DE LA LEY DEL SUELO (RDL 2/2008) JUNIO 2012 POR POR EL MISMO EL 18 DE JUNIO DE 2012, Y EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BETANCURIA 2013. DE ENERO 22 DE DE ORIENTAL TÉCNICA LAPONENCIA POR REQUERIDOS ONDICIONANTES APROBACIÓN PROVISIONAL TOMO I. MEMORIA INFORMATIVA GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, AYUNTAMIENTO ENTO QUE INTEGRA EL APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, CON EL APROBADO PROVISIONALMENTE TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL DE VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL BETANCURIA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANEAMENTO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U. ACUERDO DEL PLENO DE 27 DE FEBRERO DE 2013 POR EL QUE SE ACUERDA LA SUBSANACIÓN DE LOS C LOS DE SUBSANACIÓN LA SEACUERDA QUE EL POR 2013 DE FEBRERO DE 27 DE PLENO DEL ACUERDO DOCUM PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADAPTACIÓN A LEY 19/2003 DE DIRECTRICES, A LA BETANCURIA L6/2009 DE MEDIDAS URGENTES Y AL TR DE LA LEY DEL SUELO (RDL 2/2008) ÍNDICE GENERAL. TOMO I FUENTES CONSULTADAS Y BIBLIOGRAFÍA ……………...……………….…2 INDICE DE PLANOS…………………………………………….……………..…..4 INDICE.…………………………………..…...……………….……………………..5 INFORMACIÓN URBANÍSTICA.…………………………………………….…….9 CIA TÉCNICA ORIENTAL DE 22 DE ENERO DE 2013. DE ENERO 22 DE DE ORIENTAL CIATÉCNICA MENTE POR EL MISMO EL 18 DE JUNIO DE 2012, Y EL YEL 2012, DE JUNIO DE18 EL MISMO EL POR MENTE INFORMACIÓN AMBIENTAL.…………………………………….…..….……...98 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.…………………………………………..…...….171 -

Non-Commercial Use Only
BOLL. SOC. ENTOMOL. ITAL., 150 (2): 55-79, ISSN 0373-3491 31 AGOSTO 2018 Giorgio BALdIzzonE* - Stefano SCALERCIo** Contributo alla conoscenza dei microlepidotteri dell’Aspromonte (Lepidoptera) Riassunto: In questo lavoro vengono riportati i risultati di una settimana di raccolta di microlepidotteri effettuata con diverse tecniche in Calabria, più precisamente sull’Aspromonte e alla foce della Fiumara Amendolea. Sono state rinvenute 159 specie di cui Eana nervana (Tortricidae) e Mer- rifeldia garrigae (Pterophoridae) nuove per la fauna italiana, Opogona omoscopa (Tineidae), Triberta cistifoliella (Gracillariidae), Ornativalva heluanensis e Neophriseria singula (Gelechiidae) segnalate per la prima volta per l’Italia continentale, oltre a 8 specie nuove per l’Italia centro- meridionale, 16 per l’Italia meridionale, e 28 segnalate per la prima volta in Calabria. La grande quantità di novità faunistiche sono l’evidenza delle scarse conoscenze disponibili sulla fauna di questi insetti per l’Italia in generale e per le regioni meridionali in particolare. Abstract: Contribution to the knowledge of the microlepidoptera of the Aspromonte Massif (Lepidoptera) In this paper we reported the results of a week of microlepidoptera samplings carried out using several collecting methods in Calabria region, precisely on the Aspromonte Massif and at the Fiumara Amendolea mouth, southern Italy. We found 159 species among which Eana nervana (Tortricidae) and Merrifeldia garrigae (Pterophoridae) are new for the Italian fauna, Opogona omoscopa (Tineidae), Triberta cistifoliella (Gracillariidae), Ornativalva heluanensis and Neophriseria singula (Gelechiidae) are new for the fauna of continental Italy. Furthermore, 8 species are new for peninsular Italy, 16 for southern Italy, and 28 for the Calabria region. So many faunistic novelties are due to the scarce knowledge on microlepidoptera for Italy in general and for southern Italy in particular. -

Agdistis Heydenii (Zeller, 1852) (Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae) En Orense (Galicia, NO España)
Burbug, 45 ISSN: 2444-0329 Agdistis heydenii (Zeller, 1852) (Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae) en Orense (Galicia, NO España) Juan José Pino Pérez∗ & Rubén Pino Pérezy February 28, 2018 Resumen En esta nota se ofrecen diversos datos sobre el pterofórido Agdistis heydenii (Zeller, 1852), en Orense (Galicia, NO España). Abstract In this article we present several chorological and ecological data on Pterophoridae moth Agdistis heydenii (Zeller, 1852) from Orense (Galicia, NW Spain). Palabras clave: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, Agdistis heydenii, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España. Key words: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, Agdistis heydenii, choro- logy, sintaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain. 1 Introducción Agdistis heydenii (Zeller, 1852), es un agdistino de distribución mediterránea (Gielis, 1996: 32 [9]), que se encuentra desde Palestina, Grecia, Marruecos, sur de Francia y España hasta las Islas Canarias (Ridder, 1986: 82 [7]). En España parece una especie bastante común (por ejemplo, Arenberger, 1977: 74 [4]; también en Vives-Moreno, 2014: 189-190 [14]), pues en el artículo ∗A Fraga, 6, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. [email protected] yDepartamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. [email protected] 1 Pino & Pino: Agdistis heydenii en Orense ISSN: 2444-0329 de Gielis (1988: 280 [8]), ya se señalaban entonces 15 puntos en el mapa de la España peninsular; aunque se ha citado posteriormente de alguna otra parte, bien mediterránea, (Arenberger, 2008: 479 [3]), no la habíamos observado en Galicia, hasta ahora. En GBIF1 hay 47 registros de A. heydenii (desde enero pasado como, A. -

Lepidópteros De Los Espacios Naturales Protegidos Del Litoral De Huelva (Macro Y Microlepidoptera) Manuel Huertas Dionisio
Lepidópteros de los Espacios Naturales Protegidos del Litoral de Huelva (Macro y Microlepidoptera) Manuel Huertas Dionisio Córdoba, Marzo de 2007 ISSN 1699-2679 Monográfico nº 2 Sociedad Andaluza de Entomología Publicación periódica de la Sociedad Andaluza de Entomología Apartado de correos 3.086. 14080 CÓRDOBA. Telf. 957293086 / 676343151 [email protected] DL. CO-442-01 - RACDP Nº 242 - RNA Nº 145.295 - RAA Nº 24 – RMA Nº 1235/2005 MONOGRÁFICO Nº 2 marzo 2007 ISSN 1699-2679 La Sociedad Andaluza de Entomología -SAE- nace en 2001 por transformación de la Sociedad Entomológica Cordobesa - SOCECO- fundada en 1995 de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la conservación y estudio de los insectos y difusión de la ciencia de la Entomología a través de sus publicaciones. PRESIDENTE José Machado Aragonés SECRETARIO Francisco Manuel Cobos García EDITOR SAE COMITÉ DE REDACCIÓN José Machado Aragonés ● Francisco Manuel Cobos García Joaquín Fernández de Córdova Villegas ● Alfonso Roldán Losada Juan Manuel Fernández Maestre ● Fernando J. Fuentes García Juan Francisco López Caro ● Antonio Luna Murillo Antonio Verdugo Páez ● Manuel Huertas Dionisio MAQUETACIÓN Y DISEÑO Antonio Luna Murillo PORTADA Malacosoma laurae Lajonquière, 1977 Fotografía: Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ COLABORAN Esta publicación es recogida en las siguientes bases de datos: INIST, Zoological Record, DIALNET. Los autores se responsabilizan de las opiniones e información contenida en los artículos y comunicaciones. Se autoriza la reproducción total o parcial de este Boletín por cualquier persona o entidad con el único fin de la difusión cultural o científica, sin fines lucrativos y citando la fuente.