Protestantismus Und Ostkirchliche Orthodoxie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

United in Jesus Christ – Together for This World the 2021 Assembly of the WCC in Karlsruhe Is an Ecumenical Chance
United in Jesus Christ – together for this world The 2021 assembly of the WCC in Karlsruhe is an ecumenical chance. Statement by the General Assembly of the Council of Churches in Germany (ACK) Encouraging ecumenism In 2021, the assembly of the World Council of Churches (WCC) will be held for the first time in Germany. The WCC has accepted the invitation of the Evangelical Church in Germany in cooperation with the Council of Churches in Germany (ACK). Together with all our ecumenical partners, we as the ACK want to work to make the assembly a strong and encouraging witness to the good news of the gospel of Jesus Christ in our world. Together with the Third Ecumenical Kirchentag in Frankfurt am Main, which will also take place in 2021, we hope that the assembly will give ecumenism in Europe and Germany a noticeable stimulus and make concrete steps towards the visible unity of our churches. Meeting challenges The preparations for the assembly come at a time of manifold challenges: climate change, military conflicts, violations of human rights, poverty and nationalism. The assembly in Karlsruhe will make an important contribution to justice and reconciliation, to unity and peace in our world. The experiences of the host country play an important role here: after the Second World War, the churches in Germany learned from the worldwide ecumenical movement and took steps towards each other. In 1948, the ACK was founded, and the Roman Catholic and the Orthodox Church joined in 1974. Now 17 churches of various confessions belong to the ACK as full members and 8 churches as guest members. -

Lo Slavismo Culturale Ed I Romeni Nel Medioevo
www.ssoar.info The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement Brie, Ioan; Brie, Mircea Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Brie, I., & Brie, M. (2008). The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement. Eurolimes, 5, 95-107. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-330349 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement Ioan BRIE, Mircea BRIE Abstract: The new Europe will bring together a plurality of religions, traditions and cultures. The process of European integration has not only political implications, but also economic, political, social and religious implications. In this context, the building of a New Europe requires a coherent interreligious dialogue. The perspectives of the world and European ecumenical movement concern the realization of the unity among churches, in the spirit of the prayer „that Jesus addressed to His Heavenly Father for his disciples and for those who trusted in him to be one” (The Bible, John, 17, 22) There is a visible tendency towards the realization of a unity in diversity, at the same time seeing the obstacles that exist in front of this vision. A big step forward in Europe was made by the cooperation between CEC and CCEE to organize the European Ecumenical Assemblies and to elaborate the document entitled Charta Oecumenica. -

Contemporary Ecumenism Between the Theologians
www.ssoar.info Contemporary ecumenism between theologians’ discourse and the reality of inter-confessional dialogue - case study: Bihor Brie, Mircea Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Brie, M. (2009). Contemporary ecumenism between theologians’ discourse and the reality of inter-confessional dialogue - case study: Bihor. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 8(24), 257-283. https://nbn- resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-329006 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-SA Lizenz (Namensnennung- This document is made available under a CC BY-SA Licence Weitergabe unter gleichen Bedingungen) zur Verfügung gestellt. (Attribution-ShareAlike). For more Information see: Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de MIRCEA BRIE Mircea Brie CONTEMPORARY ECUMENISM BETWEEN Lecturer Ph.D. at the THE THEOLOGIANS’ DISCOURSE AND THE Department for International Relations and European REALITY OF INTER-CONFESSIONAL Studies, University of Oradea, IALOGUE ASE TUDY IHOR Romania. Author of the D . C S : B books: O istorie socială a spaţiului românesc. De la Religious freedom in Romania after 1989 has începuturile statalităţii dacice contributed decisively to changes in the religious până la întrezărirea structure in the country. From a religious point of view, modernităţii (2005), Perspectivă the fall of the communist regime meant the end of istorico-geografică asupra unui abuse or interdictions for many people and circuit turistic (2006), Relaţiile communities. Discussing about ecumenism and inter- internaţionale de la echilibru la religious or inter-confessional dialogue in Bihor is, sfârşitul concertului european according to the current demographic realities, a need (secolul XVII – începutul entailed by the ethno-confessional diversity and secolului XX), (în colaborare multiculturalism specific to the area. -
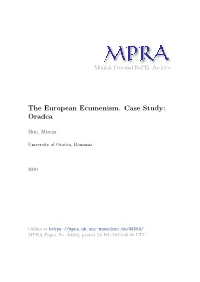
The Interreligious Dialogue in The
Munich Personal RePEc Archive The European Ecumenism. Case Study: Oradea Brie, Mircea University of Oradea, Romania 2010 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/44564/ MPRA Paper No. 44564, posted 24 Feb 2013 06:48 UTC The European Ecumenism. Case Study: Oradea1 Mircea BRIE Abstract. The new Europe will bring together a plurality of religions, traditions and cultures. The process of European integration has not only political implications, but also economic, political, social and religious implications. In this context, the building of a New Europe requires a coherent interreligious dialogue. The perspectives of the world and European ecumenical movement concern the realization of the unity among churches. There is a visible tendency towards the realization of a unity in diversity, at the same time seeing the obstacles that exist in front of this vision. A big step forward in Europe was made by the cooperation between CEC and CCEE to organize the European Ecumenical Assemblies and to elaborate the document entitled Charta Oecumenica. The ecumenical dialogue is practically based on the phenomenon of the concentric circles. What is important is in fact how much the parts have in common or how far a Christian denomination has gone from the doctrinal, administrative and juridical point of view. The dialogue is the ideal means in putting face to face the different points of view, in examining the divergences that separate Christians. In the ecumenical dialogue, the seriousness of the engagement and the depth of the problems that require a solution are obvious. Keywords: ecumenical movement, dialogue, denomination, conflicts, peace The political events that took place in 1989, marked especially by the fall of communism globalization, emerged The European Union, which will incorporate all the other European states in the future. -

CHARTA OECUMENICA Guidelines for the Growing Cooperation Among the Churches in Europe
1 CHARTA OECUMENICA Guidelines for the Growing Cooperation among the Churches in Europe An Ecumenical Charter for the Churches in Europe The CHARTA OECUMENICA was published in April 2001 in its final form by the Conference of European Churches (CEC) and the Roman Catholic Council of European Bishops’ Conferences (CCEE). It marked the beginning of the century by calling the churches in Europe to dialogue, unity and action, and particularly to their common responsibility in facing issues of peace and justice in Europe. CEC’s membership includes around 120 Anglican, Orthodox and Protestant churches and bodies. Together with CCEE the two organisations represent the vast majority of mainstream churches in Europe. Although the word ‘Charta’ has many resonances, most recently in the context of human rights, this is a unique document for the churches in Europe. It is a call to prayer, commitment and action. Many European churches are now beginning to adopt the Charta as a framework for ecumenical encounter and common mission. Its value depends on how the churches see the Charta as a process with practical outcomes. The Charta urges churches to respond to specific challenges which face the peoples of Europe: to work for understanding, healing and reconciliation, for justice and the protection of minorities and the vulnerable, to safeguard creation, and to promote dialogue and co- operation with other faiths and world views. Origins After the European Ecumenical Assembly in Graz, Austria, in 1997, with its theme of reconciliation in Europe, CEC and CCEE called on member churches and bishops’ conferences to begin work on an ecumenical charter. -

Book Reviews / Exchange 36 (2007) 215-230 Tim and Ivana Noble
Book Reviews / Exchange 36 (2007) 215-230 217 Tim and Ivana Noble, Martien E. Brinkman and Jochen Hilberath (eds.), Charting Churches in a Changing Europe. Charta Oecumenica and the Process of Ecumenical Encounter, Currents of Encounter 28, Amsterdam/New York: Rodopi 2006, 222 p., ISBN 90-420-2009-1, price € 46.00. Today in Europe the Churches fail to make a strong impression, particularly when measured by their own claims. Economically, Europe is a gigantic success. Yet churches wrestle with their own self-understanding. When these churches produce common directives in order to pro- mote cooperation in Europe, it is very exciting to examine what exactly this Charta Oecu- menica contains and what aspects of this vision will influence the quality of European unity. ‘Charting the Churches’ is a fruit of the 13th consultation of the Societas Oecumenica in 2004 in Sibiu in Romania, with as theme: ‘On the Way to Koinonia: Church Communion in Transition’. In this volume a worthwhile effort is made to digest theCharta Oecumenica, in which the Conference of European Churches and the Council of European Bishops’ Confer- ences made declarations on these issues. I was not encouraged by their statements. Th e dis- tance between the ecclesiastical dialogues and the concerns of people in Europe is enormous. Nevertheless, I also read some beautiful things. Th e editors of ‘Charting the Churches’ chose, first to have four different theologians react, each from their own specific tradition. eTh great disadvantage of this approach is that the reader has to wrestle with ecclesiastical peculiarities, before more inclusive interpretations come to light. -

The Contemporary Status of the Lutheran Evangelical Church in Hungary with a View to Churches of Central European Countries
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe Volume 28 Issue 1 Article 3 2-2008 The Contemporary Status of the Lutheran Evangelical Church in Hungary with a View to Churches of Central European Countries Béla Harmati Follow this and additional works at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree Part of the Christianity Commons, and the Eastern European Studies Commons Recommended Citation Harmati, Béla (2008) "The Contemporary Status of the Lutheran Evangelical Church in Hungary with a View to Churches of Central European Countries," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 28 : Iss. 1 , Article 3. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol28/iss1/3 This Article, Exploration, or Report is brought to you for free and open access by Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Occasional Papers on Religion in Eastern Europe by an authorized editor of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. THE CONTEMPORARY STATUS OF THE LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN HUNGARY WITH A VIEW TO CHURCHES OF CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES Béla Harmati Dr. Béla Harmati (Lutheran) is bishop emeritus and pastor of the Evangelical Church of Hungary. For many years he was the director of the Department of Studies of the Lutheran World Federation in Geneva, Switzerland. REE published his work in previous issues. The most important task of the churches in Europe is to collectively preach the Gospel in both word and deed for the salvation of all humankind. We need to work together in the Gospel spirit to bolster the story of Christian churches, a story that is characterized by many good experiences but also by division, and enmity that sometimes extends as far as hostile controversy. -

The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: the European Ecumenical Movement
MPRA Munich Personal RePEc Archive The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement Ioan Brie and Mircea Brie University of Oradea, Romania 2008 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/44118/ MPRA Paper No. 44118, posted 2 February 2013 02:38 UTC The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement Ioan BRIE, Mircea BRIE Abstract: The new Europe will bring together a plurality of religions, traditions and cultures. The process of European integration has not only political implications, but also economic, political, social and religious implications. In this context, the building of a New Europe requires a coherent interreligious dialogue. The perspectives of the world and European ecumenical movement concern the realization of the unity among churches, in the spirit of the prayer „that Jesus addressed to His Heavenly Father for his disciples and for those who trusted in him to be one” (The Bible, John, 17, 22) There is a visible tendency towards the realization of a unity in diversity, at the same time seeing the obstacles that exist in front of this vision. A big step forward in Europe was made by the cooperation between CEC and CCEE to organize the European Ecumenical Assemblies and to elaborate the document entitled Charta Oecumenica. The ecumenical dialogue is practically based on the phenomenon of the concentric circles. What is important is in fact how much the parts have in common or how far a Christian denomination has gone from the doctrinal, administrative and juridical point of view. -

20Th Anniversary of Charta Oecumenica
20th anniversary of Charta Oecumenica Joint Statement by the Presidents of the Council of European Bishops’ Conferences and of the Conferences of European Churches 12 April 2021 For the past twenty years the European continent has experienced a relatively peaceful period, along with an improvement of ecumenical relations. This was demonstrated in areas of daily life such as joint witness and action in local ecumenism, as well as inter-church marriages. Several theological agreements have been reached and a new generation of theologians has been ecumenically trained and formed. Several interfaith initiatives have flourished. Churches have strengthened their work towards a just and peaceful world, not least because of the increased movement of people from other continents, and have increased their efforts towards the care for creation. The message of the Charta Oecumenica has contributed and given new vigour to all of this growth and transformation. For the peace we have experienced and the achievements of the global ecumenical movement, we rejoice and give thanks to God our Creator! As we strive towards the Reign of God, our societies and churches continue to be challenged by our human sin and all kinds of division. Old and new church divisions are in need of healing, societal and economic inequalities call for the transformation of our attitudes and structures. The continued threats to democracy and the natural environment demand a renewed attention to the wholeness of life. The resurgence of armed conflicts and terrorist attacks in some parts of the continent in recent years require repentance, forgiveness and justice. In the face of these realities, as churches redefine their ministry in the midst of the Covid-19 pandemic, we reaffirm together and in a spirit of unity our commitment to witness to Christ as our Saviour and to his promise of a transformed life in the power of the Holy Spirit. -

Council of Christian Churches in Germany (Ack)
COUNCIL OF CHRISTIAN CHURCHES IN GERMANY (ACK) Frankfurt am Main 2007 Impressum Ökumenische Centrale Ludolfusstrasse 2-4, 60487 Frankfurt am Main Tel. 0049 (0)69-247027-0, Fax 0049 (0)69-247027-30 e-mail: [email protected] Internet: www.oekumene-ack.de 1 January 2007 2 History and Conception of the Council of Christian Churches in Germany (ACK) After the end of the World War II, with the beginning of the reconstruction of the German churches, the World Council of Churches (WCC) was in the position to make a considerable contribution to that new beginning, thanks to many Christian brothers and sisters from England and America, amongst them many Methodists, Baptists and other denominations. The experience of churches during the World War II, that they had not been able to engage in their common witness and joint actions, had shocked them deeply. It was time then to think about how the Christian family right on its own doorstep could come together again, and could speak and act jointly. The com- ing together of the different churches was supposed to enable all of German Christianity to be represented and to speak with one voice in Amsterdam, where in 1948 the World Council of Churches was founded. The goal of the ecumenical movement was to unite the churches “for common witness and service”. Besides the worldwide World Council of Churches, National Councils of Churches and Christian Councils were constituted in many countries. The Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland – ACK (Council of Christian Churches in Germany) was founded in Kassel on March 10, 1948, even before the WCC’s first Assembly in 1948. -

The Politics of Orthodox Churches in the European Union Lucian N. Leustean Aston University, Birmingham, UK Abstract This Articl
The Politics of Orthodox Churches in the European Union Lucian N. Leustean Aston University, Birmingham, UK Abstract This article focuses on the political mobilisation of Orthodox churches in the making of the European Union from the 1950 Schuman Declaration until today. It examines the first contacts between Orthodox churches and European institutions, the structure of religious dialogue, policy areas of Orthodox engagement in the European Union, and competing visions of Europe in the Orthodox commonwealth. It argues that the response of Orthodox churches to the institutionalisation of religious dialogue in the European Union (Article 17 of the Lisbon Treaty) is comparable to that of other religious communities. However, the political mobilisation of Orthodox representations in Brussels advances a geopolitical and civilisational dimension which places the Eastern Orthodox world as a competitor to the secular West. Keywords Orthodox engagement in the EU; Eastern Orthodoxy and secular West; ‘Soul for Europe’; World Council of Churches (WCC); Conference of European Churches (CEC); Charta Oecumenica; Symphonia; Committee of Representatives of Orthodox Churches to the European Union (CROCEU); Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) Introduction Opening religious offices in Brussels has been akin to an industrial enterprise. In post- Maastricht Europe, Christian churches, Muslim and Jewish communities, and Humanist bodies have set up offices in Brussels and Strasbourg representing a wide range of religious and convictional values. The number of faith-based representations have gradually increased after Jacques Delors, President of the European Commission, encouraged a more active reflection in political circles of the role of religious communities and philosophical organisations in the making of the European Union (EU). -

The Holy See
The Holy See VISIT OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO LESVOS (GREECE)JOINT DECLARATION OF HIS HOLINESS BARTHOLOMEW, ECUMENICAL PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE, OF HIS BEATITUDE IERONYMOS, ARCHBISHOP OF ATHENS AND ALL GREECE AND OF HIS HOLINESS POPE FRANCISMòria Refugee Camp, Lesvos Saturday, 16 April 2016[Multimedia] We, Pope Francis, Ecumenical Patriarch Bartholomew and Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece, have met on the Greek island of Lesvos to demonstrate our profound concern for the tragic situation of the numerous refugees, migrants and asylum seekers who have come to Europe fleeing from situations of conflict and, in many cases, daily threats to their survival. World opinion cannot ignore the colossal humanitarian crisis created by the spread of violence and armed conflict, the persecution and displacement of religious and ethnic minorities, and the uprooting of families from their homes, in violation of their human dignity and their fundamental human rights and freedoms. The tragedy of forced migration and displacement affects millions, and is fundamentally a crisis of humanity, calling for a response of solidarity, compassion, generosity and an immediate practical commitment of resources. From Lesvos, we appeal to the international community to respond with courage in facing this massive humanitarian crisis and its underlying causes, through diplomatic, political and charitable initiatives, and through cooperative efforts, both in the Middle East and in Europe. As leaders of our respective Churches, we are one in our desire for peace and in our readiness to promote the resolution of conflicts through dialogue and reconciliation. While acknowledging the efforts already being made to provide help and care to refugees, migrants and asylum seekers, we call upon all political leaders to employ every means to ensure that individuals and communities, including Christians, remain in their homelands and enjoy the fundamental right to live in peace and security.