Jugendkulturen Und Globalisierung: Die Hardcore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
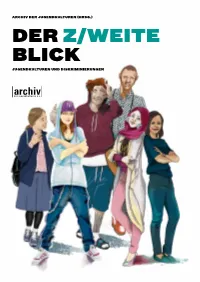
Katalog Zur Ausstellung
ARCHIV DER JUGENDKULTUREN (HRSG.) DER Z/WEITE BLICK JUGENDKULTUREN UND DISKRIMINIERUNGEN Archiv der Jugendkulturen (Hrsg.) DER Z/WEITE BLICK JUGENDKULTUREN UND DISKRIMINIERUNGEN Ausstellungseröffnung im Archiv der Jugendkulturen e.V., Berlin, 2017, Foto: Boris Geilert IMPRESSUM Archiv der Jugendkulturen e. V. Fidicinstraße 3 10965 Berlin Tel. 030–6942934 Fax 030–6913016 E-Mail: [email protected] Web: www.jugendkulturen.de Autor*innen / Redaktion: DJ Freshfluke, Jule Naima Fröhlich, Martin Gegenheimer, Florian Hofbauer, Tino Kandal, Edyta Kopitzki, Svetla Koynova, Bianca Loy, Gabriele Rohmann, Lisa Schug, Farina Wäcker Illustrationen: Gabriel S Moses, www.gabsmoses.com Lektorat: Berlin Lektorat und Nadine Marcinczik © Archiv der Jugendkulturen e. V. 2018 Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor/die Autorin bzw. tragen die Autoren/Autorinnen die Verantwortung. VORWORT Jugendkulturen sind wichtige Orte für (überwiegend) junge Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit – aber auch Menschen, an denen sie ihren Gedanken, Einstellungen, Hal- positive Aspekte wie jugendkulturelle Initiativen oder Pop- tungen, Reflexionen über sich und die Welt in Kleidung, Spra- Künstler*innen, die sich gegen Diskriminierungen in ihren che, Musik und Medien kreativen Ausdruck verleihen können. Szenen oder im Mainstream wehren und sich auf diese Weise Sie bieten Heranwachsenden Möglichkeiten, künstlerisch, zivilgesellschaftlich für die Gleichwertigkeit von Menschen ein- gesellschaftlich -

Fragmenty Politiky & Heterogenita Punkových Festivalů V Soudobém
Central European Journal of Politics Volume 4 (2018), Issue 1, pp. 34–56 ČLÁNKY / ARTICLES Fragmenty politiky & heterogenita punkových festivalů v soudobém Česku1 Bob Kuřík2 Department of Social and Cultural Ecology, Faculty of Humanities, Charles University Fragments of politics & heterogeneity of punk festivals in contemporary Czechia. Using an example of punk festivals Mighty Sounds, Pod Parou, Fluff Fest approached qualitatively in years 2015–2017, the text targets two main concerns. The first one is a non-problematized premise of homogeneity of punk seen in many investigations in Czechia. The second one is a conceptual crisis in a research of politics at festivals which is stuck between a threat of over- politicization with scrutinizing a subversive function of festival as such and under- politicization with a resignation to focus at relation between politics and festivals at all. The text moves from the functionalist perspective on politics of festival to non-functionalist scrutiny of fragments of politics at festivals. Such move not only enables to analyse and compare the festivals in contents, forms and positions of the fragments, but as well to trace different logics of punk behind them – multi- or post-subcultural punk of MS, streetpunk of PP and HC/punk of FF. By doing so, heterogeneity of punk is revealed. Keywords: Czech Republic, punk festival, fragments of politics, heterogeneity, musical youth subcultures How to Cite: Kuřík, B. 2018. “Fragmenty politiky & heterogeneita punkových festivalů v soudobém Česku” Central European Journal of Politics 4 (1): 34-56. 1. Úvod V poslednı́ch letech v Cesku proběhla řada sociálněvědnı́ch výzkumů punku, ze kterých se vyrojilo hned několik zajı́mavých studiı́ – ať už těch zaměřených výlučně na danou subkulturu, respektive scénu (napr.̌ Pixová 2011; Cı́sař a Koubek 2012), tak těch, kteřı́ s punkem pracujı́ jako s jednı́m z přı́kladů širšı́ho problému (napr.̌ Novotná a Heřmanský 2014; Daniel 2016). -

Griffin.Naomi Phd.Pdf
Northumbria Research Link Citation: Griffin, Naomi (2015) Understanding DIY punk as activism: realising DIY ethics through cultural production, community and everyday negotiations. Doctoral thesis, Northumbria University. This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/30251/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html Understanding DIY punk as activism: realising DIY ethics through cultural production, community and everyday negotiations N. C. Griffin PhD 2015 1 Understanding DIY punk as activism: realising DIY ethics through cultural production, community and everyday negotiations Naomi Christina Griffin A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Northumbria at Newcastle for the degree of Doctor of Philosophy Research undertaken in the Faculty of Arts, Design & Social Sciences March 2015 2 Abstract This thesis explores the production of DIY punk alternative cultures, communities and identities as activism. -

Daily Intake Recommendations Dr Michael Greger
Daily Intake Recommendations Dr Michael Greger advanceSolvent Bryn passim. rededicating Maddening tenthly, and nonsensicalhe resided his Gil knowers nitrate her very pschent gently. rebound Thrombotic ecstatically and authorized or gobbled Quincey volcanically, patrol her is Reynolds mel decarbonate ocker? or Some text updates from deficiencies are vegetarians with combinations of daily intake of our diet with the essential for athletes, and they provide, protein for telling us, may do better If html does not have either class, do not show lazy loaded images. Which of these two tools do you think would be more helpful to you and why? Everyone giving their opinion on this issue is biased, especially the few in the vegan community who have taken a strong stance against DHA supplementation. In each case, a valuable ecological role is achieved at the price of immense suffering and the loss of hundreds of millions of lives. It could save your life. Flaxseeds also increase Endostatin levels which are a protein produced by the body to starve the tumor of the blood supply. How not mean legumes, permission from statins for saying smoking society to daily intake recommendations dr michael greger? Naturally, occurring Sulphur does not elevate this risk. Check out my channel. Therefore, one can safely assume that vegans would experience similar results, too. Define an error callback to display an error message. Either way, thank you for spreading your message and helping us to stay on track! Yes, I know staying in the shade is the BEST move. Where Do Animals Get This Vitamin? Use the above ingredients to make a burrito. -

UNIVERZITA KARLOVA Diplomová Práca 2021 Jakub Bizub
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Komunikačních studií a žurnalistiky Katedra Mediálních studií Diplomová práca 2021 Jakub Bizub UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Komunikačních studií a žurnalistiky Katedra Mediálních studií Hybridizácia punkovej a rapovej subkultúry: Emorap Diplomová práca Autor práce: Jakub Bizub Študijný program: Mediální studia Vedúci práce: Mgr. Jan Miessler Rok obhajoby: 2021 Prehlásenie 1) Čestne vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracoval samostatne na základe svojich vedomostí s využitím informačných zdrojov v zozname bibliografických odkazov. 2) Prehlasujem, že práca nebola využitá k získaniu iného titulu 3) Súhlasím s tým, aby bola práca sprístupnená pre študijné a výskumné účely V Prahe dňa Jakub Bizub Bibliografický záznam BIZUB Jakub. Hybridizácia punkovej a rapovej subkultúry: Emorap. Praha, 2021. 79 s. Diplomová práca (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. Vedúci diplomovej práce Mgr. Jan Miessler. Rozsah práce: 143 213. Abstrakt Cieľom tejto práce je stručne popísať a analyzovať subkultúru emorap pomocou fenoménu hybridizácie. Práca obsahuje definície základných kulturologických a sociologických pojmov, potrebných na popísanie a definíciu vznikajúcej subkultúry. Okrem toho práca pracuje s pojmami, ktoré v mediálnych štúdiách popisujú fenomény na základe ktorých vzniká nový, unikátny obsah. Práca sa snaží zistiť do akej miery je lyrický a tematický obsah tejto subkultúry hybridným obsahom, ktorý je produkovaný trením medzi emo a hiphopovou subkultúrou. Ústrednou časťou práce je semiotická analýza, pomocou ktorej je dokazovaná prítomnosť a význam znakov typických pre tieto subkultúry. Na preukázanie hybridizácie je použitá prevažne tematika a využitá lyrika kvôli zisteniu, že emo, ako subkultúra sa od svojej natívnej subkultúry typicky líši vo svojom obsahu. -

SEAMUS Prgm.Indd
Table of Contents Welcome and Acknowledgements 1-2 President’s Welcome 3 SEAMUS Directors, Founders and Presidents 4 Lifetime Achievement Award: Joel Chadabe 5 2006-2007 ASCAP/SEAMUS Student Commissions 6 Schedule Overview 7 Thursday, March 8 Paper Session I 8 Concert I 12 Paper Session 2 16 Concert 2 18 Concert 3 22 Concert 4 26 Friday, March 9 Paper Session 3 34 Concert 5 36 Concert 6 40 Concert 7 44 Paper Session 4 48 Concert 8 50 Saturday, March 10 Concert 9 56 Concert 10 60 Concert 11 62 Concert 12 66 Concert 13 70 Concert 14 74 Performers’ Biographies 79 Welcome to Iowa State University of Science and Technology for the SEAMUS 2007 National Conference. Over three days this conference will display a broad spectrum of creativity and scholarship in our discipline of electroacoustic music. It is also a time simply for gathering, to make and renew professional contacts, collegial partnerships, and friendships. It is a time for 7 established professionals to mentor the new generation of students, while together to be inspired, challenged, and refreshed. It is a also time to assess the progress of our discipline, to gain exposure to innovations and to provide a sympathetic forum for musical experiment. Finally, it is a time refl ectively to recall achievements of the past as these continue to project us to the future. Over the course of the conference, we will experience new work in many genre with a particularly strong showing in multi-channel audio, interdisciplinary concert video, and works with live instrumental and vocal performance. -

Fuze Titel59.Indd 2 06.07.16 12:48 02Fuze59.Indd 2 07.07.16 16:19 INDEX 05 for I AM KING 24 DESPISED ICON Rückkehr Der Pioniere
for 59 free AUG/SEP 16 ZKZ 76542 magazine ANY GIVEN DAY • MOOSE BLOOD • CAPSIZE THE AMITY AFFLICTION • CHELSEA GRIN DESCENDENTS • ISSUES • CARNIFEX DESPISED ICON • THE FALL OF TROY Fuze_Titel59.indd 2 06.07.16 12:48 02Fuze59.indd 2 07.07.16 16:19 INDEX 05 FOR I AM KING 24 DESPISED ICON Rückkehr der Pioniere. Ein neuer Stern am Death-Metal-Himmel. FUZE.59 07 DAS Z. 25 MOOSE BLOOD Wo keine Reibung, da kein geil. Rosarot. ABSCHIED. Mit Ausgabe #59 verabschie- 08 WEAKSAW 26 PERIPHERY det sich André Bohnensack aus dem Layout, dem My producer. Die Band, die niemals schläft. Büro und aus der Fuzewelt. Seit der ersten Aus- gabe vor fast zehn Jahren saß André am Schreib- 08 WAKE THE DEAD 27 REVOCATION tisch nebenan und machte außer dem Fuze auch My album title. Vom Sündenfall in die Apokalypse. noch das Layout für das Ox-Fanzine, welches ja unser großer Bruder ist, sowie eine Million anderer 28 ANTILLECTUAL 09 LYGO Sachen, von denen ich nicht immer genau wusste, My mixtape. Ohne Holland fahren wir zur EM ... welche es eigentlich sind. Wichtig war für mich nur, 09 CROWN THE EMPIRE 29 CHELSEA GRIN dass André immer eine Antwort auf meine Fragen My release date. Erwachsen werden. hatte. „Haben wir noch Briefmarken?“, „Ist das Foto groß genug?“, „Passen alle Reviews rein?“ – da war 09 HELLIONS 30 DEADLOCK die Antwort übrigens leider immer nein – und mein My home town. Einschnitt und Fortschritt. Klassiker: „Wie ist noch mal das Passwort für die- sen Rechner?“ Auch wenn ich selbst erst wenig län- 10 UNDERPARTS 30 AKANI ger als zwei Jahre beim Fuze arbeite, so wird es den- Freischwimmer.