Jahresbericht 2000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
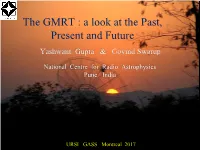
Probing the Universe at Low Radio Frequencies Using the GMRT
The GMRT : a look at the Past, Present and Future Yashwant Gupta & Govind Swarup National Centre for Radio Astrophysics Pune India URSI GASS Montreal 2017 The GMRT : a look at the Past, Present and Future Yashwant Gupta & Govind Swarup National Centre for Radio Astrophysics Pune India URSI GASS Montreal 2017 Overview of today’s talk . Part I : the GMRT -- a historical perspective . Part II : the GMRT -- current status . Part III : future -- the upgraded GMRT Some history . It is the early 1980s… the VLA has recently become operational . Radio astronomy has shifted from the low frequencies, where it was born, to higher frequencies (cm and higher wavelengths) -- obvious reasons . Note, however, techniques like self-cal have been shown to work . In India, the radio astronomy group at the Tata Institute, under the leadership of Govind Swarup, is looking for the next big challenge… They have already : . Built the Ooty Radio Telescope in the late 1960s – still operational & producing international quality results (in fact, currently being upgraded with new receiver system!) . Built the Ooty Synthesis Radio Telescope (1980s) – short-lived but valuable learnings . Built up considerable experience in low frequencies (metre wavelengths) Birth of the GMRT . Motivation : bridge the gap in radio astronomy facilities at low frequencies and address science problems best studied at metre wavelengths . First concept : 1984 (started with large cylinders); evolved to 34 dishes of 45 metres by 1986 . Project cleared and funding secured by 1987 . Construction started : 1990; first antenna erected : 1992 . First light observations : 1997 – 1998 . Released for world-wide use : 2002 The GMRT : turning it ON Jan 1997 : First fringes with the prototype GMRT correlator Dec 1998 : first light pulsar observation with the GMRT Dedication of the GMRT The Giant Metrewave Radio Telescope was dedicated to the World Scientific Community by the Chairman of TIFR Council, Shri Ratan Tata. -

The Ooty Wide Field Array (OWFA) Is an Upgrade to the ORT, Which Digitizes the Signals from Every 4 Dipoles Along the Feed Line
J. Astrophys. Astr. (0000) 00, 000–000 The Ooty Wide Field Array C. R. Subrahmanya1∗, P. K. Manoharan2†, Jayaram. N. Chengalur3‡ 1 Raman Research Institute, C. V. Raman Avenue, Sadashivnagar,Bengaluru 560080,India. 2 Radio Astronomy Centre, NCRA-TIFR, P. O. Box 8, Ooty 643001, India. 3 NCRA-TIFR, Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune 411007,India. Abstract. We describe here an ongoing upgrade to the legacy Ooty Ra- dio Telescope (ORT). The ORT is a cylindrical parabolic cylinder 530mx30m in size operating at a frequency of 326.5 (or z ∼ 3.35 for the HI 21cm line). The telescope has been constructed on a north-south hill slope whose gradient is equal to the latitude of the hill, making it effectively equitorially mounted. The feed con- sists of an array of 1056 dipoles. The key feature of this upgrade is the digitisation and cross-correlation of the signals of every set of 4-dipoles. This converts the ORT into a 264 element interfer- ometer with a field of view of 2◦ × 27.4◦ cos(δ). This upgraded instrument is called the Ooty Wide Field Array (OWFA). This paper briefly describes the salient features of the upgrade, as well as its main science drivers. There are three main science drivers viz. (1) Observations of the large scale distribution of HI in the post-reionisation era (2) studies of the propagation of plasma ir- regularities through the inner heliosphere and (3) blind surveys for transient sources. More details on the upgrade, as well as on the expected science uses can be found in other papers in this special issue. -

Concept Note Indo-South African Flagship Programme in Astronomy
Concept Note Indo-South African Flagship Programme in Astronomy Preamble: The Indo-South Africa Flagship Workshop meetings took place at the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore on 15th-16th September 2014, and at the Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune on 19th September, 2014 and were sanctioned by the Departments of Science and Technology of both countries. A list of participants is included in the appendix. 1. Introduction India and South Africa share common aspirations for scientific and technological development, and for the growth of human capital resources. The countries are members of the BRICS consortium, and have a current bi-lateral agreement to foster joint progress. Their shared goals are particularly apparent in the area of astronomy and astrophysics. Indo-African astronomy cooperation began with projects in radio astronomy in Nigeria and Mauritius in the 1980s, and the optical Nainital-Cape Survey, started in 1997. The Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) joined SALT in 2007, and the National Centre for Radio Astrophysics of the Tata Institute of Fundamental Research (NCRA) has recently joined the SKA. Astronomy captures the imagination of people everywhere, and touches a fundamental human desire to understand the universe that surrounds us and our place in it. It provides an ideal way to attract young learners into scientific and technical studies, developing the human capacity for the knowledge-based economy of the future. Its appeal transcends boundaries of class and race and speaks to all members of our societies. The goal of the Indo-South African Flagship Programme in Astronomy is to exploit these basic strengths for the mutual betterment of our peoples. -

Pulsar Timing Array Experiments 3
Pulsar Timing Array Experiments J. P. W. Verbiest∗, S. Osłowski and S. Burke-Spolaor Abstract Pulsar timing is a technique that uses the highly stable spin periods of neutron stars to investigate a wide range of topics in physics and astrophysics. Pul- sar timing arrays (PTAs) use sets of extremely well-timed pulsars as a Galaxy-scale detector with arms extendingbetween Earth and each pulsar in the array.These chal- lenging experiments look for correlated deviations in the pulsars’ timing that are caused by low-frequency gravitational waves (GWs) traversing our Galaxy. PTAs are particularly sensitive to GWs at nanohertz frequencies, which makes them com- plementary to other space- and ground-based detectors. In this chapter, we will de- scribe the methodology behind pulsar timing; provide an overview of the potential uses of PTAs; and summarise where current PTA-based detection efforts stand. Most predictions expect PTAs to successfully detect a cosmological background of GWs emitted by supermassive black-hole binaries and also potentially detect continuous- wave emission from binary supermassive black holes, within the next several years. J. P. W. Verbiest Fakult¨at f¨ur Physik, Universit¨at Bielefeld, Postfach 100131, 33501 Bielefeld, Germany and Max-Planck-Institut f¨ur Radioastronomie, Auf dem H¨ugel 69, 53121 Bonn, Germany, e-mail: [email protected] S. Osłowski Centre for Astrophysics and Supercomputing, Swinburne University of Technology, PO Box 218, Hawthorn, VIC 3122, Australia, e-mail: [email protected] S. Burke-Spolaor Department of Physics and Astronomy, West Virginia University, P.O. Box 6315, Morgantown, arXiv:2101.10081v1 [astro-ph.IM] 25 Jan 2021 WV 26506, USA and Center for Gravitational Waves and Cosmology, West Virginia University, Chestnut Ridge Re- search Building, Morgantown, WV 26505, USA and Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR Azrieli Global Scholar, MaRS Cen- tre West Tower, 661 University Ave. -

Great Discoveries Made by Radio Astronomers During the Last Six Decades and Key Questions Today
17_SWARUP (G-L)chiuso_074-092.QXD_Layout 1 01/08/11 10:06 Pagina 74 The Scientific Legacy of the 20th Century Pontifical Academy of Sciences, Acta 21, Vatican City 2011 www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/acta21/acta21-swarup.pdf Great Discoveries Made by Radio Astronomers During the Last Six Decades and Key Questions Today Govind Swarup 1. Introduction An important window to the Universe was opened in 1933 when Karl Jansky discovered serendipitously at the Bell Telephone Laboratories that radio waves were being emitted towards the direction of our Galaxy [1]. Jansky could not pursue investigations concerning this discovery, as the Lab- oratory was devoted to work primarily in the field of communications. This discovery was also not followed by any astronomical institute, although a few astronomers did make proposals. However, a young electronics engi- neer, Grote Reber, after reading Jansky’s papers, decided to build an inno- vative parabolic dish of 30 ft. diameter in his backyard in 1935 and made the first radio map of the Galaxy in 1940 [2]. The rapid developments of radars during World War II led to the dis- covery of radio waves from the Sun by Hey in 1942 at metre wavelengths in UK and independently by Southworth in 1942 at cm wavelengths in USA. Due to the secrecy of the radar equipment during the War, those re- sults were published by Southworth only in 1945 [3] and by Hey in 1946 [4]. Reber reported detection of radio waves from the Sun in 1944 [5]. These results were noted by several groups soon after the War and led to intensive developments in the new field of radio astronomy. -
![Arxiv:1507.08236V1 [Astro-Ph.IM] 27 Jul 2015](https://docslib.b-cdn.net/cover/4602/arxiv-1507-08236v1-astro-ph-im-27-jul-2015-1634602.webp)
Arxiv:1507.08236V1 [Astro-Ph.IM] 27 Jul 2015
ApJL, in press Preprint typeset using LATEX style emulateapj v. 5/2/11 MURCHISON WIDEFIELD ARRAY OBSERVATIONS OF ANOMALOUS VARIABILITY: A SERENDIPITOUS NIGHT-TIME DETECTION OF INTERPLANETARY SCINTILLATION D. L. Kaplan1, S. J. Tingay2,3, P. K. Manoharan4, J.-P. Macquart2,3, P. Hancock2,3, J. Morgan2, D. A. Mitchell5,3, R. D. Ekers5, R. B. Wayth2,3, C. Trott2,3, T. Murphy6,3, D. Oberoi4, I. H. Cairns6, L. Feng7, N. Kudryavtseva2, G. Bernardi8,9,10, J. D. Bowman11, F. Briggs12, R. J. Cappallo13, A. A. Deshpande14, B. M. Gaensler6,3,15, L. J. Greenhill10, N. Hurley-Walker2, B. J. Hazelton16, M. Johnston-Hollitt17, C. J. Lonsdale13, S. R. McWhirter13, M. F. Morales16, E. Morgan7, S. M. Ord2,3, T. Prabu14, N. Udaya Shankar14, K. S. Srivani14, R. Subrahmanyan14,3, R. L. Webster18,3, A. Williams2, and C. L. Williams7 ApJL, in press ABSTRACT We present observations of high-amplitude rapid (2 s) variability toward two bright, compact ex- tragalactic radio sources out of several hundred of the brightest radio sources in one of the 30◦ 30◦ MWA Epoch of Reionization fields using the Murchison Widefield Array (MWA) at 155 MHz.× After rejecting intrinsic, instrumental, and ionospheric origins we consider the most likely explanation for this variability to be interplanetary scintillation (IPS), likely the result of a large coronal mass ejection propagating from the Sun. This is confirmed by roughly contemporaneous observations with the Ooty Radio Telescope. We see evidence for structure on spatial scales ranging from <1000 km to > 106 km. The serendipitous night-time nature of these detections illustrates the new regime that the MWA has opened for IPS studies with sensitive night-time, wide-field, low-frequency observations. -

M. M. Bisi(I), B
IPIPSS oobbserservavationstions ofof tthhee innerinner--helioheliosspherpheree anandd theirtheir ccomomppaarisrisoonn wwiithth multi-multi-popointint in-in-ssituitu mmeaeassurementsurements M. M. Bisi(i), B. V. Jackson(i), A. R. Breen(ii), R. A. Fallows(ii), J. Feynman(iii), J. M. Clover(i), P. P. Hick(i), and A. Buffington(i) (i)(i) CCenenteterr foforr AsAstrotrophyphyssicicss aandnd SSpacpacee ScScieiencncees,s, UUnivniveerrsisityty ofof CCalifoaliforrnia,nia, SSanan DDieiego,go, USAUSA (ii)(ii) InsInstittituteute ofof MatheMathematicmaticaall aandnd PPhyhyssicicalal ScScieiencncees,s, AAbeberryysstwtwyythth UnUniviveersrsiityty,, WaleWaless,, GBGB ((iiii)ii) JJeett PrPropulsopulsiionon LaborLaboraatortoryy,, CCalifaliforornia,nia, USAUSA AAbbsstratracctt Interplanetary scintillation (IPS) observations of the inner-heliosphere have been carried out on a routine basis for many years using metre-wavelength radio telescope arrays. By employing a kinematic model of the solar wind, we reconstruct the three-dimensional (3D) structure of the inner-heliosphere from multiple observing lines of sight. From these reconstructions we extract solar wind parameters such as velocity and density, and compare these to ªground truthº measurements from multi-point in situ solar wind measurements from ACE, Ulysses, STEREO, and the Wind spacecraft, particularly during the International Heliophysical Year (IHY). These multi-point comparisons help us improve our 3D reconstruction technique. Because our observations show heliospheric structures globally, this leads to a better understanding of the structure and dynamics of the interplanetary environment around these spacecraft. 11.. IIntenterrpplalanneetataryry SSccinintillatillattioionn Interplanetary Density irregularities carried out by the Two-station IPS measurements are solar wind modulate the signal from a Scintillation (IPS) is where simultaneous observations distant radio source, e.g. Quasar. the rapid variation in are made of the same source by radio signal from a widely separated antennas. -

The Ooty Radio Telescope
The Ooty Radio Telescope Visweshwar Ram Marthi 21 August, Wednesday Radio Astronomy School 2013 A bit of history ● From the Kalyan Solar Array to the ORT. ● To build an equatorial-mount linear telescope. ● Find a slope parallel to earth's axis -> slope = latitude. Can't go too much to the north – why? Reasonably close to the equator. ● Completed in 1970. ● Built fully indigenously, all components designed and built in-house. Some important numbers ● Half-wave dipoles ● 0.57λ spacing between dipoles ● Bandwidth – 4 MHz ● T_sys = 150 K(new array, 1990s). 350K earlier ● A_eff = 0.6 ● Area = 530m x 30 m ● RMS = T_sys / sqrt(Bt) = 150 / √(4e6*1) = 75 mK Gain = 3 K/Jy -> 25 mJy (~40 mJy in practice) ● Confusion limited at ~ 1Jy Swarup et al, 1971, Nature Phy. Sci., 230, 185 The RF chain Further down... Lunar occultation observing Early key science ● Precise measurement of radio source angular sizes and positions: high resolution in declination due to occultation. Res = 4 arcsec. ● Evolution of radio source linear size with redshift and luminosity: an importrant contribution to our understanding of the standard model of the evolving cosmos. ● Interplanetary scintillation (IPS) observations against compact sources to study the intervening medium. ● Observation of radio recombination lines(RRLs) Source identification Swarup et al., 1971 ApJL, 9, 53. Kapahi et al., 1974, MNRAS, 167,299. Pulsar intensity variation Slee et al., 1974, MNRAS, 167, 31. IPS measurements Rao et al., 1974, Aust. J. Phys., 27, 105. Radio Recombination lines Anantharamaiah, 1985, JApA, 6, 177. The ORT now ● Used mainly for IPS-based observations of the solar wind > Solar wind speed, density and turbulence > Propagation of solar flares and CMEs > 3D tomography of the solar wind Manoharan, 2012, ApJ, 751, 128. -

ABSTRACTS Into the Red Dragons Lair
ABSTRACTS Into The Red Dragons Lair Abstracts D. Bezrukovs (1), B. Ryabovs (1), and J. Kallunki (2). Microwave Observations of \Coronal Partings" and Coronal Low Brightness Temperature Regions. (1) Ventspils International Radio Astronomy Center, Latvia, (2) Metsahovi Radio Observatory, Finland. Abstract: \Coronal partings" (CP) are specific coronal hole-like structures characterized by the depressed coronal EUV emission and the open magnetic field. The interest to CPs as to one of probable sources of the slow solar wind appeared some years ago. An associ- ation of some part of low brightness temperature regions (LTR) observed in microwaves and long waves with areas of the coronal EUV emission depression and open magnetic field lines were shown earlier also. The analysis of low contrast microwave spectral polarimetric observations performed by Ventspils International Radio Astronomy Center (VIRAC) RT-32 radio telescope, Met- sahovi Radio Observatory (MRO) and Nobeyama Radio Heliograph (NoRH) showed the close association of LTR depressed microwave emissions in the chromosphere and lower corona with CPs on the periphery of two active regions. Obviously LTRs are indicating the reduced plasma density above CPs along the open magnetic field line. The analysis of long wave LTR from the high corona needs to prove the assumption about the coronal plasma flow to the outer space crossing all layers of the corona. Additional LOFAR solar observations at very long waves have a sufficient spatial resolution to understand the full structure of open magnetic field lines in the all solar corona. The presentation discusses possibilities and eventual results of a joint analysis of magne- tograms, EUV, microwave and long wave solar observations of LTRs in order to clarify the open magnetic field structure of CPs and conditions of a charged particle acceleration in it. -
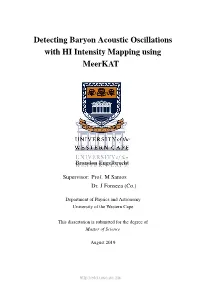
Detecting Baryon Acoustic Oscillations with HI Intensity Mapping Using Meerkat
Detecting Baryon Acoustic Oscillations with HI Intensity Mapping using MeerKAT Brandon Engelbrecht Supervisor: Prof. M Santos Dr. J Fonseca (Co.) Department of Physics and Astronomy University of the Western Cape This dissertation is submitted for the degree of Master of Science August 2019 http://etd.uwc.ac.za/ http://etd.uwc.ac.za/ I would like to dedicate this thesis to my Mother. http://etd.uwc.ac.za/ http://etd.uwc.ac.za/ Declaration I, Brandon Engelbrecht, declare that this thesis titled, "Detecting Baryonic Acoustic Oscilla- tions wit HI Intenisty Mapping for MeerKAT" and the work presented in it are my own. I confirm that: • Where any part of this thesis has previously been submitted for a degree or any other qualification at this University or any other institution, this has been clearly stated. • Where I have quoted from the work of others, the source is always given. With the exception of such quotations, this thesis is entirely my own work. • I have acknowledged all main sources of help. Brandon Engelbrecht August 2019 http://etd.uwc.ac.za/ http://etd.uwc.ac.za/ Acknowledgements Firstly I would like to thank my supervisor Prof. Mario Santos, for giving me the opportunity to work under him as well as being part of the Centre for Radio Cosmology (CRC). He has given his time and effort to aide me through the MSc and I am grateful for that. To my co-supervisor Dr. José Fonseca, whose help has been enormous in the comple- tion of this MSc. Always ready to assist when available especially in making the work understandable. -

Cylindrical SKA Concept
Authors: John D. Bunton CSIRO Telecommunications and Industrial Physics Carole A. Jackson RSAA, Australian National University Elaine M. Sadler School of Physics, University of Sydney Submitted to the SKA Engineering and Management Team by The Executive Secretary Australian SKA Consortium Committee PO Box 76, Epping, NSW 1710, Australia June 2002 Updated 11 July 2002 17 Jul 02 Release 1 CSIRO Table of contents Table of contents ................................................................................................................. 2 Executive summary............................................................................................................. 5 1 Introduction..................................................................................................................6 1.1 Relative Costs: the best of both worlds................................................................. 7 1.2 Instrument Overview............................................................................................. 7 2 Science Drivers .......................................................................................................... 10 2.1 Milky Way and local galaxies............................................................................. 10 2.2 Transient phenomena .......................................................................................... 10 2.3 Early Universe and large-scale structure ............................................................ 11 2.4 Galaxy formation ............................................................................................... -

The Worldwide Interplanetary Scintillation (IPS) Stations (WIPSS) Network October 2016 Observing Campaign: Initial WIPSS Data Analyses M.M
Fall AGU 2017 - SH21A-2648 The Worldwide Interplanetary Scintillation (IPS) Stations (WIPSS) Network October 2016 Observing Campaign: Initial WIPSS Data Analyses M.M. Bisi {[email protected]} (1) ), R.A. Fallows (2), B.V. Jackson (3), M. Tokumaru (4), J.A. Gonzalez-Esparza (5), J. Morgan (6), I. Chashei (7), J.C. Mejia-Ambriz (5), S.A. Tyul’bashev (7), P.K. Manoharan (8), V. De la Luz (5), E. Aguilar-Rodriguez (5), H.-S. Yu (3), D. Barnes (1), O. Chang (9), D. Odstrcil (10)(11), K. Fujiki (4), and V. Shishov (7). (1) RAL Space, Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell Oxford, Didcot, Oxfordshire, OX11 0QX, England, UK. (2) ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy, Postbus 2, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands. (3) Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California, San Diego, La Jolla, CA, 92093-0424, USA. (4) Institute for Space-Earth Environmental, Nagoya University, Furo-Cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan. (5) SCiESMEX/MEXART, Instituto de Geofisica, Unidad Michoacan, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Morelia, Mexico. (6) Curtin Institute of Radio Astronomy, Curtin University, Perth, WA, Australia. (7) Lebedev Physics Institute, Pushchino Radio Astronomy Observatory, Pushchino, Moscow Region, Russia. (8) Radio Astronomy Centre, National Centre for Radio Astrophysics, Tata Institute of Fundamental Research, P.O. Box 8, Udhagamandalam (Ooty) 643001, India. (9) Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofisica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico. (10) NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA. (11) School of Physics, Astronomy, and Computational Sciences, George Mason University, 4400 University Drive, Fairfax, VA 22030-4444, USA.