Gewalt Der Archive
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dreamscapes - CD1 - Dream Machine Intro 1998 - 4:44
Dreamscapes - CD1 - Dream Machine Intro 1998 - 4:44 I'm your best friend, the dream... I'm your best friend, the dream Without a doubt I'm your best friend, the dream You need a friend, without a doubt I wonder why you came around Are you awake, or do you dream? You're stuck inside a frozen scene I'm your best friend, the dream... Dreamscapes - CD1 - In The Mood - 1983, Demo remix - 5:04 He's in the mood to touch the fire He's in the mood to touch everything you are He's in the mood to touch the fire Touch the fire, touch the fire Jacky's locked in a silent dream He's watching movies on the TV-screen He feels unsteady lights a cigarette He's getting mellow in his cabinet Oh, Jacky, when everything goes wrong Get ready, for you've got to be so strong It's so supersensual, sentimental Dial that cipher in your tears, The number to the golden year You've got to touch the fire Wake up little boy You've got to play with fire Wake up, you've got to... You've got to play with fire Jacky hears it, is it her or not ? His eyes are burning 'cause the brain's too hot He's sitting calmly on a swivel chair There's something coming from the upper stairs Now listen to me Jacky, you were always So lonesome in that quiet lonely house High on the hill Just come... come and meet me You know where and we'll take a nice holiday Back in the old, old days of happiness - Oh, Jacky, when everything goes wrong.. -

Gramophone, Film, Typewriter
EDITORS Timothy Lenoir and Hans Ulrich Gumbrecht GRAMOPHONE, FILM, TYPEWRITER FRIEDRICH A. KITTLER Translated, with an Introduction, by GEOFFREY WINT HROP-YOUNG AND MICHAEL WUTZ STANFORD UNIVERSITY PRESS STANFORD, CALIFORNIA The publication of this work was assisted by a subsidy from Inter Nationes, Bonn Gramophone, Film, Typewriter was originally published in German in I986 as Grammophon Film Typewriter, © I986 Brinkmann & Bose, Berlin Stanford University Press Stanford, California © I999 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University Printed in the United States of America erp data appear at the end of the book TRANSLATORS' ACKNOWLEDGMENTS A translation by Dorothea von Mucke of Kittler's Introduction was first published in October 41 (1987): 101-18. The decision to produce our own version does not imply any criticism of the October translation (which was of great help to us) but merely reflects our decision to bring the Introduction in line with the bulk of the book to produce a stylisti cally coherent text. All translations of the primary texts interpolated by Kittler are our own, with the exception of the following: Rilke, "Primal Sound," has been reprinted from Rainer Maria Rilke, Selected Works, vol. I, Prose, trans. G. Craig Houston (New York: New Directions, 1961), 51-56. © 1961 by New Directions Publishing Corporation; used with permis sion. The translation of Heidegger's lecture on the typewriter originally appeared in Martin Heidegger, Parmenides, trans. Andre Schuwer and Richard Rojcewicz (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1992), 80-81, 85-8 6. We would like to acknowledge the help we have received from June K. -

An Evaluation of Compositions for Wind Band According to Specific Criteria of Serious Artistic Merit: a Second Update
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music Music, School of 8-2011 An Evaluation of Compositions for Wind Band According to Specific Criteria of Serious Artistic Merit: A Second Update Clifford Towner University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/musicstudent Part of the Music Practice Commons, and the Other Music Commons Towner, Clifford, "An Evaluation of Compositions for Wind Band According to Specific Criteria of Serious Artistic Merit: A Second Update" (2011). Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music. 44. https://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/44 This Article is brought to you for free and open access by the Music, School of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. AN EVALUATION OF COMPOSITIONS FOR WIND BAND ACCORDING TO SPECIFIC CRITERIA OF SERIOUS ARTISTIC MERIT: A SECOND UPDATE by Clifford N. Towner A DOCTORAL DOCUMENT Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor of Musical Arts Major: Music Under the Supervision of Professor Carolyn Barber Lincoln, Nebraska August, 2011 AN EVALUATION OF COMPOSITIONS FOR WIND BAND ACCORDING TO SPECIFIC CRITERIA OF SERIOUS ARTISTIC MERIT: A SECOND UPDATE Clifford Neil Towner, D.M.A. University of Nebraska, 201l Adviser: Carolyn Barber This study is an update to the 1978 thesis of Acton Eric Ostling, Jr. -

Benzin Im Blut Oder Gas and Blood Eine Übersetzungsanalyse Von Ausgewählten Songtexten Von Tokio Hotel
Benzin im Blut oder Gas and blood Eine Übersetzungsanalyse von ausgewählten Songtexten von Tokio Hotel Bachelorarbeit Viivi Ojala Universität Jyväskylä Institut für Sprachen und Kommunikation Deutsche Sprache und Kultur 18. April 2018 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta – Faculty Laitos – Department Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kieli- ja viestintätieteiden laitos Tekijä – Author Viivi Ojala Työn nimi – Title Benzin im Blut oder Gas and blood: Eine Übersetzungsnalyse von ausgewählten Songtexten von Tokio Hotel Oppiaine – Subject Työn laji – Level Saksan kieli ja kulttuuri Kandidaatintutkielma Aika – Month and year Sivumäärä – Number of pages Huhtikuu 2018 33 Tiivistelmä – Abstract Saksalaisbändi Tokio Hotel eli 2000-luvun puolivälissä kulta-aikaansa saavuttaen suurta suosiota kotimaansa lisäksi ympäri Eurooppaa. Kasvava mielenkiinto bändiä kohtaan erityisesti Euroopan rajojen ulkopuolella aiheutti painetta laajentaa markkinoita; käytännössä tämä tarkoitti laulukielen vaihtamista saksasta englantiin. Tässä kandidaatintutkielmassa analysoidaankin Tokio Hotelin kahden saksankielisen kappaleen käännösprosessia englantiin; mitkä kielelliset ja lyyriset elementit ovat säilyneet samankaltaisina ja toisaalta millaisia eroja käännetyissä versioissa esiintyy. Tutkielmassa havaittiin, että pääpiirteittäin englanninkieliset versiot jäljittelevät alkuperäisiä saksankielisiä kappaleita tietyin poikkeuksin, varsinkin ensimmäiseksi analysoitu englanninkielinen käännös mukailee mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä saksankielistä sovitusta -
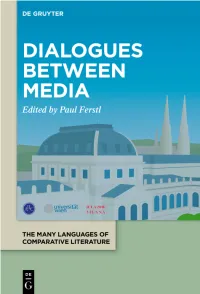
Comics Studies in the Twenty-First Century
Dialogues between Media The Many Languages of Comparative Literature / La littérature comparée: multiples langues, multiples langages / Die vielen Sprachen der Vergleichenden Literaturwissenschaft Collected Papers of the 21st Congress of the ICLA Edited by Achim Hölter Volume 5 Dialogues between Media Edited by Paul Ferstl ISBN 978-3-11-064153-0 e-ISBN (PDF) 978-3-11-064205-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064188-2 DOI https://doi.org/10.1515/9783110642056 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International Licence. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020943602 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2021 Paul Ferstl, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston The book is published open access at www.degruyter.com Cover: Andreas Homann, www.andreashomann.de Typesetting: Dörlemann Satz, Lemförde Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Table of Contents Paul Ferstl Introduction: Dialogues between Media 1 1 Unsettled Narratives: Graphic Novel and Comics Studies in the Twenty-first Century Stefan Buchenberger, Kai Mikkonen The ICLA Research Committee on Comics Studies and Graphic Narrative: Introduction 13 Angelo Piepoli, Lisa DeTora, Umberto Rossi Unsettled Narratives: Graphic Novel and Comics -

Directing Machinal, Sophie Tredwell's Expressionistic Outcry Against the Male Establishment Erin Lucas
University of Portland Pilot Scholars Graduate Theses and Dissertations 2014 Woman vs. Machine: Directing Machinal, Sophie Tredwell's Expressionistic Outcry Against the Male Establishment Erin Lucas Follow this and additional works at: http://pilotscholars.up.edu/etd Part of the Film and Media Studies Commons, and the Fine Arts Commons Recommended Citation Lucas, Erin, "Woman vs. Machine: Directing Machinal, Sophie Tredwell's Expressionistic Outcry Against the Male Establishment" (2014). Graduate Theses and Dissertations. 17. http://pilotscholars.up.edu/etd/17 This Master Thesis is brought to you for free and open access by Pilot Scholars. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Pilot Scholars. For more information, please contact [email protected]. CONTENTS Chapter 1: Introduction 4 Chapter 2: Research 8 Historical Context – American Women in the 1920s 8 Technological Advancement 13 Treadwell Background and Views 16 Source Material – Ruth Snyder Murder Case 20 Expressionism 22 Chapter 3: Analysis 27 Given Circumstances 28 Theatrical Contract 29 Conflict 30 Genre 33 Characters 34 Theme – Female Identity in a Male-Dominated, Mechanized Society 44 Conclusion 48 Chapter 4: Production Approach 49 Scenery 50 Props 54 Lighting 54 Costumes 54 Sound 57 Acting Style 58 Special Problems 60 Conclusion 61 Chapter 5: Auditions, Casting and Rehearsals 63 Auditions 63 Casting 64 Character Meetings 66 First Rehearsal 67 Table Work 68 Style Work 68 The Jury 73 Prologue 73 Transitions 74 Conclusion 74 Chapter 6: Design Process 75 Scenic 76 Costumes 77 Sound 77 2 Lighting 79 Conclusion 79 Chapter 7: Post-Production Response 80 Chapter 8: Conclusion 90 Appendices Appendix A: Audition Notice 92 Appendix B: Production Photos 95 Works Cited 106 3 Chapter 1 Introduction Machinal, French for mechanical or automatic, is Sophie Treadwell’s groundbreaking expressionist play, written in 1928. -

Eldon Black Album Collection
Albums Eldon Black Album Collection These albums are only available for use by ASU students, faculty, and staff. Ask at the Circulation Desk for assistance. (Use the Adobe "Find" to locate song(s) and/or composer(s).) Catalog Number Title Notes 1 Falstaff-Verdi Complete 2 La Perichole Complete 3 Tosca-Puccini Complete 4 Cavalleria Rusticana-Mascagni Complete 5 The Royal Family of Opera 5A lo son l'umile ancella from Adriana Lecouvreur by Cilea 5B Come rugiada al cespite from Ernani by Verdi 5C In questo suolo a lusingar tua cura from La Favorita by Donizetti 5D E lucevan le stelle from Tosca by Puccini 5E Garden Scene Trio from Don Carlo by Verdi 5F Oh, di qual onta aggravasi from Nabucco by Verdi 5G In quelle trine morbide from Manon Lescaut by Puccini 5H Dulcamara/Nemorino duet from "Ecco il magico liquor" from L'Elisir D'Amore by Donizetti 5I Il balen from Il Trovatore by Verdi 5J Mon coeur s'ouvre a ta voix from Samson et Dalila by Saint-Saens 5K Bel raggio lusingheir from Semiramide by Rossini 5L Le Veau d'or from Faust by Gounod 5M Page's Aria from Les Huguenots by Meyerbeer 5N Depuis le jour from Louise by Charpentier 5O Prize Song from Die Meistersinger by Wagner 5P Sois immobile from William Tell by Rossini 5Q Cruda sorte from L'Italiana in Algeri by Rossini 5R Der Volgelfanger bin ich from The Magic Flute by Mozart 5S Suicidio! from La Gioconda by Ponchielli 5T Alla vita che t'arride from A Masked Ball by Verdi 5U O mio babbino caro from Gianni Schicchi by Puccini 5V Amor ti vieta from Fedora by Giordano 5W Dei tuoi figli from -

Tom Cochrane – Take It Home Colin James – Hearts on Fire NE-YO – Non-Fiction
Tom Cochrane – Take It Home Colin James – Hearts on Fire NE-YO – Non-Fiction New Releases From Classics And Jazz Inside!!! And more… UNI15-05 UNIVERSAL MUSIC 2450 Victoria Park Ave., Suite 1, Willowdale, Ontario M2J 5H3 Phone: (416) 718.4000 *Artwork shown may not be final Tuesday, December 16, 2014 Dear Commercial Partner, Please be advised that, effective February 9th, 2015 Universal Music Canada will convert titles posted to http://www.umcreleasebooks.ca to JSP ($10.98 NEDP) pricing. All orders placed prior to February 9th, 2015 will attract the old price and all orders placed post February 9th, 2015 will attract the new JSP pricing. **Please note normal terms will not apply to this new price tier.** Please contact your local Universal Music Canada representative, should you have any questions. Cher Partenaire Commercial, Nous vous avisons qu’à compter du 9 février 2015, Universal Music Canada convertira les titres indiqués sur http://www.umcreleasebooks.ca au code de prix JSP ($10.98 NEPD). Toutes commandes envoyées avant le 9 février 2015 auront le vieux prix de vente alors que les commandes envoyées après le 9 février 2015 auront le nouveau prix de vente JSP. ** Veuillez prendre note que nos Termes Normaux ne s’appliqueront pas à ce nouveau code de prix. ** N’hésitez pas à contacter votre représentant de Universal Music Canada local si vous avez des questions. Regards/Sincèrement, Adam Abbasakoor Vice President, Commercial Affairs Universal Music Canada [email protected] UNIVERSAL MUSIC CANADA NEW RELEASE Artist/Title: DIANA KRALL / WALLFLOWER (Standard CD) Cat. #: B002098902 Price Code: SP Order Due: Jan. -

Schrei, So Laut Du Kannst! Tokio Hotel Für the DOME 41 Bestätigt!
RTLZWEI 15.02.2007 – 13:10 Uhr Schrei, so laut Du kannst! Tokio Hotel für THE DOME 41 bestätigt! Berlin (ots) - TV-Termin: Samstag, 10. März ab 16.00 Uhr bei RTL II Aufzeichnung: Freitag, 2. März 2007, SAP Arena Mannheim Mannheim im Ausnahmezustand: 10.000 Fans trainieren ihre Lungen für den Jubelschrei. Tokio Hotel kommt zu THE DOME 41! Außerdem werden 2raumwohnung, Kim Frank, Jamelia, Monrose, Simon Webbe, Sido, Sunrise Avenue und Nevio begeistert erwartet, wenn am 2. März THE DOME 41 in der Mannheimer SAP Arena steigt! Paris, Budapest, Prag, Warschau und die russische Hauptstadt Moskau, das sind die Stationen der Tokio Hotel Tour zu ihrem neuen Album "Zimmer 483". Egal ob Arc de Triomphe oder Brandenburger Tor - wo die vier Jungs auftauchen, erinnern die Szenen an die Beatlemania. Innerhalb weniger Monate ist das nationale Teenie-Rock Phänomen zu internationalen Superstars gereift. Hatte man bisher Tokio Hotel als vorübergehende Erscheinung für Zahnspangenträgerinnen gehalten, werden sie jetzt auch von etablierten Kollegen als große Künstler angesehen. Angeführt von Bill Kaulitz gehen sie ihren Weg. Sie räumen eine Auszeichnung nach der anderen ab, marschieren über rote Teppiche und füllen die größten Hallen Europas. Das dickste Kreuz im Tourkalender: THE DOME 41 in Mannheim! Hier gibt Tokio Hotel ein Konzert im Konzert. Das heißt, die Jungs performen neben ihrer neuen Single "Übers Ende der Welt" noch zwei weitere Songs. Damit erfüllen sie das neue Konzept von THE DOME, das einzelnen Künstlern ab jetzt eine größere Plattform bietet und den Fans damit mehr von Bill! Schrei! Moderatorin des Abends ist Gülcan mit zwei bisher noch geheimen Kollegen. -

DISCOGRAPHY Moritz Enders Producer, Mixer, Engineer, Songwriter
Reimersbrücke 5 DISCOGRAPHY 20457 Hamburg Tel: 040 / 28 00 879 - 0 Moritz Enders Fax: 040 / 28 00 879 - 28 mail: [email protected] producer, mixer, engineer, songwriter ECHO 2015 "Rock/Alternative / National Unheilig "Gipfelstürmer" ECHO 2014 Künstler "Rock/Pop / National Tim Bendzko "Am seidenen Faden" 1 Live Krone 2013 Bestes Album - Casper "Hinterland" Unheilig "Gipfelstürmer" (GER) Casper "Hinterland" (GER) (#21 der erfolgreichsten LPs 2013) Platin Award Peter Maffay "Ewig" (Platin Edition) Kraftklub "Mit K" Silbermond "Leichtes Gepäck" (GER, CHE) Kraftklub "In Schwarz" (GER) Tim Bendzko "Am seidenen Faden" (3xGER) (#22 der erfolreichsten LPs 2013) Gold Award Casper "Hinterland" (AUT) Frida Gold "Wovon sollen wir träumen" , "Juwel" Revolverheld "In Farbe", "Halt dich an mir fest" P: Producer E: Engineer M: Mixer R: Remixer Co-W: Co-Writer W: Writer ED: Editor Pro: Programmer A: Arrangement Year Artist Title Project Label Credit 2021 Lotte & Sebastian Fitzek "Mauern" Single Sony Music Catalog M Bosse "Sunnyside" Album Universal M Fil Bo Riva "Solo" Single Humming Records M Bosse "Der Sommer" Single Universal Music M Bosse "Sunnyside" Single Universal Music M Schimmerling "Königin der Nacht" Single RCA P, M Milliarden "Schuldig" Album Zuckerplatte M Blackout Problems "Dark" Album RCA/ Sony Music M Milliarden "Die Fälschungen sind echt" Single RCA M 2020 Blackout Problems "Houseonfire" Single RCA M Milliarden "Die Gedanken sind frei" Single Zuckerplatte M Fil Bo Riva "Cold Mine" Single Humming Records M Bosse "Das Paradies" -

Music Defining Moments 79 Awesome Threesome from $39.00/Mth NEW at $20.30/Mth U.P
WHERE TO FIND HYPE COMPLIMENTARY COPIES OF HYPE MAGAZINE ARE AVAILABLE AT THE FOLLOWING PLACES Island Creamery Yigloo 10 Jalan Serene #01-03 Serene Vivo City B2-06A Centre 11 King Albert Park McDonald’s Everything With Fries Place #01-02 40 Lorong Mambong Great World City (Basement 1) 458 Joo Chiat Road Timbre@Arts House South Bridge Jazz @ 7atenine 1 Old Parliment Lane, #01-04 8 Raffles Avenue, #01-10/12 Timbre@The Substation Esplanade Mall 45 Armenian Street Timbre@Old School Miss Clarity Café 11A Mount Sophia #01-05 5 Purvis Street #01-04 205 Upp Thomson Rd Minds Café 60A Prinsep Street S’pore Egg3 188664 33 Erskine Road #01-10 Funan Digitalife Mall #02-16 The Cathay Handy Road #01-04 68 Boat Quay (Raffles Place) 260 Joo Chiat Rd 1A Tampines Street 92 #01-00A Fourskin Dunkin Donuts #04-33, L4Annex 2 Orchard Turn #B2-17 The Heeren, Orchard Road Once Upon A Milkshake 32 Maxwell Rd (Tanjong Pagar Rockstar (by Soon Lee) MRT) 8 Grange Road, Orchard 2 Orchard Link #02-03/04 *SCAPE Cineleisure, #03-08 The Garden Slug Cafeteria ilLido 55 Lorong L Telok Kurau 3 Temasek Boulevard #B1-012 #01-59/61 Bright Centre Suntec City Mall Sogurt Loft 617 Bukit Timah Road 16A Haji Lane Jolly Frog Bistro Threadbare & Squirrel 81 Neil Road 43 Haji Lane, 2nd Storey CONTENT ON THE COVER 12 SWEET, SWEET SEZAIRI Meet the other side of your third Singapore 25 18 Idol, Sezairi Sezali, who confesses to be a closet romantic. (Gasp!) 15 JUST JAY It’s been 10 years since Jay Chou first burst onto the mandopop scene. -

Popxport Ranking – the List the Most Successful Music Titles from Germany | Editorial Deadline: 1 July 2016
Page 1 PopXport Ranking – The List The Most Successful Music Titles from Germany | Editorial Deadline: 1 July 2016 Position Year Artist Title Single or Highest chart position Highest chart position Highest chart position Highest chart position Points Album in Germany in the UK in the USA in another country Position Points Position Points Position Points Position Country Points Total 1 2015 Felix Jaehn Cheerleader (OMI / Felix Jaehn Remix) S 1 108,9 1 118,8 1 128,7 1 Australia 99 455,4 2 1983 Nena 99 Luftballons / 99 Red Balloons S 1 108,9 1 118,8 2 127,4 1 New Zealand 99 454,1 3 1989 Milli Vanilli Girl I’m Gonna Miss You S 2 107,8 2 117,6 1 128,7 1 Netherlands 99 453,1 4 1990 Snap! The Power S 2 107,8 1 118,8 2 127,4 1 Netherlands 99 453 5 1999 Lou Bega Mambo No. 5 (A little bit of…) S 1 108,9 1 118,8 3 126,1 1 France 99 452,8 6 1989 Milli Vanilli Girl You Know It’s True S 1 108,9 3 116,4 2 127,4 2 Netherlands 98 450,7 7 1985 Harold Faltermeyer Axel F (OST “Beverly Hills Cop I”) S 2 107,8 2 117,6 3 126,1 1 Ireland 99 450,5 8 1991 Scorpions Wind of Change S 1 108,9 2 117,6 4 124,8 1 France 99 450,3 9 1990 Enigma Sadeness (Part 1) S 1 108,9 1 118,8 5 123,5 1 France 99 450,2 10 1992 Snap! Rhythm Is a Dancer S 1 108,9 1 118,8 5 123,5 1 France 99 450,2 Page 2 Position Year Artist Title Single or Highest chart position Highest chart position Highest chart position Highest chart position Points Album in Germany in the UK in the USA in another country Position Points Position Points Position Points Position Country Points Total 11 1996 No Mercy Where Do You Go S 3 106,7 2 117,6 5 123,5 1 Canada 99 446,8 12 1977 Donna Summer I Feel Love S 3 106,7 1 118,8 6 122,2 1 Netherlands 99 446,7 13 1990 Enigma MCMXC a.D.