Fuck You, Silicon Valley!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

In Nordrhein-Westfalen Den Mythos Des Silicon Valley Herausnehmen Garantieren SEITE 8 SEITE 4 SEITE 3 WIRTSCHAFT in NORDRHEIN-WESTFALEN Nr
Poster Netzwerkerin Laborwerte Die Rheinländerin Wo sitzen die innovativsten Erfindungen in Serie: Margit Wennmachers Konzerne der Welt? Wie die F&E-Abteilungen wandert mit 26 nach Zahlen, Daten und Fakten die Zukunft der Konzerne Kalifornien aus. Und erfindet auf einer Doppelseite zum in Nordrhein-Westfalen den Mythos des Silicon Valley Herausnehmen garantieren SEITE 8 SEITE 4 SEITE 3 WIRTSCHAFT IN NORDRHEIN-WESTFALEN Nr. 10 | JUNI 2018 EDITORIAL Wie sieht's mit dem Cover für die Zeitung aus? Wir brauchen was zum Thema „Innovation". Liebe Leserin, lieber Leser, was ist das wichtigste Thema in Wei- terbildungsangeboten für Unterneh- menslenker und Führungskräfte? Ganz klar: Innovation. Denn die Fähigkeit, sich zu erneuern, seine Produkte und Dienstleistungen zu optimieren oder sich gar neu zu erfinden, entscheidet über die Zukunft eines Unternehmens. Über Wachstum und Wohlstand. „Wer als Unternehmer heute nicht inno- vativ denkt, ist morgen Geschichte“, Es bringt es Marco Gardini auf den Punkt, Was ist das denn für ein Wirtschaftsprofessor und Koordinator Zausel?! Ist das Einstein? des Masterstudiums Innovation an der Dir ist schon klar, dass wir Hochschule Kempten. 2018 haben, nicht 1918? Gerade in NRW erleben wir, dass der Auf dem Cover will ich was Strukturwandel aus den alten Energie- werde Frischeres! industrien in moderne, technologisch Das ist es! geprägte Dienstleistungsunternehmen Leg los! schmerzhaft sein kann, wenn neue Märkte und Rahmenbedingungen nicht erkannt werden. Produkte zu verbessern war schon immer Kern des Licht! Erfolgsmodells „Made in Germany“. Die Gretchenfrage ist, wie sich Innova- tion organisieren lässt in den Mühlen des unternehmerischen Alltags. Wie zieht Kreativität in die Arbeitsabläufe Okay, das war ein? Gibt es Methoden, die man kennen ein cooles Cover. -

Innovationsreport Ruhr Der RAG-Stiftung Spricht Also Motoren Für Innovation
2020 Innova t i o n s repor t RUHR neue Impulse durch Startups und ihr Ökosystem 2020 Herausgeber Bundesverband Deutsche Startups e.V. Partner und Förderer RAG-Stiftung Innova Autoren Dr. Alexander Hirschfeld Jannis Gilde t i o n s Wissenschaftliche Begleitung Prof. Dr. Tobias Kollmann repor t Design Dina Wagasowa Unterstützung Fabian Tode Nicolas Kollat RUHR ISBN 978-3-9819968-7-6 Kooperationspartner neue Impulse durch Startups und ihr Ökosystem G RUSS WORT Armin Laschet Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Oft entstehen Innovationen aus Herausforderungen. gesamte Lebensraum gemeint ist. Und genau deshalb nachhaltig zu leben. Kurze Wege und eine große Bevölke- Und oft kann eine gute Idee die Keimzelle eines großen haben wir bei der Ruhr-Konferenz alle Lebensbereiche rungsdichte bewirken, dass viele Menschen wesentliche Unternehmens sein. Damit hat das Ruhrgebiet viel Er- in die fünf Handlungsfelder „Vernetzte Mobilität - kurze Angebote in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur fahrung, nicht nur mit technologischen Innovationen bei Wege“, „Erfolgreiche Wirtschaft - gute Arbeit“, „Gelebte und Freizeit gemeinsam nutzen. Höchste Qualität und der Stahlherstellung oder der Kohleförderung, sondern Vielfalt - starker Zusammenhalt“, „Sichere Energie - ge- Effizienz gehen somit Hand in Hand. auch mit Blick auf den sozialen Fortschritt, etwa durch sunde Umwelt“ und „Beste Bildung - exzellente For- Betriebskrankenkassen oder Werkssiedlungen. Heraus- schung“ einbezogen. Wenn wir mehr Gründer und Inves- Viele Herausforderungen liegen noch vor uns. Nur ein forderung, Innovation, Unternehmensgründung - dieser toren ins Ruhrgebiet holen und wenn wir die Absolventen Beispiel: Damit Metropolregionen eines Tages klima- Dreiklang ist für das Revier und seine Menschen also an unseren Hochschulen zum Bleiben bewegen wollen, neutral sein können, müssen sie jeden verfügbaren nicht neu. -

Download Book
0111001001101011 01THE00101010100 0111001001101001 010PSYHOLOGY0111 011100OF01011100 010010010011010 0110011SILION011 01VALLEY01101001 ETHICAL THREATS AND EMOTIONAL UNINTELLIGENCE 01001001001110IN THE TECH INDUSTRY 10 0100100100KATY COOK 110110 0110011011100011 The Psychology of Silicon Valley “As someone who has studied the impact of technology since the early 1980s I am appalled at how psychological principles are being used as part of the busi- ness model of many tech companies. More and more often I see behaviorism at work in attempting to lure brains to a site or app and to keep them coming back day after day. This book exposes these practices and offers readers a glimpse behind the “emotional scenes” as tech companies come out psychologically fir- ing at their consumers. Unless these practices are exposed and made public, tech companies will continue to shape our brains and not in a good way.” —Larry D. Rosen, Professor Emeritus of Psychology, author of 7 books including The Distracted Mind: Ancient Brains in a High Tech World “The Psychology of Silicon Valley is a remarkable story of an industry’s shift from idealism to narcissism and even sociopathy. But deep cracks are showing in the Valley’s mantra of ‘we know better than you.’ Katy Cook’s engaging read has a message that needs to be heard now.” —Richard Freed, author of Wired Child “A welcome journey through the mind of the world’s most influential industry at a time when understanding Silicon Valley’s motivations, myths, and ethics are vitally important.” —Scott Galloway, Professor of Marketing, NYU and author of The Algebra of Happiness and The Four Katy Cook The Psychology of Silicon Valley Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry Katy Cook Centre for Technology Awareness London, UK ISBN 978-3-030-27363-7 ISBN 978-3-030-27364-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-27364-4 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2020 This book is an open access publication. -

A16z Podcasting
SED 889 Transcript EPISODE 889 [INTRODUCTION] [00:00:00] JM: The a16z podcast is a show that is produced by Andreessen Horwitz, an investment fund based in Silicon Valley. The a16z podcast covers topics including software engineering, biology, media, cryptocurrencies and entrepreneurship. A16z is one of the most popular podcasts about technology Sonal Chokshi is the editor-in-chief at Andreessen Horwitz and the show runner for the a16z podcast. For five years, she's been interviewing entrepreneurs, engineers, artists, and investors exploring how software has increasingly impacted our lives and transforms society. The success of the a16z podcast is largely a result of Sonal’s high editorial standards and her ability to ask the right questions and drive conversations in fruitful directions. Much of the content of Software Engineering Daily has been shaped by a16z, and I've listened to every single episode. Sonal Chokshi joins today show up for a conversation about podcasting and technology. Sonal shares her beliefs for why the podcast medium has taken off and describes how her background in education, ethnography and technology have shaped the completely distinct voice and flavor of the a16z podcast. [SPONSOR MESSAGE] [00:01:33] JM: Apache Kafka has changed the world of data infrastructure, and Kafka Summit is the place to learn about new design patterns and engineering practices in the world of Kafka. Kafka Summit returns to San Francisco, September 30th through October 1st, 2019. Kafka Summit has sold out in New York and London, and the San Francisco event is likely to be just as popular. -

The Best Agencies, Campaigns, Influencers & Innovators of 2016
The Best Agencies, Campaigns, Influencers & Innovators of 2016 “Proving and improving the value of public relations” - Paul Holmes The Holmes Group is dedicated to proving and improving the value of public relations, by providing insight, knowledge and recognition to public relations professionals. The Holmes Group was founded in 2000 by Paul Holmes, publisher and CEO, who has more than two decades of experience writing about and evaluating the public relations EXVLQHVVDQGFRQVXOWLQJZLWKERWKSXEOLFUHODWLRQVȴUPVDQGWKHLUFOLHQWV(YHU\\HDUWKH Holmes Report’s delivers — not only the most sophisticated reporting and analysis on PR trends and issues — but also the industry’s most sought-after awards and events around the world. Paul Holmes Arun Sudhaman Founder & CEO President & Editor-in-Chief E: [email protected] T: +44 1767 261 082 E: [email protected] Aarti Shah Head of Strategic Partnerships Celeste Picco & Operations Administrator T: +1 510 808 5855 T: +1 212 333 2300 E: [email protected] E: [email protected] Patrick Drury Annabel Davis Account Director T: +44 (0) 203 238 2048 T: +1 732 299 1847 E: [email protected] E: [email protected] North America Europe The Holmes Group The Holmes Group 271 West 47th Street 6 Sussex Mews West Suite 23-A W2 2SE New York, NY 10036 United Kingdom +1 212 333 2300 +44 (0)203 238 2048 The Holmes Report 2016 book was designed by Studio 22 and Logo Logo. FOREWORD BY PAUL HOLMES But at the same time there are individuals, companies, agencies, questions about who should and campaigns that demonstrate be responsible for reputation. how public relations can remain Modern marketers are coming relevant—can in fact take on an to realize that they can’t do expanded and more critical role— their jobs properly without in this changing environment. -
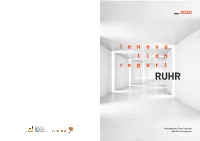
I N N O V a T I O N R E P O
2020 I n n o v a t i o n repo r t RUHR New Impulses From Startups And Their Ecosystem 2020 Publisher Bundesverband Deutsche Startups e.V. Partner and sponsor RAG-Stiftung I n n o v a Authors Dr. Alexander Hirschfeld Jannis Gilde t i o n Scientific support Prof. Dr. Tobias Kollmann repo r t Design Dina Wagasowa Support Fabian Tode Nicolas Kollat RUHR ISBN 978-3-9819968-7-6 Cooperation partners New Impulses From Startups And Their Ecosystem FORE WORD Armin Laschet Minister-President of the State of North Rhine-Westphalia Innovations often arise out of challenges. And often a Ruhr Conference, we have incorporated all areas of in the areas of health, education, culture and leisure. good idea can sow the seed for a large company. The life into the five fields of action “Networked mobility - The highest standards of quality and efficiency thus Ruhr area has a lot of experience in this field, not only short distances”, “Successful economy - good work”, go hand in hand. with technological innovations in steel production or “Living diversity - stronger solidarity”, „Safe energy coal extraction, but in connection with social pro- - healthy environment” and “Best education - excel- Many challenges still lie ahead. Let’s just take one gress, for example company health insurance funds or lent research”. If we want to attract more founders example: If metropolitan regions strive to be climate- workers’ housing estates. and investors to the Ruhr and if we want to persuade neutral eventually, they have to use every available graduates at our universities to stay, then we have to ray of sunshine and every last bit of waste heat. -

Tomorrow's Advance
The Mind of Marc Andreessen The New Yorker.pdf Saved to Dropbox • 20 Mar 2019 at 09A19 Letter from California May 18, 2015 Issue Tomorrow’s Advance Man Marc Andreessen’s plan to win the future. By Tad Friend n a bright October morning, O Suhail Doshi drove to Silicon Valley in his parents’ Honda Civic, carrying a laptop with a twelve-slide presentation that was surely worth at least ffty million dollars. Doshi, the twenty-six-year-old C.E.O. of a data- analytics startup called Mixpanel, had come from San Francisco to Sand Hill Road in Menlo Park, where many of the world’s most prestigious venture- capital frms cluster, to pitch Andreessen Horowitz, the road’s At his frm, Andreessen Horowitz, the newest and most unusual frm. Inside venture capitalist routinely lays out “what will happen in the next ten, twenty, thirty the offices, he stood at the head of a years.” massive beechwood conference table Photograph by Joe Pugliese to address the frm’s deal team and its seven general partners—the men who venture the money, take a seat on the board, and fre the entrepreneur if things go wrong. Marc Andreessen, the frm’s co-founder, fxed his gaze on Doshi as he disinfected his germless hands with a sanitizing wipe. Andreessen is forty- three years old and six feet fve inches tall, with a cranium so large, bald, and oblong that you can’t help but think of words like “jumbo” and “Grade A.” Two decades ago, he was the animating spirit of Netscape, the Web browser that launched the Internet boom. -
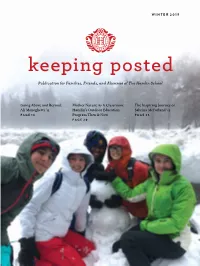
Keeping Posted
WINTER 2019 keeping posted Publication for Families, Friends, and Alumnae of The Hamlin School Going Above and Beyond: Mother Nature As A Classroom: The Inspiring Journey of Ali Meneghetti ‘11 Hamlin’s Outdoor Education Sabrina McFarland ‘15 PAGE 16 Program Then & Now PAGE 35 PAGE 20 EDITORIAL Adrienne Moon Director of Alumnae Engagement & Legacy Giving [email protected] Ashley Burke Director of Communications Publication for Families, Friends, and Alumnae of The Hamlin School [email protected] GRAPHIC DESIGN IN THIS ISSUE | WINTER 2019 Sheri Kuniyuki www.sherikuniyuki.com COVER PHOTOGRAPHY Michelle Lovejoy Middle School Teacher & Outdoor Education Coordinator PRINTING The Graphics Resource SPOTLIGHT ON WELCOME THE GIRLS HEAD OF SCHOOL THE CREED Wanda M. Holland Greene Welcome letter from Head of School Hamlin Girl Competes on American Going Above and Beyond: EXECUTIVE DIRECTOR OF INSTITUTIONAL ADVANCEMENT Wanda M. Holland Greene | 4 Ninja Warrior Jr. | 6 Ali Meneghetti ‘11 | 16 Lauren Thornhill P‘27 Graduation 2019 | 8 Hamlin & Hamilton Families: Celebrating 20 Years of Partnership | 10 My Visit With Hamlin Alumna and Mayor Keeping Posted is published by The Hamlin School annually. Every effort of Sonoma, Amy Harrington ‘90 | 11 is made to avoid errors, misspellings, and omissions. If, however, an A Year in Photos | 13 error comes to your attention, please accept our apologies and notify us. Thank you. Please forward address changes to: The Hamlin School 2120 Broadway San Francisco, CA 94115 415.674.5427 [email protected] THE PROFESSIONAL -

The Sage Group Presents Marketers That Matter(TM) Award Finalists
Source: Highwire Public Relations March 19, 2013 18:51 ET The Sage Group Presents Marketers That Matter(TM) Award Finalists The Wall Street Journal Sponsors an All-Star Panel of Judges in Recognizing Bay Area's Most Influential Marketing Executives SAN FRANCISCO, CA--(Marketwire - Mar 19, 2013) - The Sage Group announced the finalists for Marketers That Matter™, a new award sponsored by The Wall Street Journal that recognizes outstanding marketing executives at the forefront of their field. An elite panel of Council Members from Virgin America, PayPal, YouTube, Workday, Informatica and others narrowed the field of applicants from hundreds to the final 35 marketers that demonstrate proven success in a rapidly changing environment. A panel of judges that includes top executives from Williams-Sonoma, Wells Fargo, LinkedIn, Intuit, Adobe, VMware, Twitter will select the winners based on driving results, leading & inspiring teams, and advancing their profession. "Across all the applications and interviews, several themes emerged regardless of company size, industry, or customer type," said The Sage Group CEO, Cara France. "At the highest level, best-in-class marketers have a relentless focus on the customer and a unique ability to harness that into innovative approaches that create impressive and measurable results. The Bay Area has always been recognized as being a leader in technology; now it's time to also recognize the area's leadership in marketing." This advertising initiative was created without the involvement of The Wall Street Journal's news department. Award Shows Value of Marketers That Matter Overall, leading-edge marketers put customers at the center, creating and delivering strategies that both push and pull. -
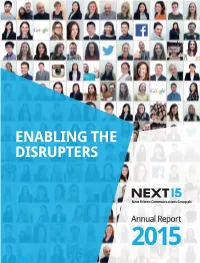
Enabling the Disrupters
Next Fifteen Communications Group plc Annual Report 201 ENABLING THE DISRUPTERS 5 Next Fifteen Communications Group plc Annual Report 2015 ifc/01 CONTENTS This Annual Report covers the statutory 01–16 STRATEGIC REPORT reporting period, which is the 18 months Financial and operational highlights 01 About us 02 to 31 January 2015 (‘the reporting period’). A letter from our Chairman 04 A message from our Chief The Annual Report for the previous Executive Officer 06 statutory reporting period covered the Our mission and strategy 08 Key performance indicators 09 financial year ended 31 July 2013. Financial Review 10 The change in the Group’s financial year How we manage our risks 13 end from 31 July to 31 January was made Principal risks and uncertainties 14 to better align with our clients’ budgeting 17–35 GOVERNANCE cycle, the majority of which have Board of Directors 17 Corporate Governance Report 19 December year ends. In order to aid Directors’ Remuneration Report 25 understanding of the underlying Report of the Directors 31 Statement of Directors’ Responsibilities 34 performance of the business, Independent Auditors’ Report 35 commentary in the Chairman’s letter, CEO’s message and Financial Review 36–101 FINANCIAL STATEMENTS Consolidated Income Statement 36 focuses on the headline results being Consolidated Statement of Comprehensive Income 37 the adjusted unaudited performance for Consolidated Balance Sheet 38 the 12 months to 31 January 2015 Consolidated Statement of Changes in Equity 39 compared with the 12-month Consolidated Statement of Cash Flow 41 unaudited period to 31 January 2014. Notes to the accounts 43 Company Balance Sheet 86 Items that are excluded from Reconciliation of movements headline results are detailed within in shareholders’ funds 87 Notes forming part of the Company pages 96 to 101. -

Digital Evolution
Next Fifteen Communications Group plc Group Communications Fifteen Next Next Fifteen Communications Group plc Next Fifteen Communications Group plc Annual Report 2012 The Triangle 5–17 Hammersmith Grove London W6 0LG T: +44 (0)20 8846 0770 www.next15.com DIGITAL Ann ual Report 2012 Report ual EVOLUTION Scan this code with one of the many available QR reader apps on your smartphone to access our online Review of 2012 Or visit: http://www.ar12.next15.com 015789_Next15_cover (Working Copy).indd 1 26/11/2012 14:59 INTRODUCTION Using your smartphone, scan this THIS YEAR WE HAVE CREATED AN ONLINE code to access our online Review of 2012. REVIEW OF 2012 TO COMPLEMENT THIS Or visit: http://www.ar12.next15.com ANNUAL REPORT, WHICH CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE, WWW.NEXT15.COM. THE SITE FEATURES CLIENT CASE STUDIES, GIVING EXAMPLES OF THE DIFFERENT TYPES OF DIGITAL WORK WE ARE NOW DOING. THE REVIEW OF THE YEAR ALSO EXAMINES OUR PROGRESS ON TRANSITIONING THE BUSINESS IN THE NEW DIGITAL WORLD. CONTENTS OVERVIEW FINANCIAL STATEMENTS Introduction IFC Consolidated income statement 30 Highlights 01 Consolidated statement of 31 Chairman’s statement 02 comprehensive income OPERATING REVIEW Consolidated balance sheet 32 Business Review 04 Consolidated statement of changes 33 in equity Financial Review 06 Consolidated statement of cash flow 35 GOVERNANCE Notes to the accounts 37 Board of Directors 11 Company balance sheet 78 Report of the Directors 13 Reconciliation of movements 79 Remuneration Report 16 in shareholders’ funds Directors’ statement on Corporate -

Alumni Benefits
THE MAGAZINE OF THE HAAS SCHOOL OF BUSINESS AT THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY University of California, Berkeley Nonprofit Organization Haas School of Business US Postage 545 Student Services #1900 PAID Berkeley, CA 94720-1900 Portland, OR Permit NO. 2917 Summer 2014 Toby Stuart, Expert in Ulrike Entrepreneurship Malmendier, and Networks Leader in Behavioral Economics Berkeley-Haas Alumni Take advantage Benefits of all that your degree provides. Faculty Rock Stars Meet the next generation of big thinkers at Haas haas.berkeley.edu/alumni/benefits Step outside of your day-to-day and return to one of the most stimulating business environments in the world. Summer 2014 FEATURES AND DEPARTMENTS The Faculty Issue EDITOR IN CHIEF Ronna Kelly, BS 92 UP FRONT EXECUTIVE EDITORS UPCOMING PROGRAMS Richard Kurovsky Ute Frey DESIGN Financial Analysis for Non-Financial Executives Cuttriss & Hambleton, Berkeley Sep 29-Oct 3, 2014 STAFF WRITERS Laura Counts, Amy Marcott, Pamela Tom The Berkeley Executive Leadership Program 2 Haas List Haas faculty teach Chinese CONTRIBUTING WRITERS Oct 6-10, 2014 leaders in a new executive- Ed Andrews, Andrea Appleton, level program in Shanghai. Steven Cohen, Kim Girard, Winfried Konrad, Dan Mitchell, 4 Haas News Marguerite Rigoglioso Women’s Executive Leadership Program Dean Rich Lyons on developing innovative leaders. PHOTOGRAPHY Oct 13-16, 2014 6 Power of Ideas Jim Block, Alex Fradkin, Prof. Terrence Hendershott Gabriela Hasbun, weighs in on high-speed Robert Houser, Joe Larese, trading. Karl Nielsen, Genevieve The Art of the Pitch Shiffrar IN THE BACK Oct 20-21, 2014 ILLUSTRATORS James William Gary, Thomas Porostocky The Innovative Organization Berkeley-Haas magazine is published by the Haas School Oct 27-21, 2014 of Business, University of California, Berkeley.