Persönliche Weblogs in Organisationen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Healthcare Blogging-A Review S Sethi
The Internet Journal of Radiology ISPUB.COM Volume 10 Number 2 Healthcare Blogging-A review S Sethi Citation S Sethi. Healthcare Blogging-A review. The Internet Journal of Radiology. 2008 Volume 10 Number 2. Abstract The Internet is changing medicine and web 2.0 is the current buzz word in the world wide web dictionary. According to Dean Giustini in British Medical Journal, web 2.0 means “the web as platform” and “architecture of participation”. It is the web or internet information which is created by the users themselves. Web 2.0 is primarily about the benefits of easy to use and free internet software. For example, blogs and wikis facilitate participation and conversations across a vast geographical expanse. Information pushing devices, like RSS feeds, permit continuous instant alerting to the latest ideas in medicine. Multimedia tools like podcasts and videocasts are increasingly popular in medical schools and medical journals. Recently, there has been no escaping the mention of blogs in the media. Blogging has emerged as a social phenomenon, which has impacted politics, business, and communication. Medical field or healthcare is also not immune to this global phenomenon. Hence this chapter will deal with this phenomenon of blogging, with emphasis on what is a blog, historical significance, various software platforms available, blogging for a physician, pros and cons of blogging in healthcare, examples from popular healthcare blogs and prediction for future trends. This chapter will familiarize the reader about healthcare blogs and their impact on healthcare. INTRODUCTION participating in these small communities with fellow A blog or weblog (derived from web+log) is a web based ‘‘techies.’‘ Because of the skills and understanding required publication consisting primarily of periodic articles to create blogs, they were not nearly as widespread as they (normally, but not always, in reverse chronological order). -

L-G-0004998833-0007910864.Pdf
Grahams HD:Users:Graham:Public:GRAHAM'S IMAC JOBS:14238 - POLITY - WALKER RETTBERG:WALKER-RETTBERG 9780745663647 PRINT Blogging Second Edition Grahams HD:Users:Graham:Public:GRAHAM'S IMAC JOBS:14238 - POLITY - WALKER RETTBERG:WALKER-RETTBERG 9780745663647 PRINT Digital Media and Society Series Nancy Baym: Personal Connections in the Digital Age Jean Burgess and Joshua Green: YouTube Mark Deuze: Media Work Charles Ess: Digital Media Ethics, 2nd edition Alexander Halavais: Search Engine Society Graeme Kirkpatrick: Computer Games and the Social Imaginary Martin Hand: Ubiquitous Photography Robert Hassan: The Information Society Tim Jordan: Hacking Leah A. Lievrouw: Alternative and Activist New Media Rich Ling and Jonathan Donner: Mobile Communication Donald Matheson and Stuart Allan: Digital War Reporting Dhiraj Murthy: Twitter Zizi A. Papacharissi: A Private Sphere Jill Walker Rettberg: Blogging, 2nd edition Patrik Wikström: The Music Industry, 2nd edition Blogging Second edition Jill Walker Rettberg polity Grahams HD:Users:Graham:Public:GRAHAM'S IMAC JOBS:14238 - POLITY - WALKER RETTBERG:WALKER-RETTBERG 9780745663647 PRINT Copyright © Jill Walker Rettberg 2014 The right of Jill Walker Rettberg to be identified as Author of this Work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. First edition published in 2008 by Polity Press This second edition first published in 2014 by Polity Press Polity Press 65 Bridge Street Cambridge CB2 1UR, UK Polity Press 350 Main Street Malden, MA 02148, USA All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. -

Why Blog? Searching for Writing on the Web by Alex Reid
Why Blog? Searching for Writing on the Web by Alex Reid This essay is a chapter in Writing Spaces: Readings on Writing, Volume 2, a peer-reviewed open textbook series for the writing classroom. Download the full volume and individual chapters from • !riting "paces http //writingspaces.org/essays • $arlor $ress http //parlorpress.com/writingspaces • !%& &learinghouse http //wac.colostate.edu/books# $rint versions of the volume are available for purchase directly from $arlor $ress and through other booksellers. This essay is available under a &reative &ommons 'icense subject to the !riting "paces) Terms of *se. +ore information, such as the specific license being used, is available at the bottom of the first page of the chapter. , 2011 by the respective author(s0. 1or reprint rights and other permissions, contact the original author(s0. 'ibrary of &ongress &ataloging-in-$ublication Data !riting spaces readings on writing. Volume 1 # edited by &harles 'owe and $avel 2emliansky. p. cm. 3ncludes bibliographical references and index. 3"45 978-1-60235-.8<-4 /pbk. alk. paper) -- 3"45 978-1-60235-185-1 /adobe ebook0 1. &ollege readers. 2. =nglish language-->hetoric. 3. 'owe, &harles, 1965- 33. 2emliansky, $avel. $=1417.!735 2010 8-8?.0427--dc22 2010019487 Why Blog? Searching for Writing on the Web Alex Reid As Malcolm Gladwell and others have observed, it takes some 10,000 hours of dedication to a craft or profession to become an “expert.”* Obviously this is a generalization that provokes as many questions as it answers, but the fairly self-evident bottom-line point here is that becoming good at anything worth becoming good at takes a lot of time. -
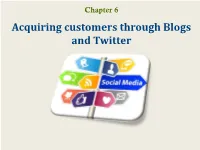
Acquiring Customers Through Blogs and Twitter Objectives
Chapter 6 Acquiring customers through Blogs and Twitter Objectives • After going through this chapter, you will be able to understand: – How to use Blogs and Twitter for marketing – Advantages of using micro blogging – Discuss the process of leveraging Twitter to enhance business growth Introduction • A blog is a discussion or informational site published on the World Wide Web and consisting of discrete entries typically displayed in reverse chronological order • The rise of Twitter and other "microblogging" systems helps integrate MABs and single-author blogs into societal new streams. • Blog can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog. Introduction • A majority of blogs are interactive; allowing visitors to leave comments and even message each other via GUI widgets on the blogs, and it is this interactivity that distinguishes them from other static websites. • A typical blog combines text, images, and links to other blogs, Web pages, and other media related to its topic. Background and history • The term "weblog" was coined by Jorn Barger on 17 December 1997. • The short form, "blog", was coined by Peter Merholz, who jokingly broke the word weblog into the phrase we blog in the sidebar of his blog Peterme.com in April or May 1999. • Shortly thereafter, Evan Williams at Pyra Labs used "blog" as both a noun and verb and devised the term "blogger" in connection with Pyra Labs' Blogger product, leading to the popularization of the terms. Background and history • Origins – Before blogging became popular, digital communities took many forms, including Usenet, commercial online services such as GEnie, BiX and the early CompuServe, e- mail lists and Bulletin Board Systems (BBS). -

The Blogosphere and Political News in Nigeria: a Content Study of the Contributions of Linda Ikeji’S Blog to the Journaling of the 2015 Presidential Election Results
RESEARCH ASSOCIATION for RAIS INTERDISCIPLINARY OCTOBER 2017 STUDIES The Blogosphere and Political News in Nigeria: A Content Study of the Contributions of Linda Ikeji’s Blog to the Journaling of the 2015 Presidential Election Results Boniface Nkem Anusiem PhD & Master student, Seton Hall University, New Jersey, USA [email protected] ABSTRACT: The 2015 Elections in Nigeria is one of the most significant events in Nigerian history; at least in the recent past. Nigerians were highly disposed to the electioneering process by their active participation especially through the platforms provided by the social media. Hence, various social media outlets formulated dependable avenues for the sharing of news items connected with the elections. Among the numerous blogs that excelled in journaling the election is Linda Ikeji’s blog; a popular blog site in Nigeria. This exposition focuses on the contributions of Linda Ikeji’s blog in the dissemination the news of the elections results. The study adopts a content analysis approach to analyze the readership of the blog within election period. The subsequent feedback from the content research aids the researcher to gauge the contributions of Linda Ikeji blog in political news journaling during the 2015 General Elections in Nigeria. KEY WORDS: Lind Ikeji Blog, Social Media, 2015 Elections, Political News. 1. Introduction According to the Nigerian National Broadband Plan (Presidential Committee on Broadband 2014), mobile internet penetration reached the rate of 32.9% in 2013. 80 ANUSIEM: The Blogosphere and Political News in Nigeria Leveraging on the mobile internet, social media and social networking gradually took the communication landscape by storm and rendered most Nigerians who are now netizens to develop conscious and unconscious political antennae and thus become opinion builders in the political agora. -

Blogging for Engines
BLOGGING FOR ENGINES Blogs under the Influence of Software-Engine Relations Name: Anne Helmond Student number: 0449458 E-mail: [email protected] Blog: http://www.annehelmond.nl Date: January 28, 2008 Supervisor: Geert Lovink Secondary reader: Richard Rogers Institution: University of Amsterdam Department: Media Studies (New Media) Keywords Blog Software, Blog Engines, Blogosphere, Software Studies, WordPress Summary This thesis proposes to add the study of software-engine relations to the emerging field of software studies, which may open up a new avenue in the field by accounting for the increasing entanglement of the engines with software thus further shaping the field. The increasingly symbiotic relationship between the blogger, blog software and blog engines needs to be addressed in order to be able to describe a current account of blogging. The daily blogging routine shows that it is undesirable to exclude the engines from research on the phenomenon of blogs. The practice of blogging cannot be isolated from the software blogs are created with and the engines that index blogs and construct a searchable blogosphere. The software-engine relations should be studied together as they are co-constructed. In order to describe the software-engine relations the most prevailing standalone blog software, WordPress, has been used for a period of over seventeen months. By looking into the underlying standards and protocols of the canonical features of the blog it becomes clear how the blog software disperses and syndicates the blog and connects it to the engines. Blog standards have also enable the engines to construct a blogosphere in which the bloggers are subject to a software-engine regime. -

Blogs in Education Kevin Curran and David Marshall School of Computing and Intelligent Systems, Faculty of Engineering, University of Ulster
3515 Kevin Curran et al./ Elixir Adv. Engg. Info. 36 (2011) 3515-3518 Available online at www.elixirjournal.org Advanced Engineering Informatics Elixir Adv. Engg. Info. 36 (2011) 3515 -3518 Blogs in education Kevin Curran and David Marshall School of Computing and Intelligent Systems, Faculty of Engineering, University of Ulster. ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Educational blogs are used to allow educators to interact with students from any location. Received: 18 May 2011; Teachers sharing ideas through blogs is a promising way to communicate teaching ideas and Received in revised form: allows multicultural teaching methods to be disseminated. The blogs that tell the educator 8 July 2011; how to use technology within the classroom are informative as many teachers would have no Accepted: 18 July 2011; idea about such teaching methods. Research based blogs allow users to see different educational topics discussed in more depth. This paper provides an overview of the impact Keywords blogs are having in an educational context. Educational blogs, © 2011 Elixir All rights reserved. Classroom, Teachers. Introduction Xanga, started in 1996, had only 100 diaries by 1997, and over A blog is a website that is maintained by an individual or 50,000,000 in December 2005. It was the launch of Open group with regular updates of information; this information Diaries in 1998 that helped blogging become more popular, as could include diary entries, descriptions of events or in this case this was the first blog community where readers could add educational material. In most blogs readers can supply comments to other writers' blog entries. -
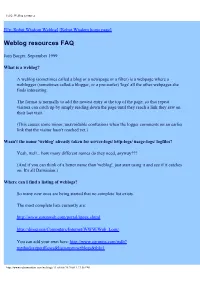
Weblog Resources
FAQ: Weblog resources [Up: Robot Wisdom Weblog] [Robot Wisdom home page] Weblog resources FAQ Jorn Barger, September 1999 What is a weblog? A weblog (sometimes called a blog or a newspage or a filter) is a webpage where a weblogger (sometimes called a blogger, or a pre-surfer) 'logs' all the other webpages she finds interesting. The format is normally to add the newest entry at the top of the page, so that repeat visitors can catch up by simply reading down the page until they reach a link they saw on their last visit. (This causes some minor, unavoidable confusions when the logger comments on an earlier link that the visitor hasn't reached yet.) Wasn't the name 'weblog' already taken for server-logs/ http-logs/ usage-logs/ logfiles? Yeah, well... how many different names do they need, anyway??? (And if you can think of a better name than 'weblog', just start using it and see if it catches on. It's all Darwinian.) Where can I find a listing of weblogs? So many new ones are being started that no complete list exists. The most complete lists currently are: http://www.eatonweb.com/portal/index.shtml http://dmoz.org/Computers/Internet/WWW/Web_Logs/ You can add your own here: http://www.egroups.com/wdb? method=reportRows&listname=weblogs&tbl=1 http://www.robotwisdom.com/weblogs/ (1 of 8)6/20/2005 1:27:56 PM FAQ: Weblog resources Ranked by how often they're linked from other sites: http://beebo.org/metalog/ratings/ Which ones have updated most recently: http://www.linkwatcher.com/ and http:// subhonker2.userland.com/weblogMonitor/ A utility that creates a custom surfmenu of weblogs. -

Bridging the Gap: a Genre Analysis of Weblogs
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences - 2004 Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs Susan C. Herring Lois Ann Scheidt Sabrina Bonus Elijah Wright School of Library and Information Science Indiana University, Bloomington {herring,lscheidt,sbonus,ellwrigh}@indiana.edu Abstract online activity has been increasing exponentially, enabled by the release of the first free blogging Weblogs (blogs)—frequently modified web pages in software (Pitas), and fueled by reports from the which dated entries are listed in reverse chronological mainstream media of the grassroots power of blogs as sequence—are the latest genre of Internet alternative news sources, especially in the aftermath communication to attain widespread popularity, yet of 9/11/01 and during the U.S.-led invasion of Iraq. their characteristics have not been systematically Current estimates place the number of sites calling described. This paper presents the results of a content themselves blogs at over 1.3 million [1], of which analysis of 203 randomly-selected weblogs, comparing about 870,000 are actively maintained. Moreover, as the empirically observable features of the corpus with blogging software becomes easier to use, the number popular claims about the nature of weblogs, and of bloggers continues to increase. In the several finding them to differ in a number of respects. Notably, months during spring 2003 in which we conducted blog authors, journalists and scholars alike exaggerate the research for the present paper, the number of the extent to which blogs are interlinked, interactive, publicly available blogs more than doubled. and oriented towards external events, and under- As with other Internet communication protocols estimate the importance of blogs as individualistic, that have blossomed into seemingly sudden, intense intimate forms of self-expression. -

Between Form and Function
Cultural Studies Review volume 18 number 1 March 2012 http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/index pp. 59–85 Laurie Johnson 2012 Between Form and Function History and Identity in the Blogosphere LAURIE JOHNSON UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND ‘Blogs are fast becoming’ is an apt start to any essay on the blogosphere, since blogs have indeed been fast becoming a good many things in recent years. In their attempt to survey the uses toward which blogs were being deployed less than a decade after the first blog went live, Axel Bruns and Joanne Jacobs noted in 2006 the incredibly diverse ways in which blogs had come to serve purposes beyond the intentions of individual bloggers: alternative news source that is seriously challenging mainstream media; powerful marketing tool for big businesses; essential election campaign strategy; and so on.1 Indeed, Bruns has elsewhere coined the term ‘produsage’ as a replacement for ‘production’ in coming to grips with the challenge of how to think of the process by which individuals can participate in blog culture when blogs appear to have become so readily co-opted by an industrial production model.2 ‘Produsage’ thus names the activities of those ‘communities which engage in the collaborative creation and extension of information and knowledge.’3 This concept of ‘produsage’ represents an elegant solution to the problem of establishing a robust conceptual framework for understanding a phenomenon that has gone viral, in a cultural sense. The growth of the blogosphere has been such that even Technorati have ceased to offer reliable data on the numbers of blogs currently available, but estimates put the number of active blogs in 2010 in excess of 200 ISSN 1837-8692 million.4 This is from an on-line format that has been with us for little more than a decade. -

Corporate Blogging and Microblogging: an Analysis of Dialogue, Interactivity and Engagement in Organisation-Public Communication Through Social Media
Corporate blogging and microblogging: An analysis of dialogue, interactivity and engagement in organisation-public communication through social media Melanie King University of Technology, Sydney (UTS) PhD thesis in Public Communication, Faculty of Arts and Social Sciences (FASS) 2014 i Melanie King Corporate Blogging and Microblogging PhD Thesis 2014-5 Certificate of original authorship I certify that the work for this thesis has not been previously submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text. I also certify that the thesis has been written by me. Any help I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis. Signature: Date: 5 November 2014 ii Melanie King Corporate Blogging and Microblogging PhD Thesis 2014-5 Acknowledgments I’d like to acknowledge the help and guidance of my supervisor, Professor Jim Macnamara of UTS. Without the assistance and participation of the interviewees, this study would not have taken place. I’d like to thank them all for their time and effort: Rachel Beany Stephen Bradley Danielle Clarke Tim Clark Niki Epstein Nathan Freitas Susan Galer Angela Graham Ameel Khan Gareth Llewellyn Samantha Locke Frank Mantero Mat Medcalf Scott Monty Andrew Murrell Dana Ridge Leon Traazil Daniel John Young Sam Zivot And the 3 participants who chose to be unidentified Lastly, I’d like to acknowledge my husband, Serge Lacroix, and children, Jordan King-Lacroix and Justin King-Lacroix, without whose support I never could have embarked on this journey. -

Chapter 6:Acquiring Customers Through Blogs and Twitter
Chapter 6:Acquiring customers through Blogs and Twitter In this chapter, we have discussed about how to acquire customers through Blogs and Twitter. A blog is a discussion or informational site published on the World Wide Web and consisting of discrete entries typically displayed in reverse chronological order (the most recent post appears first). Until 2009 blogs were usually the work of a single individual, occasionally of a small group, and often covered a single subject. More recently "multi-author blogs" (MABs) have developed, with posts written by large numbers of authors and professionally edited. MABs from newspapers, other media outlets, universities, think tanks, advocacy groups and similar institutions account for an increasing quantity of blog traffic. The rise of Twitter and other "microblogging" systems helps integrate MABs and single-author blogs into societal new streams. Blog can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog. The emergence and growth of blogs in the late 1990s coincided with the advent of web publishing tools that facilitated the posting of content by non-technical users. The term "weblog" was coined by Jorn Barger on 17 December 1997. The short form, "blog", was coined by Peter Merholz, who jokingly broke the word weblog into the phrase we blog in the sidebar of his blog Peterme.com in April or May 1999. Shortly thereafter, Evan Williams at Pyra Labs used "blog" as both a noun and verb ("to blog", meaning "to edit one's weblog or to post to one's weblog") and devised the term "blogger" in connection with Pyra Labs' Blogger product, leading to the popularization of the terms.