Morgen Kann Warten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Horse Boy Method 1 - Workbook
Horse Boy Method 1 - Workbook Horse Boy Method 1 Intro Workshop 1 | Page Last Updated 2014‐ 06‐ 11 © 2013 All rights reserved, Horse Boy LLC Horse Boy Method 1 - Workbook Table of Contents Live course Overview ................................................................................................................................................. 4 Online course Overview ............................................................................................................................................ 4 Introduction ............................................................................................................................................................... 5 1. Theory ................................................................................................................................................................ 6 1‐0 Theory: The Horse Boy Story – How it began ............................................................................................ 6 1.1 Theory: Environment, Sensory, Back‐Riding ................................................................................................... 6 1.1 Theory: Rule based Games/Theory of Mind, Academics & Self‐Advocacy ..................................................... 8 1.2 Theory: Ethics! ................................................................................................................................................. 8 2. Environment ..................................................................................................................................................... -

Twice-Exceptional Newsletter July/August, 2016 for Parents, Teachers, and Professionals
TM Twice-Exceptional Newsletter July/August, 2016 For parents, teachers, and professionals. Issue 77 Helping twice-exceptional children reach their potential. 2e Our focus for this issue — Authentic learning for 2e students Improvisational Play: Social/ Most importantly, improvisational play provides 2e Page perfectionists with a nurturing and safe learning envi- 3 Emotional Learning for 2e Students ronment for taking risks, experiencing missteps, and By Pat Sciortino, M.S. developing recovery skills vital to moving beyond any Quote challenges they may encounter. If I could do only one thing to help twice- exceptional students The Talent Development “They need a place where they can be themselves Page and be accepted. Here they have the opportunity to on their journeys, it 7 Cooperative indulge in creative thinking and admire each other for would be to identify it.” — Melissa Sornik and develop their tal- By Linda C. Neumann ents. It is their talents that will provide them a pathway to success in life. It is through 2e-Friendly School: Conservatory Conservatory Prep opened in Davie, Florida, in 2006 Page and graduated its first class in 2009. “In the beginning the rigors of talent 9 Prep years,” says founder Wendy Weiner, “it was really an development that By J. Mark Bade arts integration school. We felt we were going to use they will become self- the arts as the basis or part of the methodology for regulated and goal- learning, and we still do.” directed. It is through talent that they will Also Inside develop positive iden- From the Publishers .................................................................................................................................................................................................. 2 tities and like-minded Introduction to Social Thinking ............................................................................................................................................................................... -
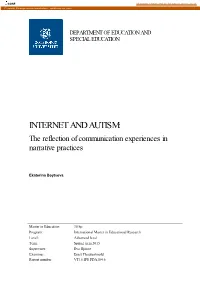
INTERNET and AUTISM: the Reflection of Communication Experiences in Narrative Practices
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv DEPARTMENT OF EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION INTERNET AND AUTISM: The reflection of communication experiences in narrative practices Ekaterina Boytsova Master in Education: 30 hp Program: International Master in Educational Research Level: Advanced level Term: Spring term 2015 Superviser: Eva Hjörne Examiner: Ernst Thoutenhoofd Report number: VT15 IPS PDA184:6 Acknowledgements I would like to express my gratitude to all the respondents who devoted their time to take part in this study. I would also like to thank my supervisor Eva Hjörne at the Department of Education and Special Education at the University of Gothenburg for her inspiring approach and valuable comments. Gothenburg, May 19, 2015. Abstract. Background: Perspectives of Internet use among students with ASD are not a clearly investigated field although positive results in mainstream schools are already received. Multiple pieces of research have shown that computer technology facilitates a broader range of educational activities to meet a variety of needs for students with mild learning disorders, and adaptive technology can enable students with severe disabilities to become active learners in the classroom alongside their peers who do not have disabilities. The aim of this study is to understand and describe representation and perception of online communication by persons with ASD via their postings in blogs and online survey. The role of Internet, the importance of ICT in education and the relation between online and offline communication are in the focus of the study. Although the use of technologies in education and everyday routines is not wide-spread due to high costs and teachers’ lack of training in applying modern technologies in the classroom, the results of this study reveal the importance of applying ICT in everyday life for people with autism. -

Fil-B /Advisory Committee Co
Reading Comprehension Strategies In Children With High- Functioning Autism: A Social Constructivist Perspective Item Type Thesis Authors Cotter, June Ann Download date 26/09/2021 17:04:41 Link to Item http://hdl.handle.net/11122/9075 READING COMPREHENSION STRATEGIES IN CHILDREN WITH HIGH FUNCTIONING AUTISM: A SOCIAL CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE By June Ann Cotter RECOMMENDED: £> P \ - I V v^jQ JL-V% lh -i> Advisory Committee Chair a . fil-b /Advisory Committee Co Chair, Department of Communication APPROVED: Dean, College of Liberal Arts / r Dean of the Graduate School Date READING COMPREHENSION STRATEGIES IN CHILDREN WITH HIGH- FUNCTIONING AUTISM: A SOCIAL CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE A DISSERTATION Presented to the Faculty of the University of Alaska Fairbanks in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By June Ann Cotter, MSEd. Fairbanks, Alaska May 2011 © 2011 June Ann Cotter UMI Number: 3463936 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMT Dissertation Publishing UMI 3463936 Copyright 2011 by ProQuest LLC. All rights reserved. This edition of the work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. uestA ® ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract Individuals with autism see the world, by definition of the diagnosis, in a very different way than the typical student. -

Pausing Encounters with Autism and Its Unruly Representation: an Inquiry Into Method, Culture and Academia in the Making of Disability and Difference in Canada
Pausing Encounters with Autism and Its Unruly Representation: An inquiry into method, culture and academia in the making of disability and difference in Canada A dissertation submitted to the Committee of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts and Science. TRENT UNIVERSITY Peterborough, Ontario, Canada Copyright by John Edward Marris 2013 Canadian Studies Ph.D. Graduate Program January 2014 ABSTRACT Pausing Encounters with Autism and Its Unruly Representation: An inquiry into method, culture and academia in the making of disability and difference in Canada John Edward Marris This dissertation seeks to explore and understand how autism, asperger and the autistic spectrum is represented in Canadian culture. Acknowledging the role of films, television, literature and print media in the construction of autism in the consciousness of the Canadian public, this project seeks to critique representations of autism on the grounds that these representations have an ethical responsibility to autistic individuals and those who share their lives. This project raises questions about how autism is constructed in formal and popular texts; explores retrospective diagnosis and labelling in biography and fiction; questions the use of autism and Asperger’s as metaphor for contemporary technology culture; examines autistic characterization in fiction; and argues that representations of autism need to be hospitable to autistic culture and difference. In carrying out this critique this project proposes and enacts a new interdisciplinary methodology for academic disability study that brings the academic researcher in contact with the perspectives of non-academic audiences working in the same subject area, and practices this approach through an unconventional focus group collaboration. -

Communication Shutdown’ Launched to Engage Social Media Users to Shut Their Networks for a Day on Nov 1 2010, in Support of a Good Cause
4.5 Billion Social Media Users worldwide & over 33 million social media users in India to support the cause of Autism ‘Communication Shutdown’ launched to engage social media users to shut their networks for a day on Nov 1 2010, in support of a good cause New Delhi, October 4, 2010‐ One day without Social Networking‐ Can you brave it? On Nov 1, 2010, citizens around the world will become part of, ‘Communication Shutdown’, a global initiative extended across 40 countries to create awareness and raise funds for charity for Autism. Through this initiative, people around the world have been challenged to go without Facebook or Twitter, for one day. Social communication is one of the biggest challenges for people with autism. By choosing to shutdown their social networks for one day, users will have some idea of what it’s like for people with autism who face this challenge every day. The Communication Shutdown campaign encourages Facebook and Twitter users to make a donation and receive a charity app or (CHAPP) that will signal their support and intention to boycott their social networking accounts on 1 November. ComScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), has released a August 2010 report on traffic to Social Networking sites in India, revealing that India has over 33 million social network users and globally more than two thirds of the world’s population stay connected through networks like Facebook and Twitter. As people become more reliant on these channels to communicate worldwide, the Communication Shutdown fundraising campaign will also serve as a social experiment on social media habits. -
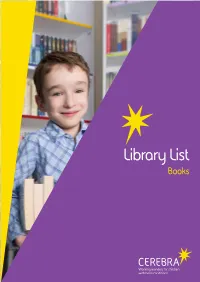
Name of Guide Library List
NameLibrary of guide List A Guide for ParentsBooks Working wonders for children with brain conditions Families where a child has a brain condition face challenges every day. Just to learn, play, make friends and experience the world can feel difficult, even impossible. But we don’t believe there’s any challenge that can’t be overcome. So we listen to families, we learn from them. We carry out research, we design and innovate, we make and share. From new equipment to new learning resources, to new ways to play and support each other, everything we find out together makes life better,better. It opens doors to discovering the world. It’s an incredibly rewarding journey for everyone involved. Why not be a part of it? You never know what we’ll discover together. www.cerebra.org.uk Our guides for parents help you find the answers you need. You can view and download the full series of our guides and factsheets completely free from our website www.cerebra.org.uk. If you would like to make a donation to help cover the cost of producing our guides give us a call on 01267 244216 or donate at www.cerebra.org.uk/fundraise/donate. Thank you. Contents How the Postal Lending Library Works 4 Acquired Brain Injury, Brain Tumour and Stroke 5 ADHD and ADD 6 Autism including Aspergers Syndrome (explaining autism) 7 Autism including Asperger Syndrome (living with autism) 10 Behaviour 14 Carers and Respite Care 16 Cerebral Palsy 17 Communication, Speech and Language 18 Down Syndrome 20 Education Teaching and Learning (general education) 21 Education Teaching -

Temple Grandin Professeure De Zootechnie Et De Sciences Animales
TEMPLE GRANDIN PROFESSEURE DE ZOOTECHNIE ET DE SCIENCES ANIMALES Mary Temple Grandin, dite Temple Grandin, née le 29 août 1947 à Boston, est une femme autiste, professeure de zootechnie et de sciences animales à l'université d'État du Colorado, docteure et spécialiste de renommée internationale dans cette même discipline. Elle monte en 1980 une entreprise d’ingénierie et de conseils sur les conditions d'élevage des animaux de rente, qui fait d’elle une experte en conception d'équipements pour le bétail. En 2012, près de la moitié des abattoirs à bovins d'Amérique du Nord sont équipés du matériel qu'elle a conçu ; depuis les années 1980 jusqu'en 2016, elle a collaboré à environ 200 articles de recherche. Temple Grandin a été diagnostiquée avec des « dommages cérébraux » à l'âge de deux ans, et n'a pas parlé avant l'âge de trois ans et demi. Une intervention précoce lui a permis de progresser, de suivre sa scolarité jusqu'en doctorat, puis de vivre de son métier. Elle est également connue pour être la première personne autiste à avoir témoigné de son expérience de vie dans des autobiographies, Ma vie d'autiste en 1986 et Penser en images en 1995. Elle fait régulièrement appel à des techniques de scanographie, qui ont révélé le fonctionnement et la structure particulière de son cerveau spécialisé dans la pensée visuelle, une recherche publiée dans l'ouvrage Dans le cerveau des autistes, en 2013. Elle s’implique pour la défense du bien-être animal, plaidant pour une meilleure prise en compte de la souffrance animale pendant l'élevage et l'abattage, s’opposant en particulier à l'élevage en batterie. -

Autism, Humanity and Personhood: a Theological
AUTISM , HUMANITY AND PERSONHOOD : A THEOLOGICAL PERSPECTIVE Jennifer Anne Cox BSc; GradDipEd; BTh; BTheol (hons) This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy 2015 1 I declare that this thesis is my own account of my research and contains as its main content work which has not previously been submitted for a degree at any tertiary education institution. ………………………………………………….. Jennifer Anne Cox 2 Abstract Theological anthropology is charged with providing an understanding of the human. But theological anthropology can exclude people who are cognitively impaired because it has historically upheld reason as the image of God. Recent theology of intellectual disability has bypassed this difficulty by emphasising relationality as the image of God. This approach, however, has the unfortunate consequence that it excludes people with severe low- functioning autism, who do not relate to others as persons but as objects. This thesis aims to articulate a theological anthropology which is inclusive of people with severe autism. Autism is a pervasive developmental disorder, the main characteristic of which is difficulty in social interaction. An examination of the Genesis creation story reveals both that God is relational and that human beings were created to live in relationship with God and other humans. This raises the theological question of how we may understand people with severe autism as human persons. Through an investigation of the significance of the incarnation I argue that the best basis for an inclusive anthropology, not dependent on any characteristic or ability, is the vicarious humanity of Christ. This is because Jesus Christ is the only human being who is without sin and the only true image of God. -

Chapter 3 Neurodevelopmental Disorders
M03_GURA9675_01_SE_C03.indd Page 112 7/7/15 1:39 PM user /207/PHC00095/9780132879675_GURAL/GURAL_A_CHILD_AND_YOUTH_CARE_APPROACH_TO_ABNORM ... Chapter 3 Neurodevelopmental Disorders Dubova/Fotolia Neurodevelopmental disorders are associated with behaviours that are observed early in development and create significant impairments in the ability to achieve expected developmental milestones. Case Example: Jason Jason is a creative, highly intelligent 16-year-old who’s to be alone. He knows he’s different from other kids, and recently been diagnosed at the Manitoba Adolescent although that makes him feel upset, he has no interest in Treatment Centre (MATC) with a Generalized Anxiety Dis- making friends. Jason’s anxiety is now also causing him order. At the age of seven he was also diagnosed with extreme distress in exam situations and when doing home- Asperger’s syndrome. When the CYCP met with Jason, he work. Because he’s entirely focused on getting good told her that he had no friends at school, and that he was grades, he’s tending to obsess and perseverate about feeling nervous and anxious almost all the time. He said assignments as well. When he’s not studying, he usually that he still really liked the academic “parts” of school, spends his leisure time playing video games. There has particularly his math and science courses. Jason’s mother been a referral back to MATC for a psychiatric assessment, verifies that Jason is becoming increasingly anxious in all since the level of anxiety Jason is experiencing is signifi- social situations. Jason also told the CYCP that he prefers cantly disrupting his daily functioning. -

The Politics of Autism
The Politics of Autism The Politics of Autism Bryna Siegel, PhD 1 1 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and certain other countries. Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America. © Oxford University Press 2018 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by license, or under terms agreed with the appropriate reproduction rights organization. Inquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above. You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Siegel, Bryna, author. Title: The politics of autism / by Bryna Siegel. Description: New York, NY : Oxford University Press, [2018] | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2017053462 | ISBN 9780199360994 (alk. paper) Subjects: LCSH: Autism—Epidemiology—Government policy—United States. | Autism—Diagnosis—United States. | Autistic people—Education—United States. Classification: LCC RC553.A88 S536 2018 | DDC 362.196/8588200973—dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2017053462 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed by Sheridan Books, Inc., United States of America For David CONTENTS Preface ix Introduction xi 1. -

In Childhood
In childhood About Autism 1 Developed by Parent to Parent NZ Inc for its Care Matters services. www.parent2parent.org.nz • www.carematters.org.nz © Parent to Parent NZ July 2021 This publication is reviewed annually. Kia ora If you are reading this, it is likely a child in your care has just received a diagnosis of autism spectrum disorder (ASD), commonly known as autism. We’ve compiled this booklet with input from autistic people, parents and professionals to provide you with information about autism and how it can affect children’s experience of the world around them. It has been designed as a practical tool to educate and empower you and your family. This document is a general overview current at the time of writing. This information has been provided for education/information purposes only. It is not intended or implied to be a substitute for advice, diagnosis or treatment from registered health professionals. Every care has been taken to ensure its accuracy. If you have any questions or would like further information please contact Parent to Parent on 0508 236 236 or email [email protected] In this booklet we use identity first language. Identity first language is preferred by the autistic community as it celebrates the unique strengths and identity that being autistic offers an individual. Not all autistic people choose to be referred to in the same way. If you are unsure, ask the individual what they would prefer. Contents 6 What is autism? 8 What does autism look like? 10 The senses and autism 12 Strengths and abilities in autism 16 Common difficulties 17 Causes and prevalence 18 Diagnosis 19 Disclosing the diagnosis 22 So we have a diagnosis, where to from here? 24 Therapies and supports 26 Positive behaviour support and techniques 29 Communication supports 30 Alternative and augmentative communication tools 31 Visual supports 34 Autistic behaviour 36 Strategies at home What is autism? Autism affects communication and social interaction as well as thinking and behaviour.