Das X Window System Grafik Für UNIX
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Porting a Window Manager from Xlib to XCB
Porting a Window Manager from Xlib to XCB Arnaud Fontaine (08090091) 16 May 2008 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version pub- lished by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Contents List of figures i List of listings ii Introduction 1 1 Backgrounds and Motivations 2 2 X Window System (X11) 6 2.1 Introduction . .6 2.2 History . .6 2.3 X Window Protocol . .7 2.3.1 Introduction . .7 2.3.2 Protocol overview . .8 2.3.3 Identifiers of resources . 10 2.3.4 Atoms . 10 2.3.5 Windows . 12 2.3.6 Pixmaps . 14 2.3.7 Events . 14 2.3.8 Keyboard and pointer . 15 2.3.9 Extensions . 17 2.4 X protocol client libraries . 18 2.4.1 Xlib . 18 2.4.1.1 Introduction . 18 2.4.1.2 Data types and functions . 18 2.4.1.3 Pros . 19 2.4.1.4 Cons . 19 2.4.1.5 Example . 20 2.4.2 XCB . 20 2.4.2.1 Introduction . 20 2.4.2.2 Data types and functions . 21 2.4.2.3 xcb-util library . 22 2.4.2.4 Pros . 22 2.4.2.5 Cons . 23 2.4.2.6 Example . 23 2.4.3 Xlib/XCB round-trip performance comparison . -

Qtile Documentation Release 0.15.1
Qtile Documentation Release 0.15.1 Aldo Cortesi Apr 14, 2020 Contents 1 Getting started 1 1.1 Installing Qtile..............................................1 1.2 Configuration...............................................5 2 Commands and scripting 25 2.1 Commands API............................................. 25 2.2 Scripting................................................. 28 2.3 qshell................................................... 28 2.4 iqshell.................................................. 30 2.5 qtile-top.................................................. 31 2.6 qtile-run................................................. 31 2.7 qtile-cmd................................................. 31 2.8 dqtile-cmd................................................ 34 3 Getting involved 37 3.1 Contributing............................................... 37 3.2 Hacking on Qtile............................................. 38 4 Miscellaneous 43 4.1 Reference................................................. 43 4.2 Frequently Asked Questions....................................... 107 4.3 License.................................................. 108 Index 109 i ii CHAPTER 1 Getting started 1.1 Installing Qtile 1.1.1 Distro Guides Below are the preferred installation methods for specific distros. If you are running something else, please see In- stalling From Source. Installing on Arch Linux Stable versions of Qtile are currently packaged for Arch Linux. To install this package, run: pacman -S qtile Please see the ArchWiki for more information on -

SUSE® Linux Enterprise Desktop 12 and the Workstation Extension: What's New ?
SUSE® Linux Enterprise Desktop 12 and the Workstation Extension: What's New ? Frédéric Crozat <[email protected]> Enterprise Desktop Release Manager Scott Reeves <[email protected]> Enterprise Desktop Development Manager Agenda • Design Criteria • Desktop Environment in SUSE Linux Enterprise 12 • GNOME Shell • Desktop Features and Applications 2 Design Criteria SUSE Linux Enterprise Desktop Interoperability Ease of Use Security Ease of Management Lower Costs 4 SUSE Linux Enterprise Desktop 12 • Focus on technical workstation ‒ Developers and System administrators • One tool for the job • Main desktop applications will be shipped: ‒ Mail client, Office Suite, Graphical Editors, ... • SUSE Linux Enterprise Workstation Extension ‒ Extend SUSE Linux Enterprise Server with packages only available on SUSE Linux Enterprise Desktop. (x86-64 only) 5 Desktop in SUSE Linux Enterprise 12 As Part of the Common Code Base SUSE Linux Enterprise 12 Desktop Environment • SUSE Linux Enterprise 12 contains one primary desktop environment • Additional light-weight environment for special use-cases: ‒ Integrated Systems • Desktop environment is shared between the server and desktop products 7 SUSE Linux Enterprise 12 Desktop Environment • GNOME 3 is the main desktop environment ‒ SLE Classic mode by default ‒ GNOME 3 Classic Mode and GNOME 3 Shell Mode also available • SUSE Linux Enterprise 12 ships also lightweight IceWM ‒ Targeted at Integrated Systems • QT fully supported: ‒ QT5 supported for entire SLE12 lifecycle ‒ QT4 supported, will be removed in future -

Release Notes for X11R7.5 the X.Org Foundation 1
Release Notes for X11R7.5 The X.Org Foundation 1 October 2009 These release notes contains information about features and their status in the X.Org Foundation X11R7.5 release. Table of Contents Introduction to the X11R7.5 Release.................................................................................3 Summary of new features in X11R7.5...............................................................................3 Overview of X11R7.5............................................................................................................4 Details of X11R7.5 components..........................................................................................5 Build changes and issues..................................................................................................10 Miscellaneous......................................................................................................................11 Deprecated components and removal plans.................................................................12 Attributions/Acknowledgements/Credits......................................................................13 Introduction to the X11R7.5 Release This release is the sixth modular release of the X Window System. The next full release will be X11R7.6 and is expected in 2010. Unlike X11R1 through X11R6.9, X11R7.x releases are not built from one monolithic source tree, but many individual modules. These modules are distributed as individ- ual source code releases, and each one is released when it is ready, instead -

Qtile Documentation Release 0.6
Qtile Documentation Release 0.6 Aldo Cortesi January 13, 2015 Contents 1 Installing 3 2 Configuration 5 3 Commands and scripting 7 4 Reference 9 5 Miscellaneous 11 5.1 Installing Qtile.............................................. 11 5.2 Installing on Arch Linux......................................... 11 5.3 Installing on Debian........................................... 12 5.4 Installing on Funtoo........................................... 13 5.5 Installing on Gentoo........................................... 16 5.6 Installing from Source.......................................... 17 5.7 Installing on Ubuntu........................................... 18 5.8 Configuration............................................... 18 5.9 Default Configuration.......................................... 19 5.10 Running Inside Gnome.......................................... 20 5.11 Groups.................................................. 21 5.12 Hooks................................................... 22 5.13 Keys................................................... 22 5.14 Layouts.................................................. 23 5.15 Mouse.................................................. 23 5.16 Screens.................................................. 24 5.17 Starting Qtile............................................... 24 5.18 Commands API............................................. 24 5.19 Object Graph............................................... 25 5.20 Keys................................................... 26 5.21 qsh................................................... -
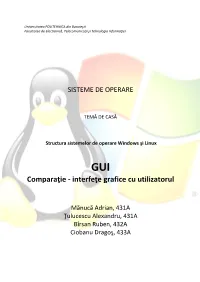
Interfeţe Grafice Cu Utilizatorul
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei SISTEME DE OPERARE TEMĂ DE CASĂ Structura sistemelor de operare Windows şi Linux GUI Comparaţie - interfeţe grafice cu utilizatorul Mănucă Adrian, 431A Ţulucescu Alexandru, 431A Bîrsan Ruben, 432A Ciobanu Dragoş, 433A CUPRINS 1. Introducere. Evoluția interfețelor grafice(GUI). ->Ciobanu Dragoș, 433A - Interfața liniei de comandă(CLI) - Interfața grafică Xerox PARC. WIMP. 2. Interfața grafică la Linux. ->Țulucescu Alexandru, 431A - X Window System . Introducere. Design. Principii. Interfețe cu utilizatorul . Implementări . Compositing Window Manager. Compiz, Beryl. Limitări și critici - XFCE - GNOME . Introducere. Tehnologii. Aplicații și funcționare - KDE . Introducere. Evoluția în timp. KDE 4 3. Interfața grafică la Windows. ->Mănucă Adrian, 431A - Începuturi - Windows API - Tema Luna(stilul Windows XP) - Windows Aero . Windows Presentation Foundation(WPF->.NET Framework 3) . Desktop Window Manager - Interfața Ribbon - Metro(limbaj de design) 4. Comparație interfețe grafice. ->Bârsan Ruben, 432A - Asemănări între Linux și Windows. Deosebiri. - Avantaje. Dezavantaje. - Concluzii. 5. Bibliografie 1 Introducere 1. Introducere Evoluţia interfeţelor grafice (GUI) „Interfața grafică (în engleză: Graphical User Interface sau GUI) este numit sistemul de afișaj grafic-vizual pe un ecran, situat funcțional între utilizator și dispozitive electronice cum ar fi computere, dispozitive personale de tip hand-held (playere MP3, playere media portabile, dispozitive de jucat), aparate electrocasnice și unele echipamente de birou.” [1] Pentru a prezenta toate informațile și acțiunile disponibile, un GUI oferă pictograme și indicatori vizuali, în contrast cu interfețele bazate pe text, care oferă doar nume de comenzi (care trebuie tastate) sau navigația text. „Termenul de GUI este restricţionat la ecrane cu display 2D cu rezoluţii capabile de a descrie informaţia generică, în urma cercetării la PARC(Palo Alto Research Center). -

Qtile Documentation Release 0.15.0
Qtile Documentation Release 0.15.0 Aldo Cortesi Apr 12, 2020 Contents 1 Getting started 1 1.1 Installing Qtile..............................................1 1.2 Configuration...............................................5 2 Commands and scripting 25 2.1 Commands API............................................. 25 2.2 Scripting................................................. 28 2.3 qshell................................................... 28 2.4 iqshell.................................................. 30 2.5 qtile-top.................................................. 31 2.6 qtile-run................................................. 31 2.7 qtile-cmd................................................. 31 2.8 dqtile-cmd................................................ 34 3 Getting involved 37 3.1 Contributing............................................... 37 3.2 Hacking on Qtile............................................. 38 4 Miscellaneous 43 4.1 Reference................................................. 43 4.2 Frequently Asked Questions....................................... 107 4.3 License.................................................. 108 Index 109 i ii CHAPTER 1 Getting started 1.1 Installing Qtile 1.1.1 Distro Guides Below are the preferred installation methods for specific distros. If you are running something else, please see In- stalling From Source. Installing on Arch Linux Stable versions of Qtile are currently packaged for Arch Linux. To install this package, run: pacman -S qtile Please see the ArchWiki for more information on -

Networked Multi-Monitor Why Is It Good Use Any Notebook As a Spare Screen Works Over the Network Wired Or Wireless
Xdmx Networked Multi-monitor Why is it good Use any notebook as a spare screen Works over the network wired or wireless. Re-use old notebooks as extra screens Installation Install the following on the host and client(s) sudo apt-get install xdmx openbox xserver-xephyr xorg ssh xdmx Networked Multi-monitor tool openbox lightweight WM to test with xserver-xephyr nested X server xorg display server ssh secure shell Test locally First step is to test this ability locally Terminal #1 Xephyr :3.0 -ac -br +xinerama -screen 600×400 & Xephyr :4.0 -ac -br +xinerama -screen 600×400 & Xdmx :5 -display :3.0 -display :4.0 +xinerama Terminal #2 export DISPLAY=:5 openbox Test with chromebook Setup host Allow tcp in your desktop manager Add the following to /etc/lightdm/lightdm.conf under [Seat:*] xserver-allow-tcp = True Restart lightdm sudo service lightdm restart Login to XFCE Verify that X is running with 'listen tcp' ps -wax | grep "listen tcp" Login Chromebook 1. Boot & login 2. hit alt+ctrl+t to load crosh tab 3. Enter the shell and start xfce4 shell sudo enter-chroot startxfce4 Setup Chromebook Make sure you chromebook has Linux installed through Crouton Connect to Host from the client ssh -X map7@<HOST IP ADDRESS> Find the remote display echo $DISPLAY Note down the display address (usually localhost:10.0) for use in the Xdmx next. Start Xdmx startx -- /usr/bin/Xdmx :1 +xinerama -display :0.0 -display localhost:10.0 -norender -noglxproxy -ignorebadfontpaths Options explained :1 Use Virtual Screen :1 +xinerama Span the desktop -display :0.0 Use clients display -display :10.0 Use the ssh X display -norender disable RENDER extension -noglxproxy display OpenGL -ignorebadfontpaths Needed if it cannot nd fonts Limits I cannot play videos / anything that uses OpenGL Only certain windows managers work (XFCE works) Little slow over wireless but only for the wireless screens. -

Charon-SSP for Linux – Version 2.0.1 User's Guide
Document number: 55-16-005-001 Charon-SSP for Linux – Version 2.0.1 User’s Guide March 2018 Charon-SSP for Linux Version 2.0.1 – User’s Guide (Version 1) Document number: 55-16-005-001 Contents 1 About This Guide ........................................................................................................................... 11 1.1 Intended Audience ................................................................................................................................. 11 1.2 Document Structure ............................................................................................................................... 12 1.3 Obtaining Documentation ..................................................................................................................... 12 1.4 Obtaining Technical Assistance ........................................................................................................... 12 1.5 Conventions ............................................................................................................................................ 13 2 Introduction .................................................................................................................................... 14 2.1 Supported Virtual Hardware .................................................................................................................. 15 3 Host System Requirements .......................................................................................................... 16 3.1 Hardware Requirements -

Как Настроить Maemo 5(4) SDK И Начать Писат... 06.03.2010
Eugene Rudenko » Blog Archive » Как настроить Maemo 5(4) SDK и начать писат... Page 1 of 10 Comments Site(En,Full) Site(En) Site(Ru,Full) Site(Ru) Log in Eugene RudenkoResearch and development blog of Rudenko Eugene » Как настроить Maemo 5(4) SDK и начать писать приложения под Windows/Linux/MacOS менее чем за полчаса! S February 18th, 2010 by Rudenko Eugene I D z Add Comment E z Trackback B z Comments Feed A R « Уже нет смысла, я думаю, объяснять что такое Maemo и где он работает. Всем понятно, что это Linux, который сейчас работает на таблетках от Nokia и на новом Nokia N900. Но так как проект open-source, то думаю другим производителям ничто не мешает сделать свое устройство под этой платформой (кто знает, может появится HTC или Motorolla на базе Maemo). Речь в этой статье пойдет о том как настроить окружение для разработки для Maemo. Начнем с того, что сейчас существуют два типа SDK – текущий стабильный для Maemo5/4 (Fremantle/Diablo) и новый SDK, который сейчас в бете – MADDE. Ну давайте начнем со стабильного (относительно и спорно, позже покажу почему) и текущего – Fremantle (на момент написания статьи но был “pre-final 2″, теперь в “final”). Он базируется на Diablo и поэтому процесс установки и нструменты те же. И если вам нужен Diablo – инструкция подойдет эта, а далее я буду говорить только о Fremantle, подозревая что по желанию можно использовать Diablo. Хорошо, предположим, что мы выбрали SDK Fremantle (MADDE я посвящу последующие статьи). У этого SDK есть один недостаток – он моно-платформенный. Он работает только под Linux x86 (желательно debian based, но не обязательно). -
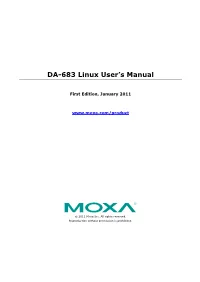
DA-683 Linux User's Manual
DA-683 Linux User’s Manual First Edition, January 2011 www.moxa.com/product © 2011 Moxa Inc. All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited. DA-683 Linux User’s Manual The software described in this manual is furnished under a license agreement and may be used only in accordance with the terms of that agreement. Copyright Notice Copyright ©2011 Moxa Inc. All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited. Trademarks The MOXA logo is a registered trademark of Moxa Inc. All other trademarks or registered marks in this manual belong to their respective manufacturers. Disclaimer Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Moxa. Moxa provides this document as is, without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, its particular purpose. Moxa reserves the right to make improvements and/or changes to this manual, or to the products and/or the programs described in this manual, at any time. Information provided in this manual is intended to be accurate and reliable. However, Moxa assumes no responsibility for its use, or for any infringements on the rights of third parties that may result from its use. This product might include unintentional technical or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein to correct such errors, and these changes are incorporated into new editions of the publication. Technical Support Contact Information www.moxa.com/support Moxa Americas Moxa China (Shanghai office) Toll-free: 1-888-669-2872 Toll-free: 800-820-5036 Tel: +1-714-528-6777 Tel: +86-21-5258-9955 Fax: +1-714-528-6778 Fax: +86-21-5258-5505 Moxa Europe Moxa Asia-Pacific Tel: +49-89-3 70 03 99-0 Tel: +886-2-8919-1230 Fax: +49-89-3 70 03 99-99 Fax: +886-2-8919-1231 Table of Contents 1. -

Symantec Enterprise Security Manager Patch List Symantec Enterprise Security Manager Patch List
Symantec Enterprise Security Manager Patch List Symantec Enterprise Security Manager Patch list The software that is described in this book is furnished under a license agreement and may be used only in accordance with the terms of the agreement. Copyright Notice Copyright © 2008 Symantec Corporation. All Rights Reserved. Any technical documentation that is made available by Symantec Corporation is the copyrighted work of Symantec Corporation and is owned by Symantec Corporation. NO WARRANTY. The technical documentation is being delivered to you AS-IS and Symantec Corporation makes no warranty as to its accuracy or use. Any use of the technical documentation or the information contained therein is at the risk of the user. Documentation may include technical or other inaccuracies or typographical errors. Symantec reserves the right to make changes without prior notice. No part of this publication may be copied without the express written permission of Symantec Corporation, 20330 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014. Trademarks Symantec and the Symantec logo are U.S. registered trademarks, and LiveUpdate, Symantec NetRecon, Symantec Enterprise Security Architecture, Symantec Enterprise Security Manager, and Symantec Security Response are trademarks of Symantec Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, and Windows NT are registered trademarks and Windows Server 2003 is a trademark of Microsoft Corporation. Other product names that are mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged. Printed in the United States of America. 3 Technical support As part of Symantec Security Response, the Symantec Global Technical Support group maintains support centers throughout the world. The Technical Support group’s primary role is to respond to specific questions on product feature/ function, installation, and configuration, as well as to author content for our Web-accessible Knowledge Base.