Bense Max Programmierung D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Interview with Frieder Nake
arts Editorial An Interview with Frieder Nake Glenn W. Smith Space Machines Corporation, 3443 Esplanade Ave., Suite 438, New Orleans, LA 70119, USA; [email protected] Received: 24 May 2019; Accepted: 26 May 2019; Published: 31 May 2019 Abstract: In this interview, mathematician and computer art pioneer Frieder Nake addresses the emergence of the algorithm as central to our understanding of art: just as the craft of computer programming has been irreplaceable for us in appreciating the marvels of the DNA genetic code, so too has computer-generated art—and with the algorithm as its operative principle—forever illuminated its practice by traditional artists. Keywords: algorithm; computer art; emergent phenomenon; Paul Klee; Frieder Nake; neural network; DNN; CNN; GAN 1. Introduction The idea that most art is to some extent algorithmic,1 whether produced by an actual computer or a human artist, may well represent the central theme of the Arts Special Issue “The Machine as Artist (for the 21st Century)” as it has evolved in the light of more than fifteen thoughtful contributions. This, in turn, brings forcibly to mind mathematician, computer scientist, and computer art pioneer Frieder Nake, one of a handful of pioneer artist-theorists who, for more than fifty years, have focused on algorithmic art per se, but who can also speak to the larger role of the algorithm within art. As a graduate student in mathematics at the University of Stuttgart in the mid-1960s (and from which he graduated with a PhD in Probability Theory in 1967), Nake was a core member, along with Siemens mathematician and philosophy graduate student Georg Nees, of the informal “Stuttgart School”, whose leader was philosophy professor Max Bense—one of the first academics to apply information processing principles to aesthetics. -

Agnes C. Mueller Professor of German & Comparative Literature [email protected] (803) 414-0316
Agnes C. Mueller Professor of German & Comparative Literature [email protected] (803) 414-0316 Curriculum Vitae EMPLOYMENT University of South Carolina 2014- Professor of German & Comparative Literature 2015-2020 College of Arts & Sciences Distinguished Professor of the Humanities 2017-2021 Director, Program in Global Studies 2019- Core Faculty, Program in Jewish Studies 2001- Affiliate Faculty, Women’s and Gender Studies 2005-2013 Associate Professor 2001-2005 Assistant Professor 1998-2001 Visiting Assistant Professor University of Georgia 1997-1998 Instructor Vanderbilt University 1994-1997 Teaching Assistant EDUCATION 1997 Vanderbilt University Ph.D. in German Literature Nashville, Tennessee 1993 Ludwig-Maximilians-Universität M.A. in German and Munich, Germany Comparative Literature 1 Agnes C. Mueller ADMINISTRATIVE LEADERSHIP (selection): 2021 Chair, External Review Team (3 members), AQAD Review of Department of Languages, Literatures, and Cultures at R1 University 2017-2021 Director, Program in Global Studies. Directing a new interdisciplinary BA program with nearly 200 majors and 5 different content areas; single-handedly scheduling courses from other units across the university, meeting with students and prospective students and parents, advisement, devising new curriculum, building a core faculty group. Promoting program within university and outside, including devising MoUs with new European and global university partners. Advocating for/hiring of Associate and Assistant Directors (both in place since 2019). Grew program from 18 majors to nearly 200 majors (fall 2019) with modest budget. Directing all outreach and presenting to University Board of Visitors, to South Carolina school district representatives, to alumni, and seeking future donors in collaboration with CAS Development. Devising and scheduling monthly Global Café events (with notables from industry, state department, leaders in health and education). -

Concrete Constructions: Assembling a Postwar Poetics KURT BEALS Washington University in St
Concrete Constructions: Assembling a Postwar Poetics KURT BEALS Washington University in St. Louis Abstract: This essay focuses on the manifestos and theoretical works of Concrete poets—primarily the German-language poets Max Bense and Eugen Gomringer, as well as the Noigandres group—examining their engagement with discourses of postwar modernity, including internationalism, design, and communication and information theory. While the movement’s programmatic texts at times proved unpersuasive or inconsistent, they nonetheless demonstrated a readiness or even eagerness to cross boundaries—both national and disciplinary—and to seek inspiration from scientific and technical fields in an attempt to articulate a new poetics suited to the modern age. Rather than see the movement’s manifestos and theoretical statements as hubristic promises that its poetry could never keep, this essay proposes that we see the poems and the programmatic texts as two parts of the same project, which claimed a place for poetry in a technologically saturated age. Keywords: Max Bense, Eugen Gomringer, design, communication, information In 1965, the German poet, theorist, philosopher, publisher, and professor Max Bense published Brasilianische Intelligenz (Brazilian Intelligence), a short book in which he described the contemporary intellectual and cultural tendencies he had encountered on four visits to Brazil.1 In a brief preface, Bense argued “that the creative, not the contemplative” principle was central to Brazil’s intellectual life; it was “less the idea of (theoretical) separation than that of (practical) absorption” that “directed the existential relations” (Brasilianische 7). This focus 1 For analysis of Bense’s representation of Brazil, see Wolfson; Wrobel. 93 Beals on practical and applied measures rather than abstract principles, particularly in fields such as urban planning, visual art, and Concrete poetry, marked one of the defining features of modern Brazilian culture in Bense’s view. -

Humans Create, Occasionally. Computers Operate, Always. Self-Evident & Trivial
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Dagstuhl Research Online Publication Server Humans Create, Occasionally. Computers Operate, Always. Self-Evident & Trivial Frieder Nake [email protected] This essay is a bit of a grumble. I will try to be subjectively trivial. Not exactly scientific. Some important names will be mentioned. If some readers enjoy reading this, it’s enough from my standpoint. The title exactly says what I want to say. The essay is only longer. In recent years, combinations of terms have become popular where one component is „computational“ or some relative of it, whereas the other is „aesthetics“ or „art“ or „creativity“, etc. The Dagstuhl semi- nar, to which this personal note owes its appearance, had the number 09291 and the title Computational Creativity: an Interdisciplinary Approach. Good old C. P. Snow would probably like such terms as signs of a conscious effort to bridge the gap between the „two cultures“: from the scientific culture (home of „computational“) to the literary („creativity“), and back again1. We have seen computational aesthetics, computer art (the oldest of them all), aesthetic computing, machine aesthetics, creative computation, computational creativity, and more. It is always absolutely boring to ask for a precise definition – a definition, not an explanation2 – of a complex term, in hope of making our ideas clear3, even though philosophers throughout the centuries have tried nothing but exactly this, and not only philosophers did so. How much have we, when we were young, indulged in endless debates about the meaning of a word. -

The Strategy of Equivocation in Adorno's "Der Essay Als Form"
$PELJXLW\,QWHUYHQHV7KH6WUDWHJ\RI(TXLYRFDWLRQ LQ$GRUQR V'HU(VVD\DOV)RUP 6DUDK3RXUFLDX MLN, Volume 122, Number 3, April 2007 (German Issue), pp. 623-646 (Article) 3XEOLVKHGE\-RKQV+RSNLQV8QLYHUVLW\3UHVV DOI: 10.1353/mln.2007.0066 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/mln/summary/v122/122.3pourciau.html Access provided by Princeton University (10 Jun 2015 14:40 GMT) Ambiguity Intervenes: The Strategy of Equivocation in Adorno’s “Der Essay als Form” ❦ Sarah Pourciau “Beziehung ist alles. Und willst du sie näher bei Namen nennen, so ist ihr Name ‘Zweideutigkeit.’” Thomas Mann, Doktor Faustus1 I Adorno’s study of the essay form, published in 1958 as the opening piece of the volume Noten zur Literatur, has long been considered one of the classic discussions of the genre.2 Yet to the earlier investigations of the essay form on which his text both builds and plays, Adorno appears to add little that could be considered truly new. His characterization of the essayistic endeavor borrows heavily and self-consciously from an established tradition of genre exploration that reaches back—despite 1 Thomas Mann, Doktor Faustus: das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde, Gesammelte Werke VI (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974) 63. Mann acknowledges the enormous debt his novel owes to Adorno’s philosophy of music in Die Entstehung des Doktor Faustus; Roman eines Romans (Berlin: Suhrkamp, 1949). Pas- sages stricken by Mann from the published version of the Entstehung are even more explicit on this subject. These passages were later published together with his diaries. -
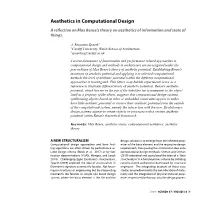
Aesthetics in Computational Design
Aesthetics in Computational Design A reflection on Max Bense’s theory on aesthetics of information and state of things. A. Benjamin Spaeth1 1Cardiff University, Welsh School of Architecture [email protected] Current dominance of functionalist and performance related approaches to computational design and methods in architecture are investigated under the precondition of Max Bense's theory of aesthetic potential. Establishing Bense's taxonomy of aesthetic potential and applying it to selected computational methods the level of aesthetic potential within the different computational approaches is investigated. Frei Otto's soap bubble experiments serve as a reference to illustrate different levels of aesthetic potential. Bense's aesthetic potential, which lies not in the eye of the beholder but is immanent to the object itself as a property of the object, suggests that computational design systems synthesising objects based on rules or embedded constraints appear to either have little aesthetic potential or receive their aesthetic potential form the outside of the computational system, namely the interaction with the user. Evolutionary design systems appear to create objects or processes with a certain aesthetic potential within Bense's theoretical framework. Keywords: Max Bense, aesthetic states, computational aesthetics, aesthetic theory A NEW STRUCTURALISM design solution is to emerge from the inherent prop- Computational design approaches and form find- erties of the basic element and the respective design ing algorithms are often driven by performance re- requirements transposing the structuralist idea onto lated design criteria (Block et al. 2017) or by fab- computational design methods. Oxman and Oxman rication determinations (YUAN, Menges, and Leach (2010) reiterated and postulated the idea of a ‘New 2018). -

Beat Suter Lineages of German-Language Electronic Literature
Beat Suter University of the Arts, Zürich Lineages of German-language electronic literature: the Döhl Line Abstract Pour présenter un aperçu de la littérature électronique en langue allemande, nous avons filtré quelques axes historiques qui peuvent expliquer comment différents genres ont émergé et se sont développés. Les toutes premières expériences de poésie générée par ordinateur constituent un bon point de départ car c'est un sujet sur lequel la communauté internationale s'accorde en général. Nous les avons examinées selon 5 axes de développement actuel : expériences en poésie concrète, écriture collaborative et environnements auteurs, hypertexte de l'hyperfiction à la net littérature, l'art du code, l'écriture des blogs et plus. Une analyse historique montre que ces cinq axes de la littérature numérique sont principalement issus de deux lignées philosophiques, poétiques et artistiques de la culture allemande remontant aux expériences des années 60 : L'école de Stuttgard de Max Bense dans laquelle s'inscrivent Reinhard Döhl et Theo Lutz, et les expériences d'image numérique de Kurd Alsleben et Antje Eske à Hamburg. Cet essai se concentre sur la première qui est également la plus ancienne en langue allemande. Mots clés : littérature électronique en langue allemande, lignes historiques, générateur de poésie électronique, e-littérature en ligne. Abstract In order to present an overview of German language electronic literature, the author of this essay filtered out historical lines that show and explain how the development of individual genres came about. A good starting point for this may be the very first experiments of authors with computers to generate 106 electronic poetry, a subject the international community mostly agrees upon. -

Mainframe Experimentalism
MAINFRAME EXPERIMENTALISM Early Computing and the Foundations of the Digital Arts Edited by Hannah B Higgins and Douglas Kahn Q3 UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley Los Angeles London 4 INFORMATION AESTHETICS AND THE STUTTGART SCHOOL Christoph Kllitsch In the mid-1960s, mainframe computer art emerged from an adventurous en counter among a new information aesthetic, political ideologies, and technical possibilities. In Stuttgart, new computer technology invited speculation about the nature of art, beauty, and mechanical production. Here a new generation of artist-scientists believed the computer would enable them to break with the speculative and subjective approach to making and evaluating art. The main frame Denkmaschirzen1 (thinking machines) offered users the limited computing capacities of the time, forcing the computer artist to program carefully, to use the resources as economically as possible, and, through an extreme economy of means, to break down visual problems into small, elegantly designed pieces. Through an analysis of the early work of a few members of the Stuttgart school, the artistic range of early mainframe computer art, as well as its rigorous theoretical basis, will be discussed. The chronological beginning of the Stuttgart school falls somewhere between December 1964, when an article titled "Statistische Graphik" (Statistical graphic) by Georg Nees appeared in the journal Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft (GrKG; Fundamentals in cybernetics and humanities), and February 5, 1965, when the -

Aesthetics, Semiotics & Design
Prof. Michael Hardt Aesthetics, semiotics & design. 0.1 Preambel … KHiB shall contribute to the fostering of a critical perspective in the general public on art, design and aesthetic values. With a basic in a humanistic tradition, its paramount aims are academic and ethical integrity, freedom of expression and critical reflection. Strategy plan KHiB, Bergen National Academy of the Arts, 2004-2008 Community mandate. 0.2 Aim and objective The profession of Visual Communication Design is facing fundamental changes due to technological and social development. This process implements the need to reconsider the theoretical background and to take an active role in steering those changes. The ongoing development is a global process. It is essential to analyse on international scale and adapt the insights to national and regional requirements. The aim of this paper is to analyse and reconsider the philosophy and theoretical background of Viscom at the Bergen National Academy of the Arts and prepare necessary decisions to further develop the education. 1. Aesthetics What means “aesthetics”? And what is the relation between aesthetics and design? 1 Prof. Michael Hardt 1.1 Definition Aesthetic, philosophy of the arts, gr. αισδεσισ, perception, sensation) philosophical discipline dealing with beauty, its perception and arts. Bibliographical Institut & F.A. Brockhaus AG 2003 1.2 History The term “aesthetics” was introduced in our languages in 1750, when the German philosopher Alexander Gottlieb Baumgarten wrote a book with the title “aesthetica”. Following academic rules of that time he wrote in Latin, using many Greek words. 624 pages in two issues, 904 paragraphs, logically connected. In the first paragraph Baumgarten defined “aesthetica”: “Aeasthetica (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulchre cogitandi, ars analogi rationis,) est scientia cognitionis sensitivae”. -

Martha Schwendener Art and Language in Vilém Flusser's Brazil: Concrete Art and Poetry
FLUSSER STUDIES 30 Martha Schwendener Art and Language in Vilém Flusser’s Brazil: Concrete Art and Poetry In his correspondence with friends and colleagues, Vilém Flusser often complained that he felt exiled to the periphery of culture and intellectual life after migrating from Europe to Brazil in 1940. Paradox- ically, however, he was arriving at a center of innovation that would shape his thinking. Concrete art and poetry flourished in Brazil in the fifties, and Flusser, who had decided that his primary focus would be language, was introduced to these new vernaculars. In particular, the formal layout of Concrete art and poetry, with their rigorous approaches to space, color, and typography, would impact Flusser. “The Gestalt,” he wrote, and “the visual character of writing” in “Concretist experiments are rupturing discursive thought and endowing it with a second dimension of ‘ideas’ which discursive thought cannot supply.”1 These methods served as proto-interfaces or screens, predicting the digital revolution, and offering what poet and theorist Haroldo de Campos called a “new dialogical relationship” with “im- perial” languages, since Concrete art was an international language and Concrete poetry took very little vocabulary to interpret and understand.2 This paper looks at Flusser’s personal engagement with these phenomena and how they informed his concept of “superficial” reading, non-linear “post-historical” thinking, and the idea that philosophy itself would eventually be practiced in images rather than written words. Art in Brazil Brazil was becoming a vital center for visual art in the forties. The Modern Art Week (Semana de Arte Moderna) in São Paolo in February 1922, with a flurry of exhibitions, lectures, poetry readings, and concerts is often seen as a seminal moment for the advent of modern art in Brazil, analogous to the Armory Show in 1913, which introduced European modernism to New York. -
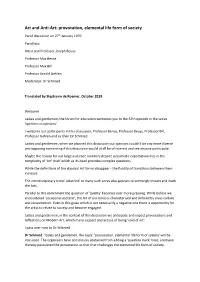
Art and Anti-Art: Provocation, Elemental Life Form of Society
Art and Anti-Art: provocation, elemental life form of society Panel discussion on 27th January 1970 Panellists: Artist and Professor Joseph Beuys Professor Max Bense Professor Max Bill Professor Arnold Gehlen Moderator: Dr Schmied Translated by Stephanie de Roemer, October 2019 Welcome Ladies and gentlemen, the forum for education welcomes you to the 67th episode in the series 'opinions vs opinions'. I welcome our participants in this discussion; Professor Bense, Professor Beuys, Professor Bill, Professor Gehlen and as chair Dr Schmied. Ladies and gentlemen, when we planned this discussion our opinions couldn't be any more diverse and opposing concerning if this discussion would at all be of interest and see anyone participate. Maybe the reason for our large audience numbers despite pessimistic expectations lies in the complexity of 'Art' itself which as its deed provokes complex questions. While the definitions of the classical Art forms disappear - the fluidity of transitions between them increase. The interdisciplinary trend 'attached' to many such areas also appears to seemingly impact and mark the Arts. Parallel to this enrichment the question of 'quality' becomes ever more pressing. While before we encountered 'occasional esoteric', the Art of our times is characterised and defined by mass culture and consumerism. Even in this guise which is not necessarily a negative one there is opportunity for the artist to relate to society and become engaged. Ladies and gentlemen, in the context of this discussion we anticipate and expect provocations and reflections on Modern Art, which many suspect and accuse of being 'void of art'. I pass over now to Dr Schmied Dr Schmied: ‘ladies and gentlemen, the topic: 'provocation, elemental life form of society' will be discussed. -

Ignacio Gómez De Liaño
IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO Forsaking Writing Poema de la destrucción (Poem of Destruction), Pamplona, 1972. Participants: Pedro Almodóvar and Ignacio Gómez de Liaño IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO Forsaking Writing Contents 9 Ignacio Gómez de Liaño: Life as a Poetic Text Lola Hinojosa Donation Ignacio Gómez de Liaño (Selection) 41 Poems and Poetic Works 64 Writings Manifestos Essays on Writing 65 Forsaking Writing (1969) 105 The Writer in the 6 7 ANTIPRO (1979) New Situation (1966) 111 Writings of Imaginary Writings on Cultures (1969) Experimental Poetry Pic-Poems or Action Poems 69 The Scope and Limits of Artmatics (1971) 131 Semantic Action Poem No. II 71 On Concrete Poetry (1966) (1 9 6 6 ) 78 On a Concrete Poetry 1 3 2 Pic-Poems 1 (1971) Exhibition (1966) 137 Session of Pic-Poems (1971) 82 The New Poetry and the 139 Ashurbanipal Played Problems of Contemporary the Flute (1971) Aesthetics (1967) 141 Song of the Glass of Water (1971) 89 Probable Situations (1968) 142 Impossible Presentation (1971) 95 Meaning and 144 Three Terms (1973) Meaninglessness of 146 Actions for the Pamplona Technological Art (1971) Encounters (1973) 99 The CPAA: 148 TRY P. O. E. UBLIC-P Diseases of Spanish Culture. (19 7 3 ) The End of a Combat Group Without Opponents (1969) Poem dedicated to Carlos Oroza 103 Concrete Poetry— Public Poetry (1970) 151 Elencar (1974) 153 Public and Action Poems Ignacio Gómez de Liaño: Life as a Poetic Text1 Lola Hinojosa Free art from works of art, allow art to be energy, action, liberation, participation, libertarian commune of senso- riality and imagination, an active outpost of a world of solidarity.2 If there is a word that can signify the work of Ignacio Gómez de Liaño, that word is “writing.” Since his early invitation to for- sake—or even violently reject—a certain traditional version of the gesture of writing,3 Gómez de Liaño has “written” a long intel- lectual career.