HANS-URS WILI CARL ORFF: Carmina Burana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

757.Pdf (140.1Kb)
THE fESTIVll..L OPE!:'..'. RDDllCT:f;~''i STAFF .?-V{ Musical Direction-------------------------Stanley Chapple f'SO' Musical Preparation-----------------------Alexander Kuchunas Stage Direction---------------------------Ralph Rosinbum /' Scenic Design-----------------------------John Ashby Conway UNIVERSITY OF WASHINGTON Costnme Design----------------------------James Crider FESTIVAL OPERA Technical Director------------------------Don Klovstad Lighting Design---------------------------Lee Harmon Stage Manager-----------------------------Daniel Brenner and the Office of Lectures and conce~ Assistant Stage Directors-----------------Richard Krueger Randall Holden Repetiteur--------------------------------Marlene ThaI present Performance rights granted by: Mills Music, Inc. (Hello Out There); Schotts Music Publishing Co. (Wise Woman). HELLO OUT THERE 56 10 ORCHESTRA "Hello Out There" based on the play by William Saroyan String Quintet Wood Winds Music by Jack Beeson **Martin Friedmann *Felix Skowronek **David Buck *Laila Storch Carol Kapek *William McColl **Michael Matesky *Arthur Grossman AND Harold Johanson Brass Pe raussion *Christopher Leuba .. *David Shrader **Timothy Dunlop THE WISE WOMAN (DIE KLUGE) sG Ii *Faaulty Member Piano Sbl~ **Graduate Student James van Horn Music by Carl OIff "Wise Woman" Violin Bass Trumpet Cynthia Cole Glenn Stallcop Keith Baggerly \ Sherry Peterson Flute & Piaaol-o Jeffrey Cole / Loryn Davidson Leslie Hall Charles Stowell Roger Faris Grace Millay Terry Nickels Phyllis West Betsy Raleigh Trombone Mark Lutz -

Carmina Burana Carl Orff (1895–1982) Composed: 1935–1936 Style: Contemporary Duration: 58 Minutes
Carmina Burana Carl Orff (1895–1982) Composed: 1935–1936 Style: Contemporary Duration: 58 minutes The Latin title of tonight’s major work, translated literally as “Songs of Beuren,” comes from the Abby of Benediktbeuren where a book of poems was discovered in 1803. The Abbey is located about 30 miles south of Munich, where the composer Carl Orff was born, educated, and spent most of his life. The 13th century book contains roughly 200 secular poems that describe medieval times. The poems, written by wandering scholars and clerics known as Goliards, attack and satirize the hypocrisy of the Church while praising the self-indulgent virtues of love, food, and drink. Their language and form often parody liturgical phrases and conventions. Similarly, Orff often uses the styles and conventions of 13th century church music, most notably plainchant, to give an air of seriousness and reverence to the texts that their actual meaning could hardly demand. In addition to plainchant, however, the eclectic musical material relies upon all kinds of historical antecedents— from flamenco rhythms (no. 17, “Stetit puella”) to operatic arias (no. 21, “Intrutina”) to chorale texture (no. 24, “Ave formosissima”). The 24 poems that compose Carmina Burana are divided into three large sections— “Springtime,” “In the Tavern,” and “Court of Love” —plus a prologue and epilogue. The work begins with the chorus “Fortuna imperatrix mundi,” (“Fortune, Empress of the World”), which bemoans humankind’s helplessness in the face of the fickle wheel of fate. “Rising first, then declining, hateful life treats us badly, then with kindness, making sport of our desires.” After a brief morality tale, “Fortune plango vunera,” the “Springtime” section begins. -

Catulo Y Lesbia En La Obra De Carl Orff
Catulo y Lesbia en la obra de Carl Orff Beatriz Cotello [Corresponsal ante la Ópera de Viena, Austria] Resumen: En este artículo se presentan las cantatas creadas por el compositor Génesis de Catulli Carmina alemán Carl Orff sobre material poético de Catulo: los ludi scenici sobre los amo- res de Catulo y Lesbia titulados Catulli arl Orff (1895-1982) Carmina y el concerto scenico Trionfo di Afrodite en el que musicaliza los poemas complementa su obra de Catulo sobre el himeneo (con el aditamento de un epitalamio de Safo y más famosa y conoci- un coro de Eurípides). El artículo ofrece da, Carmina Burana, un análisis del contenido dramático y musical de ambas piezas y se destacan con dos cantatas, Catulli las características de la concepción de la música de Orff. Junto con Carmina Carmina ludi scaenici Burana, las obras forman un tríptico en y Trionfo di Afrodita: que se celebra el triunfo del amor sobre todo el acontecer humano. conforma así un tríp- Palabras clave: Carl Orff - Trionfi - tico sobre el amor humano en diversas Catulo y Lesbia - Afrodita C 1 expresiones. Un artículo anterior que presenta la obra de Orff en términos Catulo and Lesbia as represented by Carl Orff de su búsqueda de “lo elemental” en la música, ofrece ya un análisis de los Abstract: This article deals with two works from the german composer Carl Carmina Burana. Nos referiremos aho- Orff based on Catullus Latin poetry: Catulli Carmina in which he depicts the ra a las cantatas complementarias. love story of Catulo and Lesbia and La idea de poner en música los ver- Trionfo di Afrodite, where he uses two long wedding poems of Catullus and sos de Catulo surge en 1930, cuando material from Safo and Euripides. -
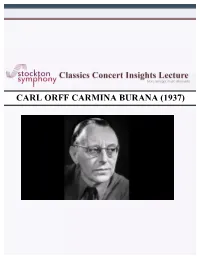
Carl Orff Carmina Burana (1937)
CARL ORFF CARMINA BURANA (1937) CARL ORFF CARMINA BURANA (1937) CARMINA: Plural of Carmen, Latin for song. BURANA: Latin for, from Bayern, Bavaria. CANTATA VERSUS ORATORIO: Ø Cantata: A sacred or secular work for chorus and orchestra. Ø Oratorio: An opera without scenery or costumes. THE MUSIC: Ø A collection of 24 songs, most in Latin, some in Middle High German, with a few French words. THE SPECTACLE: Ø Seventy piece orchestra. Ø Large chorus of men, women and boys and girls. Ø Three soloists: tenor, baritone and soprano. THE POETRY: Ø The Medieval Latin poetry of Carmina Burana is in a style called Saturnian that dates back to 200 B.C. It was accented and stressed, used by soldiers on the march, tavern patrons and children at play. Later used by early Christians. Ø While the poems are secular, some are hymn-like. Orff’s arrangements highlight this. Ø The poems were composed by 13th century Goliards, Medieval itinerant street poets who lived by their wits, going from town to town, entertaining people for a few coins. Many were ex monks or university drop-outs. Ø Common Goliard themes include disaffection with society, mockery of the church, carnal desire and love. Ø Benedictine monks in a Bavarian monastery, founded in 733 in Beuern, in the Alps south of Munich, collected these Goliardic poems. Ø After the dissolution of the monastery in 1803, some two hundred of these poems were published in 1847 by Andreas Schmeller, a dialect scholar, in an anthology that he labeled Carmina Burana. Ø Orff discovered these in 1935 and, with the help of the poet Michael Hoffman, organized twenty-four poems from the collection into a libretto by the same name. -

Concert: Carmina Burana by Carl Orff Ithaca College Choral Union
Ithaca College Digital Commons @ IC All Concert & Recital Programs Concert & Recital Programs 4-17-2005 Concert: Carmina Burana by Carl Orff Ithaca College Choral Union Ithaca College Symphony Orchestra Lawrence Doebler Jeffrey Grogan Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ithaca.edu/music_programs Part of the Music Commons Recommended Citation Ithaca College Choral Union; Ithaca College Symphony Orchestra; Doebler, Lawrence; and Grogan, Jeffrey, "Concert: Carmina Burana by Carl Orff" (2005). All Concert & Recital Programs. 4790. https://digitalcommons.ithaca.edu/music_programs/4790 This Program is brought to you for free and open access by the Concert & Recital Programs at Digital Commons @ IC. It has been accepted for inclusion in All Concert & Recital Programs by an authorized administrator of Digital Commons @ IC. ITHACA COLLEGE CHORAL UNION ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA Lawrence Doebler, conductor CARMINA BURANA by Carl Orff Randie Blooding, baritone Deborah Montgomery-Cove, soprano Carl Johengen, tenor Ithaca College Women's Chorale, Janet Galvan, conductor Ithaca College Chorus, Janet Galvan, conductor Ithaca College Choir, Lawrence Doebler, conductor Ithaca College Symphony Orchestra, Jeffrey Grogan, conductor Charis Dimaris and Read Gainsford, pianists Members of the Ithaca Children's Choir Community School of Music and Arts Janet Galvan, artistic director Verna Brummett, conductor Ford Hall Sunday, April 17, 2005 4:00 p.m. ITHACA THE OVERTURE TO THE SCHOOL FOR SCANDAL Samuel Barber Ithaca College Symphony -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 128, 2008-2009
* BOSTON SYAfl PHONY m ORCHESTRA i i , V SEASON f '0* 3' Music Director lk Conductor j Emei {Music Director Lc I IP the Clarendon BACK BAY The Way to Live ;; III! in"! I II !! U nil * I v l iji HI I etc - I y=- • ^ Fi 2 '\ i ra % m 1 1 ih ... >'? & !W ||RBIK;| 4* i :: it n w* n- I II " n ||| IJH ? iu u. I 1?: iiir iu» !! i; !l! Hi \m SL • i= ! - I m, - ! | || L ' RENDERING BY NEOSCAPE INTRODUCING FIVE STAR LIVING™ WITH UNPRECEDENTED SERVICES AND AMENITIES DESIGNED BY ROBERT A.M. STERN ARCHITECTS, LLP ONE TO FOUR BEDROOM LUXURY CONDOMINIUM RESIDENCES STARTING ON THE 15TH FLOOI CORNER OF CLARENDON AND STUART STREETS THE CLARENDON SALES AND DESIGN GALLERY, 14 NEWBURY STREET, BOSTON, MA 617.267.4001 www.theclarendonbackbay.com BRELATED DL/aLcomp/ REGISTERED W "HE U.S. GREEN BUILDING COUNl ITH ANTICIPATED LEED SILVER CERTIFICATION The artist's rendering shown may not be representative of the building. The features described and depicted herein are based upon current development plans, which a described. No Fede: subject to change without notice. No guarantee is made that said features will be built, or, if built, will be of the same type, size, or nature as depicted or where prohibited. agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not an offer where registration is required prior to any offer being made. Void Table of Contents | Week 7 15 BSO NEWS 21 ON DISPLAY IN SYMPHONY HALL 23 BSO MUSIC DIRECTOR JAMES LEVINE 26 THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA 31 THIS WEEK'S PROGRAM Notes on the Program 35 The Original Sound of the "Carmina burana" (c.1230) 41 Carl Orff's "Carmina burana" 53 To Read and Hear More.. -

INDIANAPOLIS OPERA COMPANY PRESENTS How to Fight Inflation
INDIANAPOLIS OPERA COMPANY PRESENTS How to fight inflation. * It looks like a piano. And it sounds like a piano. But it's more than a piano. It's a Steinway. And that means that it's not only a fine musical instrument. It's a fine investment as well. So fine, that people with 30 year old Steinways are selling them today for more than they originally paid. What makes a Steinway such a blue chip investment? Work. Experience. Work. Caring. Work. Using mortised joints where butt joints could get by. Making each individual hammer instead of buying them from someone else. Voicing each piano for 8 full hours. A thousand other details. It takes a full year of this kind of work to complete one Steinway grand. A year that pays dividends in tone, touch and power year after year after year. What this means is that although you pay more, a Steinway doesn't really cost more. Because no matter how you decide to play it, a Steinway outperforms the market. For more information visit any of the 5 Wilking Stores and let one of our keyboard counselors relate the complete story or call 293-4717 and we will be pleased to mail you complete descriptive information. The Steinway House of Indiana Downtown: 43 East Washington Street 637-1326 Ayr-Way Greenwood Mall: U.S. 31 S. and County Line Rd. 882-9195 Castleton Square 849-9402 Lafayette Square 297-4121 Washington Square 898-6451 OPEItf. \Ji FOUR ACT5 APRIL 27, 29, 30, 1977 8:00 P.M. -

Wolfgang Sawallisch Paco 044 Paco 044 Carmina Burana Agnes Giebeliebel - Marcel Cordes - Paul Kuén
L CARL ORFF L WOLFGANG SAWALLISCH PACO 044 PACO 044 CARMINA BURANA AGNES GIEBELIEBEL - MARCEL CORDES - PAUL KUÉN 1 Fortuna Imperatrix Mundi - i: O Fortuna (2:43) 2 Fortuna Imperatrix Mundi - ii: Fortune plango vulnera (2:41) 3 I – Primo vere - iii: Veris leta facies (3:25) 4 I – Primo vere - iv: Omnia sol temperat (2:04) 5 I – Primo vere - v: Ecce gratum (2:35) 6 Uf dem Anger - vi: Tanz (1:47) 7 Uf dem Anger - vii: Floret Silva (3:13) 8 Uf dem Anger - viii: Chramer, gip die varwe mir (3:06) 9 Uf dem Anger - ix. Reie - Swaz hie gat umbe - Chume, chum, geselle min (4:22) A Uf dem Anger - x: Were diu werlt alle min (0:52) B II – In Taberna - xi: Estuans interius (2:25) C II – In Taberna - xii: Olim lacus colueram (3:11) D II – In Taberna - xiii: Ego sum abbas (1:34) Agnes Giebel, soprano E II – In Taberna - xiv: In taberna quando sumus (3:08) Marcel Cordes, baritone F III – Cour d'amours - xv: Amor volat undique (3:13) Paul Kuén, tenor G III – Cour d'amours - xvi: Dies, nox et omnia (2:17) H III – Cour d'amours - xvii: Stetit puella (1:49) Chorus of the Westdeustchen Rundfunk I III – Cour d'amours - xviii: Circa mea pectora (2:03) Chorus-master: Bernhard Zimmerman J III – Cour d'amours - xix: Si puer cum puellula (0:56) K III – Cour d'amours - xx: Veni, veni, venias (0:57) Cologne Rundfunk-Sinfonie-Orchester L III – Cour d'amours - xxi: In trutina (1:48) conductor Wolfgang Sawallisch M III – Cour d'amours - xxii: Tempus est iocundum (2:06) N III – Cour d'amours - xxiii: Dulcissime (0:36) Recorded in 1956 under the personal O Blanziflor et Helena - xxiv: Ave formosissima (1:42) supervision of Carl Orff P Fortuna Imperatrix Mundi - xxv: O Fortuna (reprise) (2:38) ORFF - CARMINA BURANA Transfer from UK Columbia LP 33CX1480 in the Pristine Audio collection R 1956 C O XR remastering by Andrew Rose at Pristine Audio, May 2010 ECORDED ININ UNDER THE PERSONAL SUPERVISION OF ARL RFF Cover artwork based on a photograph of Wolfgang Sawallisch C W R Total duration: 57:11 ©2010 Pristine Audio. -

Kodály and Orff: a Comparison of Two Approaches in Early Music Education
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 KODÁLY AND ORFF: A COMPARISON OF TWO APPROACHES IN EARLY MUSIC EDUCATION Yrd.Doç.Dr. Dilek GÖKTÜRK CARY Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü [email protected] ABSTRACT The Hungarian composer and ethnomusicologist Zoltán Kodály (1882-1967) and the German composer Carl Orff (1895-1982) are considered two of the most influential personalities in the arena of music education during the twentieth-century due to two distinct teaching methods that they developed under their own names. Kodály developed a hand-sign method (movable Do) for children to sing and sight-read while Orff’s goal was to help creativity of children through the use of percussive instruments. Although both composers focused on young children’s musical training the main difference between them is that Kodály focused on vocal/choral training with the use of hand signs while Orff’s main approach was mainly on movement, speech and making music through playing (particularly percussive) instruments. Finally, musical creativity via improvisation is the main goal in the Orff Method; yet, Kodály’s focal point was to dictate written music. Key Words: Zoltán Kodály, Carl Orff, The Kodály Method, The Orff Method. KODÁLY VE ORFF: ERKEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN İKİ METODUN BİR KARŞILAŞTIRMASI ÖZET Macar besteci ve etnomüzikolog Zoltán Kodály (1882-1967) ve Alman besteci Carl Orff (1895-1982) geliştirmiş oldukları farklı 2 öğretim metodundan dolayı 20. yüzyılda müzik eğitimi alanında en etkili 2 kişi olarak anılmaktadırlar. Kodály çocukların şarkı söyleyebilmeleri ve deşifre yapabilmeleri için el işaretleri metodu (gezici Do) geliştirmiş, Orff ise vurmalı çalgıların kullanımı ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedef edinmiştir. -

Carl Orff Die Kluge Mp3, Flac, Wma
Carl Orff Die Kluge mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Classical / Stage & Screen Album: Die Kluge Country: Germany Style: Modern, Opera MP3 version RAR size: 1909 mb FLAC version RAR size: 1356 mb WMA version RAR size: 1620 mb Rating: 4.3 Votes: 411 Other Formats: AC3 XM WAV DXD DMF VQF MOD Tracklist Die Geschichte Von Dem König Und Der Klugen Frau A Carl Orff Spricht Den Prolog, 1.-3. Szene B 4.-6. Szene C 7.-8. Szene, 9. Szene (1. Teil) D 9. Szene (Schluß), 10.-12. Szene, Carl Orff spricht den Epilog Credits Baritone Vocals [Der König] – Marcel Cordes Baritone Vocals [Zweiter Strolch] – Hermann Prey Bass Vocals [Der Bauer] – Gottlob Frick Bass Vocals [Der Kerkermeister] – Georg Wieter Bass Vocals [Der Mann Mit Dem Maulesel] – Benno Kusche Bass Vocals [Dritter Strolch] – Gustav Neidlinger Composed By, Narrator [Speaker], Other [Recording Supervisor] – Carl Orff Conductor – Wolfgang Sawallisch Liner Notes – K. H. Ruppel Orchestra – Philharmonia Orchester London* Soprano Vocals [Die Kluge] – Elisabeth Schwarzkopf Tenor Vocals [Der Mann Mit Dem Esel] – Rudolf Christ Tenor Vocals [Erster Strolch] – Paul Kuen Notes Recorded under the personal supervision of Carl Orff Recorded in London · May 1956 Other versions Category Artist Title (Format) Label Category Country Year Angel ANGEL 3551 Records, ANGEL 3551 B/L, ANG. Die Kluge (2xLP, Angel B/L, ANG. Carl Orff US 1956 35389, ANG. Mono + Box) Records, 35389, ANG. 35390 Angel 35390 Records Elisabeth Schwarzkopf / Elisabeth Marcel Cordes / Schwarzkopf / Gottlob Frick / Marcel Cordes / Rudolf Christ / The Record Gottlob Frick / Benno Kusche / Society, Rudolf Christ / Paul Kuen / World 40-6040, No. -

Reconsidering the Carmina Burana Gundela Bobeth (Translated by Henry Hope)1
4 | Wine, women, and song? Reconsidering the Carmina Burana gundela bobeth (translated by henry hope)1 Introduction: blending popular views and scientific approaches By choosing the catchy title Carmina Burana –‘songs from Benediktbeuern’–for his 1847 publication of all Latin and German poems from a thirteenth-century manuscript held at the Kurfürstliche Hof- und Staatsbibliothek Munich, a manuscript as exciting then as now, the librar- ian Johann Andreas Schmeller coined a term which, unto the present day, is generally held to denote secular music-making of the Middle Ages in paradigmatic manner.2 The Carmina Burana may be numbered among the few cornerstones of medieval music history which are known, at least by name, to a broader public beyond the realms of musicology and medieval history, and which have evolved into a ‘living cultural heritage of the present’.3 Held today at the Bayerische Staatsbibliothek under shelfmarks Clm 4660 and 4660a, and commonly known as the ‘Codex Buranus’, the manuscript – referred to in what follows as D-Mbs Clm 4660-4660a – constitutes the largest anthology of secular lyrics in medieval Latin and counts among the most frequently studied manuscripts of the Middle Ages.4 Yet the entity most commonly associated with the title Carmina Burana has only little to do with the musical transmission of this manu- script. Carl Orff’s eponymous cantata of 1937, which quickly became one of the most famous choral works of the twentieth century, generally tops the list of associations. Orff’s cantata relates to D-Mbs Clm 4660-4660a only in as much as it is based on a subjective selection of the texts edited by Schmeller; it does not claim to emulate the medieval melodies. -

Naxos Catalog (May
CONTENTS Foreword by Klaus Heymann . 3 Alphabetical List of Works by Composer . 5 Collections . 95 Alphorn 96 Easy Listening 113 Operetta 125 American Classics 96 Flute 116 Orchestral 125 American Jewish Music 96 Funeral Music 117 Organ 128 Ballet 96 Glass Harmonica 117 Piano 129 Baroque 97 Guitar 117 Russian 131 Bassoon 98 Gypsy 119 Samplers 131 Best Of series 98 Harp 119 Saxophone 132 British Music 101 Harpsichord 120 Timpani 132 Cello 101 Horn 120 Trombone 132 Chamber Music 102 Light Classics 120 Tuba 133 Chill With 102 Lute 121 Trumpet 133 Christmas 103 Music for Meditation 121 Viennese 133 Cinema Classics 105 Oboe 121 Violin 133 Clarinet 109 Ondes Martenot 122 Vocal and Choral 134 Early Music 109 Operatic 122 Wedding Music 137 Wind 137 Naxos Historical . 138 Naxos Nostalgia . 152 Naxos Jazz Legends . 154 Naxos Musicals . 156 Naxos Blues Legends . 156 Naxos Folk Legends . 156 Naxos Gospel Legends . 156 Naxos Jazz . 157 Naxos World . 158 Naxos Educational . 158 Naxos Super Audio CD . 159 Naxos DVD Audio . 160 Naxos DVD . 160 List of Naxos Distributors . 161 Naxos Website: www.naxos.com Symbols used in this catalogue # New release not listed in 2005 Catalogue $ Recording scheduled to be released before 31 March, 2006 † Please note that not all titles are available in all territories. Check with your local distributor for availability. 2 Also available on Mini-Disc (MD)(7.XXXXXX) Reviews and Ratings Over the years, Naxos recordings have received outstanding critical acclaim in virtually every specialized and general-interest publication around the world. In this catalogue we are only listing ratings which summarize a more detailed review in a single number or a single rating.