Q. Aurelius Symmachus Und Die Stadtpraefecten Unter Kaiser Valentinian II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Roman-Barbarian Marriages in the Late Empire R.C
ROMAN-BARBARIAN MARRIAGES IN THE LATE EMPIRE R.C. Blockley In 1964 Rosario Soraci published a study of conubia between Romans and Germans from the fourth to the sixth century A.D.1 Although the title of the work might suggest that its concern was to be with such marriages through- out the period, in fact its aim was much more restricted. Beginning with a law issued by Valentinian I in 370 or 373 to the magister equitum Theodosius (C.Th. 3.14.1), which banned on pain of death all marriages between Roman pro- vincials and barbarae or gentiles, Soraci, after assessing the context and intent of the law, proceeded to discuss its influence upon the practices of the Germanic kingdoms which succeeded the Roman Empire in the West. The text of the law reads: Nulli provineialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum bar- bara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provinciales femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles adfinitates ex huiusmodi nuptiis extiterit, quod in his suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur. This was regarded by Soraci not as a general banning law but rather as a lim- ited attempt, in the context of current hostilities with the Alamanni, to keep those barbarians serving the Empire (gentiles)isolated from the general Roman 2 populace. The German lawmakers, however, exemplified by Alaric in his 63 64 interpretatio,3 took it as a general banning law and applied it in this spir- it, so that it became the basis for the prohibition under the Germanic king- doms of intermarriage between Romans and Germans. -

Life with Augustine
Life with Augustine ...a course in his spirit and guidance for daily living By Edmond A. Maher ii Life with Augustine © 2002 Augustinian Press Australia Sydney, Australia. Acknowledgements: The author wishes to acknowledge and thank the following people: ► the Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel, Australia, for support- ing this project, with special mention of Pat Fahey osa, Kevin Burman osa, Pat Codd osa and Peter Jones osa ► Laurence Mooney osa for assistance in editing ► Michael Morahan osa for formatting this 2nd Edition ► John Coles, Peter Gagan, Dr. Frank McGrath fms (Brisbane CEO), Benet Fonck ofm, Peter Keogh sfo for sharing their vast experience in adult education ► John Rotelle osa, for granting us permission to use his English translation of Tarcisius van Bavel’s work Augustine (full bibliography within) and for his scholarly advice Megan Atkins for her formatting suggestions in the 1st Edition, that have carried over into this the 2nd ► those generous people who have completed the 1st Edition and suggested valuable improvements, especially Kath Neehouse and friends at Villanova College, Brisbane Foreword 1 Dear Participant Saint Augustine of Hippo is a figure in our history who has appealed to the curiosity and imagination of many generations. He is well known for being both sinner and saint, for being a bishop yet also a fellow pilgrim on the journey to God. One of the most popular and attractive persons across many centuries, his influence on the church has continued to our current day. He is also renowned for his influ- ence in philosophy and psychology and even (in an indirect way) art, music and architecture. -

Emperors and Generals in the Fourth Century Doug Lee Roman
Emperors and Generals in the Fourth Century Doug Lee Roman emperors had always been conscious of the political power of the military establishment. In his well-known assessment of the secrets of Augustus’ success, Tacitus observed that he had “won over the soldiers with gifts”,1 while Septimius Severus is famously reported to have advised his sons to “be harmonious, enrich the soldiers, and despise the rest”.2 Since both men had gained power after fiercely contested periods of civil war, it is hardly surprising that they were mindful of the importance of conciliating this particular constituency. Emperors’ awareness of this can only have been intensified by the prolonged and repeated incidence of civil war during the mid third century, as well as by emperors themselves increasingly coming from military backgrounds during this period. At the same time, the sheer frequency with which armies were able to make and unmake emperors in the mid third century must have served to reinforce soldiers’ sense of their potential to influence the empire’s affairs and extract concessions from emperors. The stage was thus set for a fourth century in which the stakes were high in relations between emperors and the military, with a distinct risk that, if those relations were not handled judiciously, the empire might fragment, as it almost did in the 260s and 270s. 1 Tac. Ann. 1.2. 2 Cass. Dio 76.15.2. Just as emperors of earlier centuries had taken care to conciliate the rank and file by various means,3 so too fourth-century emperors deployed a range of measures designed to win and retain the loyalties of the soldiery. -

6 X 10 Long.P65
Cambridge University Press 978-0-521-84633-2 - Rome’s Gothic Wars: From the Third Century to Alaric Michael Kulikowski Index More information Index iii Ablabius, 54 Ariaric, 84–85 Abrittus, 18, 28 Ariminum. See Rimini Adrianople: battle of, 139–143; curia of, Arinthaeus, 117 135–136; siege of, 146 Arius, 107–108 Ad Salices, battle of, 137 Armenia, 129, 137, 167, 168 Aequitius, 143 Arminius, 47 Africa, grain supply of, 6, 168, 175–176 army, Roman: as basis of imperial power, 26; Alamanni,59, 81, 105;origins of,39–40, 67, 71 barbarians in, 35–37, 82, 156; Goths in, 79, Alanoviamuth, 49 82, 103, 106, 156–157; losses of, at Alans, 124–128, 171, 183 Adrianople, 150 Alaric: 1–11, 157–177, 183–184; and Attalus, 9, Arpulas, 121 174–176; and Eutropius, 166–168; and Arrian, 125 Rufinus, 165; death of, 180; early career of, Ascholius, 118 161–162; first revolt of, 164–166; demands Asia Minor: Goths killed in, 146–147, 154; of, 1–2, 165, 172–174; followers, 1–2, 4–5, 6, Gothic revolt in, 168–169 157, 165 Athanaric, 101; ancestry of, 85; death of, 155; Alatheus, 126–127, 131–132, 152;at defeated by Huns, 126–128, 131–132; Adrianople, 141–142 persecutes Christians, 117–118, 120–122; Alavivus, 128–130, 132–133 Roman wars of, 116–118 Aleksandrovka, 92 Atharidus, 120 Alexander Severus, 28 Athaulf, 10, 158, 175, 177, 180–182 alphabet, Gothic, 110 Athens, 19 Amal dynasty, 50, 53, 161 Attalus, Priscus, 9, 174–176, 182–183 Ambrose of Milan, 160 Attica, 19 Ammianus Marcellinus, 103–105; Res Gestae Attila, 157 of, 104–105; on Adrianople, 140–141, 144, Augustae, 31 146–147; on Huns, 124–125 Augustine, 178–179 Antioch, 117, 129 Augustus, 22, 40 Antonine Constitution, 25, 34 Aurelian (emperor), 8, 20–21, 29–30 Antoninus Pius, 23 Aurelian (praetorian prefect), 169 Apamea, 19 Aureolus, 20, 29 Aquitaine, 158, 183 Aurelius Victor, 30 Arabs, 146 Auxentius, 107 Arbogast, 151, 162–163 Auxonius, 115 Arcadius, 163, 165, 172 archaeology. -

Perjury and False Witness in Late Antiquity and the Early Middle Ages
Perjury and False Witness in Late Antiquity and the Early Middle Ages by Nicholas Brett Sivulka Wheeler A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Nicholas Brett Sivulka Wheeler 2018 Perjury and False Witness in Late Antiquity and the Early Middle Ages Nicholas Brett Sivulka Wheeler Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2018 Abstract This dissertation, ‘Perjury and False Witness in Late Antiquity and the Early Middle Ages’, investigates changing perceptions of perjury and false witness in the late antique and early medieval world. Focusing on primary sources from the Latin-speaking, western Roman empire and former empire, approximately between the late third and seventh centuries CE, this thesis proposes that perjury and false witness were transformed into criminal behaviours, grave sins, and canonical offences in Latin legal and religious writings of the period. Chapter 1, ‘Introduction: The Problem of Perjury’s Criminalization’, calls attention to anomalies in the history and historiography of the oath. Although the oath has been well studied, oath violations have not; moreover, important sources for medieval culture – Roman law and the Christian New Testament – were largely silent on the subject of perjury. For classicists in particular, perjury was not a crime, while oath violations remained largely peripheral to early Christian ethical discussions. Chapter 2, ‘Criminalization: Perjury and False Witness in Late Roman Law’, begins to explain how this situation changed by documenting early possible instances of penalization for perjury. Diverse sources such as Christian martyr acts, provincial law manuals, and select imperial ii and post-imperial legislation suggest that numerous cases of perjury were criminalized in practice. -
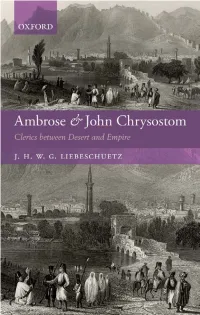
AMBROSE and JOHN CHRYSOSTOM This Page Intentionally Left Blank Ambrose and John Chrysostom Clerics Between Desert and Empire
AMBROSE AND JOHN CHRYSOSTOM This page intentionally left blank Ambrose and John Chrysostom Clerics between Desert and Empire J. H. W. G. LIEBESCHUETZ 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With oYces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York # J. H. W. G. Liebeschuetz 2011 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other -

Calendar of Roman Events
Introduction Steve Worboys and I began this calendar in 1980 or 1981 when we discovered that the exact dates of many events survive from Roman antiquity, the most famous being the ides of March murder of Caesar. Flipping through a few books on Roman history revealed a handful of dates, and we believed that to fill every day of the year would certainly be impossible. From 1981 until 1989 I kept the calendar, adding dates as I ran across them. In 1989 I typed the list into the computer and we began again to plunder books and journals for dates, this time recording sources. Since then I have worked and reworked the Calendar, revising old entries and adding many, many more. The Roman Calendar The calendar was reformed twice, once by Caesar in 46 BC and later by Augustus in 8 BC. Each of these reforms is described in A. K. Michels’ book The Calendar of the Roman Republic. In an ordinary pre-Julian year, the number of days in each month was as follows: 29 January 31 May 29 September 28 February 29 June 31 October 31 March 31 Quintilis (July) 29 November 29 April 29 Sextilis (August) 29 December. The Romans did not number the days of the months consecutively. They reckoned backwards from three fixed points: The kalends, the nones, and the ides. The kalends is the first day of the month. For months with 31 days the nones fall on the 7th and the ides the 15th. For other months the nones fall on the 5th and the ides on the 13th. -

The Religious World of Quintus Aurelius Symmachus
The Religious World of Quintus Aurelius Symmachus ‘A thesis submitted to the University of Wales Trinity Saint David in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy’ 2016 Jillian Mitchell For Michael – and in memory of my father Kenneth who started it all Abstract for PhD Thesis in Classics The Religious World of Quintus Aurelius Symmachus This thesis explores the last decades of legal paganism in the Roman Empire of the second half of the fourth century CE through the eyes of Symmachus, orator, senator and one of the most prominent of the pagans of this period living in Rome. It is a religious biography of Symmachus himself, but it also considers him as a representative of the group of aristocratic pagans who still adhered to the traditional cults of Rome at a time when the influence of Christianity was becoming ever stronger, the court was firmly Christian and the aristocracy was converting in increasingly greater numbers. Symmachus, though long known as a representative of this group, has only very recently been investigated thoroughly. Traditionally he was regarded as a follower of the ancient cults only for show rather than because of genuine religious beliefs. I challenge this view and attempt in the thesis to establish what were his religious feelings. Symmachus has left us a tremendous primary resource of over nine hundred of his personal and official letters, most of which have never been translated into English. These letters are the core material for my work. I have translated into English some of his letters for the first time. -
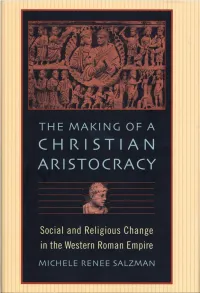
The Making of Christian Aristocracy
THE MAKING OF A CHRISTIAN ARISTOCRACY Michele Renee Salzman The Making of a Christian Aristocracy Social and Religious Change in the Western Roman Empire Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, and London, England Copyright © 2002 by the President and Fellows of Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America First Harvard University Press paperback edition, 2004 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Salzman, Michele Renee. The making of a Christian aristocracy : social and religious change in the western Roman Empire / Michele Renee Salzman. p. cm. Includes bibliographical references (p. ) and index. ISBN 0-674-00641-0 (cloth) ISBN 0-674-01603-3 (pbk.) 1. Christian converts—Rome. 2. Aristocracy (Social class)—Religious life—Rome. 3. Sociology, Christian—History—Early church, ca. 30–600. I. Title. BR195.C6 S35 2002 270.2Ј086Ј21—dc21 2001047075 To my husband, Steven, and my children, Juliana and Ben Contents Preface ix 1. Approaches to a Paradox 1 2. Defining the Senatorial Aristocracy 19 3. Aristocratic Men: Social Origins 69 4. Aristocratic Men: Career Paths 107 5. Aristocratic Women 138 6. The Emperor’s Influence on Aristocratic Conversion 178 7. The Aristocrats’ Influence on Christianity 200 Tables 221 Appendix 1: Sources, Criteria, and Variables for the Database 231 Appendix 2: Names and Religious Affiliation of Aristocrats in the Study 243 Appendix 3: Sources for the Database—Addenda and Corrigenda to PLRE 254 Appendix 4: High Office Holders 258 Abbreviations and Frequently Cited Works 265 Notes 269 Index 342 Preface Every student of the later Roman empire will, at one time or other, confront the subject of this book: What did it take to make the Roman aristocracy in the later western empire change its ancient religious traditions, turning from paganism to Christianity, in the century of Constantine? My answer to this question would not have been possible without the work of generations of scholars, whose advances and missteps have chal- lenged and taught me. -

Cesarzowa Eudoksja W Świetle Historii Kościelnych Piątego Wieku (Streszczenie)
VOX PATRUM 75 (2020) 43-66 DOI: 10.31743/vp.4953 Sławomir Bralewski1 Empress Eudoxia through the Prism of Fifth Century Ecclesiastical Histories2 The eastern Roman Empire had experienced in the beginning of the fifth century AD, a conflict between the episcopal and the imperial author- ities over non-doctrinal issues. The quarrel between John Chrysostom, bishop of Constantinople, and the imperial court appears to be all but a struggle for the auctoritas principis, or in other words, a struggle for spiritual, religious and indeed, moral primacy in the relations between the Roman state and the Church. The deteriorating relations between John Chrysostom and the imperial court resulted in the deposition and exile of the Constantinopolitan bishop. A question which still begs to be asked is: What exactly did John Chrysostom’s downfall owe to the alleged in- volvement of the wife of the Eastern Roman emperor Arcadius (377-408), the empress, Aelia Eudoxia (d. 404)?3 1 Dr hab. Sławomir Bralewski, associate professor, Faculty of Philosophy and History, Institute of History, Department of Byzantine History, University of Lodz; e-mail: [email protected]; ORCID: 0000-0002-4708-0103. 2 The author would like to thank Cyril Chilson (Blackfriars Hall, Oxford) for proof- reading the typescript of this paper. 3 Neither Socrates and Sozomen nor Theodoret offer any information about Eudoxia’s progeny, whereas Philostorgius does refer to it (Historia Ecclesiastica XI 6), indicating that she was the daughter of Bauto, a Roman General of Frankish origin who distinguished himself in the West under emperor Valentinian II. See: The Prosopography of the Later Roman Empire, v. -
Stilicho Paper
Meet the New Boss Stilicho, the rise of the magister utriusque militiae and the path to irrelevancy of the position of Western Emperor Michael Cancella Senior Thesis April 12 th , 2010 1 | P a g e Table of Contents Preface Chapter 1: The Roman Empire of the 3 rd and 4 th century Chapter 2: Houston, we have a problem. The Goths Chapter 3: Cancer? What cancer? The Gothic state within a state Chapter 4: Theodosius: Holding onto power is harder than you think Chapter 5: Enter the Vandal: Stilicho Chapter 6: Bad to the bone: Rufinus Chapter 7: A bad first impression: The campaign in Greece 395 Chapter 8: So you want to be a generalissimo? The history of the magister militum Chapter 9: It’s the same old song: The continuation of the Theodosian regime Chapter 10: You think you’ve got problems? Eutropius, the Greek campaign of 397 and the revolt of Gildo Chapter 11: Good help is so hard to find: The revolt of Tribigild and the failed putsch of Gainas Chapter 12: Like a bad penny: Alaric’s invasion of Italy 402-3 Chapter 13: With friends like these…Introducing the Senatorial class Chapter 14: More barbarians! The invasions of Radagaisus in 405 and the barbarian Rhine crossing of 406 Chapter 15: If this be treason: Alaric as an ally? Chapter 16: Not so fast: the usurpation of Constantine II and a payoff too far Chapter 17: Breaking up is hard to do: The death of Arcadius and the fall of Stilicho Chapter 18: Conclusion 2 | P a g e Preface This paper was inspired by a class I took several years ago about the Later Roman Empire. -

STATING Tile CASE of PAGANISM in 384 AD- ARGUMENTATION IN
View metadata, citation and similar papers at core.ac.ukhttp://akroterion.journals.ac.za/ brought to you by CORE STATING TilE CASE OF PAGANISM IN 384 AD- provided by Akroterion (E-Journal) ARGUMENTATION IN TilE TmRD RELATIO OF SYMMACHUS A.V. van Stekelenburg, University of Stellenbosch No other document so clearly and dramatically illustrates the death throes of Roman paganism in its struggle against Christianity than do three letters addressed to the young Emperor Valentinian II in the year 384 AD. These letters are the third relatio (official report) by the City Prefect of Rome, Quintus Aurelius Symmachus, and the reactions to its contents contained in two letters (epp. 17 and 18) of the Bishop of Milan, (Saint) Ambrose, addressed to that same Prince. These three documents deal with several questions regarding the position of traditional pagan worship, which had since the days of Constantine more than half a century earlier, but especially in recent years, become subjected to a number of severe restrictions through imperiallegislation.t The relatio of Symmachus asked, on behalf of the pagan majority in the Senate, for the rescission of some of these recent anti-pagan decrees. Ambrose vehemently, and successfully, opposed those requests in his two letters. Together the three documents give us a condensed but penetrating view of the dialectics of the two sides in this period of transition that changed Western civilization forever. In the following we intend to look at the way in which Symmachus stated the case of paganism in his relatio. In the past his argumentation has been called ·weak• especially from a theological point of view (Bloch 1971:150 and 156; Klein 1971:164).