Mumford Lewis Mythos Der M
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Man and Machine in the 1960S1 Sungook Hong University of Toronto Seoul National University
Techné 7:3 Spring 2004 Hong, Man and Machine / 49 Man and Machine in the 1960s1 Sungook Hong University of Toronto Seoul National University “Remember your humanity and forget the rest.” (From the invitation to the first Pugwash Conference, 1957) Introduction In 1960, the father of cybernetics Norbert Wiener published a short article titled “Some Moral and Technical Consequences of Automation” in Science. Wiener distinguished here between industrial machines in the time of Samuel Butler (1835-1902, the author of the novel on the dominance of humans by machines, Erehwon) and intelligent machines of his time. Machines circa 1960 had become very effective and even dangerous, Wiener stated, since they possessed “a certain degree of thinking and communication” and transcended the limitations of their designers. Describing in detail game- playing and learning machines, he contemplated a hypothetical situation in which such cybernetic machines were programmed to push a button in a “push-button” nuclear war. Simply by following the programmed rules of the game, Wiener warned, these machines would probably do anything to win a nominal victory even at the cost of human survival. Since machines became so fast, smart, and irrevocable, humans, unlike humans in the industrial age, “may not know, until too late, when to turn it off.” The fictional dominance of humans by machines, which Butler had worried about and vividly depicted in his Ehehwon, had been transformed into a reality (Wiener 1960, 1355- 1358). Wiener’s essay symbolized the beginning of a new conception of the man- machine relationship in the 1960s. The sixties witnessed the Cuban missile crisis, the Apollo Project, the counter-culture movement, Vietnam and student protests, political assassinations, the civil-rights and feminist movement, the publication of Rachel Carson’s Silent Spring (1962) and the beginning of the environmental movement. -

Lewis Mumford on Technics and Society
EACH THOUGHT AND THING ALLIED: LEWIS MUMFORD ON TECHNICS AND SOCIETY by Lynne Hissey B.A., Simon Fraser University, 1982. THESIS SUBMITTED IN PAQTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (COMMUNICATION) in the Department of Communication @ Lynne Hissey SIMON FRASER UNIVERSITY September, 1986 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name: Lynne Hissey Degree: Master of Arts (Communication) Title of thesis: Each Thought and Thing Allied: Lewis Murnford on Technics and Society Examining Committee : Chairman: Dr. Martin Laba Dr. William Leiss Professor Senior Supervisor Dr. paid Heyer Associate Professor - Prof. Liora Salter Associate Professor Dr. Stephen Straker Assistant Professor Department of History University of British Columbia External Examiner Date Approved: 25th September, 1986 ii PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a reqbest from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be a l lowed without my written permission. Title of ~hesis/Project/Extended Essay Each Thought and Thing Allied: Lewis hford on Technics and Society Author: Lynne Hissey ( name September 25, 1986 (date) ABSTRACT This thesis examines the work of Lewis Mumford (1895- ) in an attempt to assess his contribution to the study of the social history of technology. -

The Technological Imperative in Canada
The Technological Imperative in Canada R. Douglas Francis The Technological Imperative in Canada An Intellectual History © UBC Press 2009 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior written permission of the publisher, or, in Canada, in the case of photocopying or other reprographic copying, a licence from Access Copyright (Canadian Copyright Licensing Agency), www.accesscopyright.ca. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 5 4 3 2 1 Printed in Canada with vegetable-based inks on FSC-certified ancient-forest-free paper (100% post-consumer recycled) that is processed chlorine- and acid-free. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Francis, R.D. (R. Douglas), 1944- The technological imperative in Canada : an intellectual history / by R. Douglas Francis. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-7748-1650-2 1. Technology – Philosophy – History. 2. Technology – Social and ethical aspects – Canada – History. 3. Technology – Social aspects – Canada – History. 4. Technology and civilization – History. 5. Intellectuals – Canada – History. I. Title. T14.F73 2009 601 C2008-907951-5 UBC Press gratefully acknowledges the financial support for our publishing program of the Government of Canada through the Book Publishing Industry Development Program (BPIDP), and of the Canada Council for the Arts, and the British Columbia Arts Council. This book has been published with the help of a grant from the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences, through the Aid to Scholarly Publications Programme, using funds provided by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. -

Autonomous Technology Technics-Out-Of-Control As a Theme in Political Thought
Autonomous Technology Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought Langdon Winner The M!T Press Cambridg-e, Massachusetts, and London, England To my parents and Mrs. A 306.46 WIN I i0/10 First MIT Press paperback edition, 1978 Copyright© 1977 by The Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. This book was set by To the Lighthouse Press, printed in the United States of America. Library of Congress Cataloging in Publication Data Winner, Langdon Autonomous Technology. Includes Index 1. Technology-Social aspects. 2. Technology Philosophy. 3. Technocracy. I. Title. Tl4.5.W56 301.24'3 76-40100 ISBN 0-262·23078-X (hardcover) ISBN 0-262-73049-9 (paperback) 10 Contents Contents vii Preface ix Chapter 5 Artifice and Order 1 7 3 Introduction 2 The Technological Society: Groundwork 175 Technological Politics: Master and Slave Revisited 187 Chapter I Order, Discipline, and Pace 191 Autonomy and Mastery 13 Transformation and Incorporation 208 Mastery and Its Loss 18 Reverse Adaptation 226 Autonomy and Animism 30 Chapter 6 237 Chapter 2 Technological Politics Engines of Change 44 Reverse Adaptation and Control 238 Momentum and Motive 46 The Technological Imperative and the State 251 Technological Evolution 57 The Revolution and Its Tools 262 Technological Determinism 73 .,, Technological Drift: -
On Politics and Technology
Writing Technologies http://www.ntu.ac.uk/writing_technologies/index.html Review article Machinations: on Politics and Technology James Brown Writing Technologies, vol. 5 (2013), 36-54 ISSN 1754-9035 Machinations 36 Machinations: on Politics and Technology1 James Brown The Government Machine: A Revolutionary History of the Computer Jon Agar Cambridge Mass: MIT Press, 2003 576 pages, £35.95/$52.00, 978-0-262-01202-7 Consent of the Networked: The Worldwide Struggle for Internet Freedom Rebecca MacKinnon New York: Basic Books, 2012 294 pages, £11.00/$16.99, 978-0-465-06375-8 (paper) I Technology and freedom There are many discourses about technology, and little agreement about how to classify them.2 Until lately, technology has been on the periphery of social and political theory. It was most salient in the metaphor of instrumental rationality. The principal figures of the mid twentieth century in the sociopolitical analysis of technology, Lewis Mumford and Jacques Ellul, had a maverick brilliance about them that was not readily assimilated by any conventional discipline. However, the central question in their work on technology was this: is technology an historical force capable of overriding human agency?3 Neither espoused technological determinism in a straightforward way (it is hard to find anyone who does4). But they both feared that we were adopting ways of looking at the world and making choices that, in effect, endowed technology with a kind of ersatz life of its own, such that it could seem to be a force with us in its grip. In -

Technology: the Emergence of a Hazardous Concept Author(S): LEO MARX Source: Technology and Culture , July 2010, Vol
Technology: The Emergence of a Hazardous Concept Author(s): LEO MARX Source: Technology and Culture , July 2010, Vol. 51, No. 3 (July 2010), pp. 561-577 Published by: The Johns Hopkins University Press and the Society for the History of Technology Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40927986 REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article: https://www.jstor.org/stable/40927986?seq=1&cid=pdf- reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms The Johns Hopkins University Press and Society for the History of Technology are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Technology and Culture This content downloaded from 131.215.225.9 on Fri, 26 Mar 2021 19:58:13 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms ESSAYS Technology The Emergence of a Hazardous Concept LEO MARX ". the essence of technology is by no means anything technological." - Martin Heidegger1 New Concepts as Historical Markers The history of technology is one of those subjects that most people know more about than they realize. Long before the academy recognized it as a specialized field of scholarly inquiry, American schools were routinely dis- seminating a sketchy outline ofthat history to millions of pupils. -

"Technology": the Emergence of a Hazardous Concept Author(S): LEO MARX Source: Social Research, Vol
"Technology": The Emergence of a Hazardous Concept Author(s): LEO MARX Source: Social Research, Vol. 64, No. 3, Technology and the rest of culture (FALL 1997), pp. 965-988 Published by: The New School Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40971194 . Accessed: 28/06/2014 18:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The New School is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Social Research. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.106 on Sat, 28 Jun 2014 18:55:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Technology:The / Emergenceof a / Hazardous / Concept* / BY LEO MARX "... the essenceof technologyis by no meansanything technological." - Heideggeri New Conceptsas HistoricalMarkers X he historyof technologyis one of those subjectsthat most of us knowmore about thanwe realize. Long beforethe universities recognizedit as a specialized fieldof scholarlyinquiry, American public schools were routinelydisseminating a sketchyoutline of thathistory to a large segmentof the population. They taughtus aboutJames Watt and the steam engine, Eli Whitneyand the cot- ton gin,and about othergreat inventors and theirinventions, but more important,they led us to believe thattechnological innova- tion is a - probably the- major drivingforce of human history. -

Technology the Emergence of a Hazardous Concept Leo Marx
Technology The Emergence of a Hazardous Concept Leo Marx Technology and Culture, Volume 51, Number 3, July 2010, pp. 561-577 (Article) Published by The Johns Hopkins University Press DOI: 10.1353/tech.2010.0009 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/tech/summary/v051/51.3.marx.html Access Provided by Georgetown University Library at 07/05/11 2:31PM GMT 01_51.3marx 561–77:03_49.3dobraszczyk 568– 7/14/10 12:40 PM Page 561 ESSAYS Technology The Emergence of a Hazardous Concept LEOMARX “. the essence of technology is by no means anything technological.” — Martin Heidegger1 New Concepts as Historical Markers The history of technology is one of those subjects that most people know more about than they realize. Long before the academy recognized it as a specialized field of scholarly inquiry, American schools were routinely dis- seminating a sketchy outline of that history to millions of pupils. We learned about James Watt and the steam engine, Eli Whitney and the cotton gin, and about other great inventors and their inventions. Even more important, we were led to assume that innovation in the mechanic arts is a—perhaps the— driving force of human history. The theme was omnipresent in my child- hood experience. I met it in the graphic charts and illustrations in my copy of The Book of Knowledge, a popular children’s encyclopedia, and in the alluring dioramas of Early Man in the New York Museum of Natural His- tory. These exhibits represented the advance of civilization as a sequence of the inventions in the mechanic arts with which Homo sapiens gained a unique power over nature. -
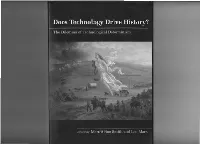
Technological Determinism in American Culture Merritt Roe Smith
© 1994 Massachusetts Institute of Technology To the memory of Dr. Bern Dibner and with thanks to David and Frances Dibner for all they have done to encourage and support the All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or study of the history of science and technology. information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. Set in Baskerville by DEKR Corporation. Printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Does technology drive history? : the dilemma of technological determinism / edited by Merritt Roe Smith and Leo Marx. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-262-19347-7-ISBN 0-262-69167-1 (pbk.) ISBN-13 978-0-262-19347-4-ISBN-13 978-0-262-69167-3 (pbk.) I. Technology-Social aspects. I. Smith, Merritt Roe, 1940-. II. Marx, Leo, 1919-. TI4.S.D64 1994 93-21422 CIP 10 9 Technological Determinism in American Culture Merritt Roe Smith In this essay, Merritt Roe Smith provides a brief history of technological determinism and shows how deeply such thought is embedded in American culture. He maintains that, as early as the 1780s, public servants like Tench Coxe began to attribute agency to the new mechanical technologies associated with the rise of the factory system. He reveals, moreover, that the technocratic spirit Coxe represented grew by leaps and bounds during the nineteenth century as the United States experienced rapid industrial expansion and gained status as a world power. -

Technology the Emergence of a Hazardous Concept
01_51.3marx 561–77:03_49.3dobraszczyk 568– 7/14/10 12:40 PM Page 561 ESSAYS Technology The Emergence of a Hazardous Concept LEO MARX “. the essence of technology is by no means anything technological.” — Martin Heidegger1 New Concepts as Historical Markers The history of technology is one of those subjects that most people know more about than they realize. Long before the academy recognized it as a specialized field of scholarly inquiry, American schools were routinely dis- seminating a sketchy outline of that history to millions of pupils. We learned about James Watt and the steam engine, Eli Whitney and the cotton gin, and about other great inventors and their inventions. Even more important, we were led to assume that innovation in the mechanic arts is a—perhaps the— driving force of human history. The theme was omnipresent in my child- hood experience. I met it in the graphic charts and illustrations in my copy of The Book of Knowledge, a popular children’s encyclopedia, and in the alluring dioramas of Early Man in the New York Museum of Natural His- tory. These exhibits represented the advance of civilization as a sequence of the inventions in the mechanic arts with which Homo sapiens gained a unique power over nature. This comforting theme remains popular today and is insinuated by all kinds of historical narrative. Here, for example, is a passage from an anthropological study of apes and the origins of human violence: Leo Marx is Senior Lecturer and William R. Kenan Professor of American Cultural His- tory Emeritus in the Program in Science, Technology, and Society at the Massachusetts Institute of Technology.