Lokale Agenda 21 Wien Landstraße
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schnellverbindungen
Schnellverbindungen . in Wien teilweise barrierefrei limited accessibility Strebersdorf Jedlersdorf U-Bahn-Linie Gerasdorf Brünner Straße S-Bahn-Linie Nußdorf Lokalbahn Wien-Baden Floridsdorf Siemensstraße Leopoldau Süßenbrunn Kundenzentrum Neue Donau der Wiener Linien Großfeldsiedlung (U3 Erdberg) Heiligenstadt Infostelle der Oberdöbling Aderklaaer Straße Wiener Linien Rennbahnweg Ticketstelle der Jäger- Kagraner Platz Wiener Linien Krottenbachstr. Handelskai Spittelau straße Park & Ride Kagran Dresdner Nußdorfer Straße Alte Donau City Airport Train Gersthof Straße Traisengasse (Eigener Tarif, Währinger Straße Kaisermühlen VIC VOR-Tickets ungültig) Volksoper Friedensbrücke Donauinsel Flughafen Wien Hernals Michelbeuern AKH Erzherzog-Karl-Straße Hirschstetten (Eigener Tarif) Franz- Roßauer Lände Josefs- Alser Straße Vorgartenstraße Vienna International Bahnhof Hausfeldstraße Aspern Nord Busterminal Taborstraße Schottenring Messe Ottakring Josefstädter Prater- Prater Aspernstraße Straße Nestroypl. Kendlerstraße stern Schottentor Hardeggasse Hütteldorfer Thaliastraße Krieau Seestadt Straße Schwedenplatz Donauspital Stadlau John- Breitensee straße Burggasse Rathaus Stadion Stadthalle Donaustadt- brücke Schwegler- straße Zieglerg. Herrengasse Stubentor Landstraße Penzing Westbahnhof (Bhf. Wien Mitte) Volks- Donaumarina theater Rochusgasse Stephansplatz Neubaug. Kardinal-Nagl-Platz Gumpendorfer Museums- Straße quartier Schlachthausgasse Purkersdorf-SanatoriumWeidlingauHadersdorfWolf in der Au Erdberg Praterkai Braunschweig- Margareten- Karlsplatz -

How-To Find Us
How-to find us Local Public Transport Train Airplane Car GPS DATA Oregano Systems 48° 11.330‘ N, 16° 24.843‘ E Design & Consulting GesmbH A Meinberg Company Franzosengraben 8 A-1030 Vienna, Austria phone +43 (676) 84 31 04–200 +43 (676) 84 31 04–300 fax +43 (1) 253 30 33–6162 mail [email protected] www.oreganosystems.at LOCAL PUBLIC TRANSPORT Vienna Subway: line U3, leave at station Erdberg Oregano Systems office is in walking distance (less than 5 minutes) TRAIN Arriving at Westbahnhof Vienna Subway: line U3 (direction Simmering) leave at station Erdberg (see figure above) Duration app. 25 min. Arriving at Vienna Hauptbahnhof (main station) S-Bahn (local train, any train direction Floridsdorf is ok), leave at station WIEN MITTE / Landstraße change to Subway: line U3, leave at station Erdberg (see figure above) Duration app. 25 min. page 2 AIRPLANE – VIENNA AIRPORT Vienna CAT – City Airport Train Follow the green signs for CAT at the airport. There are ticket machines at the platform, a single trip costs EUR 12,–. The CAT is a NON-STOP-TRAIN to the city and takes you to station WIEN MITTE / Landstraße change to Subway: line U3, leave at station Erdberg (see above) Duration app. 25 min. S-Bahn „S7“ Follow the blues signs for S-Bahn at the airport. There are ticket machines before the platform, a single trip costs app. EUR 6,–. Take the S-Bahn train S7 to the city center, exit at station WIEN MITTE / Landstraße change to Subway: line U3, leave at station Erdberg (see above) Duration app. -
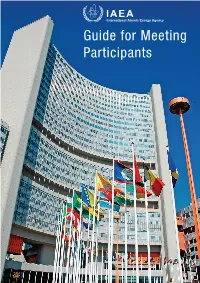
Guide to the Vienna International Centre
2010-07-13 09:54:38 Guide for Meeting Participants Heiligenstadt Spittelau Jägerstraße Handelskai Floridsdorf Ottakring Friedensbrücke Nußdorfer Straße Dresdner Straße Neue Donau VIC Kendlerstraße Schottenring Taborstraße Vorgartenstraße Kaisermühlen Kagran Rennbahnweg Großfeldsiedlung Hütteldorfer Straße Roßauer Lände Michelbeuern Währinger Straße AKH Volksoper Praterstern Donauinsel Alte Donau Kagraner Aderklaaer Leopoldau Platz Straße Schottentor Schwedenplatz Josefstädter Straße Alser Straße Johnstraße Universität Messe Prater Krieau Stadion Rathaus Burggasse Nestroyplatz Stadthalle Thaliastraße Schweglerstraße Stephansplatz Zieglergasse Kardinal-Nagel-Platz Erdberg Zippererstraße Simmering Westbahnhof Volkstheater City Landstraße Ober St. Veit Braunschweiggasse Schönbrunn Herrengasse Gumpendorfer Neubaugasse Stubentor Rochusgasse Schlachthausgasse Gasometer Enkplatz Straße Museumsquartier Unter St. Veit Hietzing Meidling Hütteldorf Längenfeldgasse Hauptstraße Stadtpark Pilgramgasse Karlsplatz Siebenhirten Erlaaer Straße Am Schöpfwerk Philadelphiabrücke Südtiroler Platz Reumannplatz Margaretengürtel Kettenbrückengasse Perfektastraße Alterlaa Tscherttegasse Niederhofstraße Taubstummengasse Keplerplatz 10-25331_Guide for Meeting Participants_cover.indd 1 10-25331 10-25331_Guide for Meeting Participants_cover.indd 2 2010-07-13 09:55:02 C O N T E N T S THE VIENNA INTERNATIONAL CENTRE (VIC)............................................ 3 HOW TO REACH THE VIC............................................................................ 3 MEETING -

Stadt Tlwien
I ~ P~ Mobil in Wien stsdtentwicklung StaDt tlWien TRANSPORT MASTER PLAN VIENNA 2003 Abridged Version Pl oßfloett iey' th(e ettitt Of tide ccC'eflffil Clip c-"ccflnflll. -'iticiilccn Ol f 4ehctflf Of tlie V! "Inl" C! c, fi)c ACII I I! Iifetteifoli Viifniofp'fl Depcfrcf!~ 'nt IB- Ul'belt f DeCelopltienf. enCJ Llti)cen PfenninCI Tr 'nepoct Pf'!Ifnfftg anci Rc'ctlc&ne! Development Seonon "003 Imprint: Owner and Publisher Stadtentwicklung Wien, Magistratsabteilung 18 info@m18. magwien. gvat Responsible for the contents: Dl Sigrid Oblak, MA 18 ohl@m18. magwien. gvat Technical coordination: ECHO Werbeagentur GmbH Design Isabella Posch, ECHO Werbeagentur GmbH Lectorate ECHO Werbeagentur GmbH Dl Signd Oblak, MA 18 Translation. eurocom Translation Services GmbH Pictures: Wiener Hafen, Bildarchiv MA 18 Pnnt. AV Druck Pc Vienna 2003 IS8N: 3-902015-58-6 Mobil in Wien ~ ~ / ~ g f ' Contents , Introduction 1. Starting Position 2. Transport policy model . 10 3. Mobility . 14 4. Traffic safety 5. The road network and public spaces . 20 6. Pedestrian traffic .22 7. Cycle traffic . 24 8. Public transport 26 9. Motorised indiwdual transport . 29 10. Stationary vehicles . 31 11. Shipptng . 33 12 Air transport .34 13. Mobility management . 36 14. Awareness raising . 38 15. Steering instruments . 39 16. Measunng and managing success .40 17. Effects of the programm of measures .41 18. Priorities, financing .42 Appendix .45 List of illustrations and tables . 52 Staff . 53 a ~ ~ Mobil in Wien ~ ~ ( ~ g f Introduction The last Vienna transport concept was declded on in 1994 Many measures have been imple- mented, for instance parking space management and the further expansion of the U-Bahn and cycle tracks However, many of the underlying conditions have also changed significantly since 1994, and therefore it is time for a new plan the Transport Master Plan Vienna 2003. -

Schnellverbindungen in Wien
U-Bahn-Linie Strebersdorf S-Bahn-Linie Jedlersdorf Lokalbahn Wien-Baden Gerasdorf Brünner Straße City Airport Train Nußdorf (Eigener Tarif, VOR-Tickets ungültig) Floridsdorf Siemensstraße Leopoldau Süßenbrunn Vienna International Neue Donau Busterminal Großfeldsiedlung Heiligenstadt Kundenzentrum Aderklaaer Straße der Wiener Linien Oberdöbling (U3 Erdberg) Rennbahnweg Infostelle der Krottenbachstr. Jäger- Kagraner Platz Wiener Linien Handelskai Spittelau straße Kagran Ticketstelle der Dresdner Wiener Linien Nußdorfer Straße Alte Donau Gersthof Straße Traisengasse Park & Ride Währinger Straße Kaisermühlen VIC Volksoper Friedensbrücke Donauinsel Hernals Michelbeuern AKH Roßauer Lände Hirschstetten Franz- Erzherzog- Josefs- Alser Straße Vorgartenstraße Karl-Straße Hausfeld- Aspern Nord Bahnhof Taborstraße straße Schottenring Messe Ottakring Josefstädter Prater- Prater Aspernstraße Straße Nestroypl. Kendlerstraße stern Schottentor Hardeggasse Hütteldorfer Thaliastraße Krieau Seestadt Straße Schwedenplatz Donauspital Stadlau John- Breitensee straße Burggasse Rathaus Stadion Stadthalle Donaustadt- brücke Schwegler- straße engasse Zieglerg. Herr Stubentor Landstraße Penzing Westbahnhof (Bhf. Wien Mitte) Volks- Donaumarina theater Rochusgasse Stephansplatz Neubaug. Kardinal-Nagl-Platz Gumpendorfer Museums- eidlingau olf in der Au eit Straße quartier Schlachthausgasse Purkersdorf-SanatoriumW HadersdorfW eten- Erdberg Praterkai Braunschweig- Margar Karlsplatz Unter St. V gasse gürtel Stadt- park Gasometer eit Zipperer- straße Hietzing Pilgram-gasse -

Liniennetz-Ostregion.Pdf
Nahverkehr Ostregion Praha/Tábor Jihlava České Budějovice Břeclav Brno Ostrava Praha REX 3 Znojmo Znojmo REX 2 2 Laa a.d. Thaya České Velenice Znojmo-Nový Šaldorf Břeclav Pürbach-SchremsHirschbachVitis SchwarzenauAllentsteigGöpfritz Irnfritz Hötzelsdorf-Geras Kottingneusiedl REX 41 Šatov REX 1 REX 41 R 44 Bernhardsthal Gmünd NÖ Sigmundsherberg Unterretzbach Staatz Breiteneich bei Horn REX 3 Retz Enzersdorf bei Staatz Rabensburg Horn Eggenburg Zellerndorf Frättingsdorf Rosenburg Platt Hohenau Stallegg Hörersdorf Limberg-Maissau Guntersdorf Kamegg Drösing Hetzmannsdorf-Wullersdorf Siebenhirten NÖ Gars-Thunau Ziersdorf Mistelbach Stadt Sierndorf/March Buchberg 3 Hollabrunn Breitenwaida Plank am Kamp Großweikersdorf 2 Mistelbach Jedenspeigen Göllersdorf Altenhof Paasdorf Dürnkrut Stiefern Schönborn-Mallebarn Ladendorf Schönberg am Kamp Höbersdorf Neubau-Kreuzstetten Stillfried Zöbing Sierndorf Niederkreuzstetten Angern Langenlois Ober Olberndorf Absdorf- Hautzendorf Gobelsburg Hippersdorf Gaisruck Hausleiten Etsdorf-StraßWagram-GrafeneggFels Kirchberg am Wagram Stockerau 3 4 Schleinbach Tallesbrunn Hadersdorf am Kamp 4 Spillern Ulrichskirchen Gedersdorf Leobendorf-Burg Kreuzenstein Wolkersdorf Weikendorf-Dörfles Rohrendorf 2 Obersdorf Linz Korneuburg Krems a.d.Donau 3 Bisamberg Seyring Gänserndorf 1 REX 4 Langenzersdorf Kapellerfeld Silberwald St. Valentin R 53 Strebersdorf Strasshof Furth-Palt Tulln Langenlebarna.d. DonauMuckendorf-WipfingZeiselmauer-KönigstettenSt. Andrä-WördernGreifenstein-AltenbergHöflein a.d. Donau Jedlersdorf Gerasdorf -
Bahnnetz Wien / Railway Network Vienna Stand: Dezember 2020
Bahnnetz Wien / Railway network Vienna Stand: Dezember 2020 REX3 REX2 3 Strebersdorf 2 7 REX 4 4 Jedlersdorf REX1 REX 41 Brünner Straße Gerasdorf R1 SiemensstraßeSiemensstraße Leopoldau 40 1 Süßenbrunn S-Bahnstrecke Floridsdorf – R40 Meidling Stammstrecke„“ (S1, S2, S3, S4, REX1, REX2, REX3, REX9) u. Nußdorf Neue Donau Teilstrecke Floridsdorf - Rennweg Großfeldsiedlung Deutsch- (S7, REX7) mit dichten Intervallen Heiligenstadt Floridsdorf Wagram Suburban train service Floridsdorf – 7 Aderklaaer Straße Meidling (lines S1, S2, S3, S4, REX1, Oberdöbling REX2, REX3, REX9), in addition to REX7 line S7 and REX7 between Rennweg Rennbahnweg and Floridsdorf, with frequent Dresdner REX9 services Straße Handelskai Kagraner Platz CJX5 Krottenbach- Spittelau S-Bahnstrecke straße 45 Kagran 45 Hütteldorf – Handelskai Nußdorfer Straße „Vorortelinie“ Jäger- Traisengasse (S45) mit dichten straße Alte Donau Intervallen Währinger Straße- Suburban train Volksoper Kaisermühlen-VIC R81 service Hütteldorf – Gersthof Friedensbrücke 80 Handelskai (line S45) Michelbeuern- Hirschstetten REX8 with frequent services AKH 40 Donauinsel Roßauer Lände REX41 U-Bahn-Linie Endstation R40 REX4 Vorgartenstraße Underground line terminus Hernals Franz-Josefs-Bahnhof Aspern Alser Straße Schottenring Taborstraße Praterstern Erzherzog- Hausfeldstraße Schottenring Karl-Straße Nord 40 S-Bahn-Linie Endstation Aspernstraße Suburban train terminus Ottakring Josefstädter Nestroy- Kendlerstraße Straße platz Messe-Prater Hardeg- R Regionalzug Endstation gasse Regional train terminus Hütteldorfer -

Austria by Darwin Porter & Danforth Prince
06_92265x ch01.qxp 8/21/06 9:47 PM Page 47 1 Austria by Darwin Porter & Danforth Prince Austria stands at the crossroads of The country offers plenty to do, from Europe, as it did in the heyday of the Aus- exploring historic castles and palaces to tro-Hungarian Empire. Its capital, Vienna, skiing on some of the world’s finest alpine stranded during the postwar years on the slopes. edge of western Europe, is taking its place again as an important international city. 1 Vienna £ Vienna still retains much of the glory and grandeur of the empire’s heady days. Museum treasures from all over Europe, baroque palaces through which Maria Theresa and her brood wandered, Johann Strauss’s lively music, Gustav Klimt’s paint- ings, the concert halls, the unparalleled opera—it’s all still here, as if the empire were still flourishing. Tourism is growing as thousands arrive every year to view Vienna’s great art and architecture, to feast on lavish Viennese pastries, to explore the Vienna Woods, to sail down the Danube, to attend Vienna’s balls, operas, and festivals, and to listen to the “music that never stops.” Visitors today face a newer and brighter Vienna, a city with more joie de vivre and punch than it’s had since before the war. There’s also a downside: Prices are on the rise—they haven’t reached the height of the Ferris wheel at the Prater, but they’re climbing there. ESSENTIALS GETTING THERE By Plane Vienna International Airport (VIE; & 01/70070; http://english.viennaairport.com) is about 19km (12 miles) southeast of the city center. -

Business in Best Location
BUSINESS IN BEST LOCATION The name ORBI derives from the Latin word “orbis”. It means a circle, disc or globe. The ORBI Tower is the ideal location to perceive or conquer the world from Vienna. St. Stephen’s Central Station Vienna Mariahilfer Strasse Cathedral St. Stephen’s Viennese Giant Vienna International Cathedral Ferry Wheel Centre Prater recreation area Vienna International Bratislava Airport EDITORIAL Ernst Machart Urs Waibel The successful office real estate project TownTown is reaching the ultimate stage: So far, gross floor space of 108,000 sq. m. has been implemented and leased out or sold 100 per cent. The new ORBI Tower is the last module of this impressive project. The geometric shape of the ORBI Tower combines three demands: • It has appealing and attractive aesthetics. • It ensures optimal use of the available space. • It is the basis for the economy and efficiency of the building. Much more: The sophisticated building control system reduces the running operational costs, pro- vides comfortable room climate and lays the foundation stone for a high level of work productivity. THE BEST LOCATION TownTown is the best conceivable location for your new office in Vienna: The infrastructure with its catering facilities and shopping opportunities, as well as the proximity to the Prater recreation area and the green centerline of the Donaukanal (Danube Channel) already covers the most important requirements of more than 4,000 people engaged in TownTown. Thanks to the optimal connection to the public transport, your future office is located in the city center: Stephansplatz (the heart of Vienna) or Mariahilfer Strasse (the biggest shopping street in Vienna) are only a few minutes away by metro. -
Ticket-Info Südtiroler Platz, Hbf
Ticketstellen Infostellen Mo. – Fr. (werkt.) Mo. – Fr. Sa., So. und Fei. – . – . – . – . Bahnhof Meidling Floridsdorf Hietzing Kagran Karlsplatz Landstraße Ottakring Praterstern Reumannplatz Schottentor Spittelau Stephansplatz Ticket-Info Südtiroler Platz, Hbf. Westbahnhof Sammeln Sie Ihre persönlichen Ticket-Infos TICKETS WELCHES TICKET? WO ERHÄLTLICH? Der richtige Fahrschein, WienMobil-Karte der passende Tarif WienMobil-Karte für SeniorInnen Jahreskarte Jahreskarte für SeniorInnen Die Wiener Linien sind die erste Adresse für Mobilität in der TOP-Jugendticket Millionenstadt Wien. Wir bauen und betreiben das Netz von U-Bahn, Autobus und Straßenbahn in der Stadt und sorgen Jugendticket dafür, dass jeden Tag 2,5 Millionen Passagiere rasch, sicher Semesterkarte und bequem an ihr Ziel kommen. Ferien-Monatskarte Monatskarte Die Mobilitätsbedürfnisse unserer vielen KundInnen sind Monatskarte für sehr unterschiedlich. Darum bieten wir ein breites Spektrum Mobilpass-InhaberInnen an Fahrscheinen an, aus dem jeder Fahrgast das passende 8-Tage-Klimakarte Ticket wählen kann. Unsere Produktpalette reicht dabei von der WienMobil-Karte, die Ihnen zusätzlich zur Öffi -Jahres- Wochenkarte karte die Nutzung vieler ergänzender Mobilitätsdienstleis- „72 Stunden Wien“-Karte tungen ermöglicht, bis hin zum klassischen Einzelfahrschein. „48 Stunden Wien“-Karte Egal, ob Sie in Wien leben oder auf Besuch in der Stadt sind, „24 Stunden Wien“-Karte Sie werden das passende Ticket für Ihre Ansprüche nden. Day-Ticket Alle Informationen zu den verschiedenen Fahrscheinen Wiener Einkaufskarte nden Sie in den jeweiligen Ticket-Foldern. Single-Ticket Stellen Sie sich Ihre Ticket-Infomappe nach Ihrem persön- Einzelfahrschein lichen Bedarf zusammen. Unsere MitarbeiterInnen helfen Einzelfahrschein ermäßigt Ihnen dabei gerne! Einzelfahrschein (ermäßigt) im Fahrzeug Hinweis: SeniorInnentarif gültig ab dem vollendeten Zwei-Fahrten-Fahrschein 62. Lebensjahr. -

Ticket-Info Südtiroler Platz, Hbf
Ticketstellen Infostellen Mo.–Fr. (werkt.) Mo.–Fr. (werkt.) Sa., So. und Fei. 6:30–18:30 6:30–18:30 8:30–16:00 9:00–17:00 Bahnhof Meidling Floridsdorf Hietzing Kagran Karlsplatz Landstraße Ottakring Praterstern Reumannplatz Schottentor Spittelau Stephansplatz Ticket-Info Südtiroler Platz, Hbf. Westbahnhof DAS KUNDENZENTRUM DER WIENER LINIEN Wien 3, Erdbergstraße 202 (U3-Station Erdberg) Mo.–Fr. (werktags): 8:00–15:00 Uhr Do. (werktags) auch: 15:00–17:30 Uhr WIENER LINIEN SERVICETELEFON 01 / 7909 100 Mo.–Fr. (werkt.) 6:00–22:00 Uhr; Sa., So., Fei. 8:00–17:00 Uhr E-MAIL [email protected] ONLINE-TICKETS WienMobil-App shop.wienerlinien.at Sammeln Sie VERKEHRSVERBUND OST-REGION Servicetelefon: 01 / 7909 100 Servicetelefon: VOR-Hotline 0810 22 23 24 Ihre persönlichen VOR-Mail [email protected] Ticket-Infos Nähere Informationen zu Tarifbestimmungen und Beförde- rungsbedingungen finden Sie unter www.wienerlinien.at. TICKETS WELCHES TICKET? WO ERHÄLTLICH? Die richtige Fahrkarte, Jahreskarte der passende Tarif Jahreskarte für SeniorInnen Top-Jugendticket Jugendticket Die Wiener Linien sind die erste Adresse für Mobilität in der Semesterkarte Millionenstadt Wien. Wir bauen und betreiben das Netz von Ferien-Monatskarte U-Bahn, Autobus und Straßenbahn in der Stadt und sorgen dafür, dass jeden Tag 2,5 Millionen Passagiere rasch, sicher Monatskarte und bequem an ihr Ziel kommen. Monatskarte für Mobilpass-InhaberInnen Die Mobilitätsbedürfnisse unserer vielen KundInnen sind 8-Tage-Klimakarte sehr unterschiedlich. Darum bieten wir ein breites Spektrum Wochenkarte an Fahrkarten an, aus dem jeder Fahrgast das passende Ticket 72 Stunden WIEN wählen kann. Unsere Produktpalette reicht dabei von der Jahreskarte bis zur klassischen Einzelkarte. -

We Stand for Office
We stand for Office Office Market Report Vienna |Spring 2018 We stand for real estate. Preface In 2018 the Vienna office market will see the strongest production of new office space in more than ten years. This development will bring new impulses for both the letting and investment markets and also create interesting perspectives. The completion of high-quality new construction projects will continue to stimulate the interest of potential tenants in new office locations and set the stage for further successful lettings. This favourable climate will also benefit the investment market, which remains very popular with international investors. Michael Ehlmaier FRICS Our experienced EHL team is pleased to help you develop the best real estate Managing Partner strategy or identify the property that perfectly fits your needs! Yours, EHL — the office specialist The EHL Real Estate Group has been one of the leading providers of property services in Austria for many years. We offer a complete range of real estate services throughout the entire property life-cycle as well as a successful international network. “We are seeing a greater focus on urbanity, flexibility and services in location decisions. Our office experts at EHL are pleased to provide you with comprehen- Stefan Wernhart MRICS sive and structured advice for the lease of the right office space!“ Head of Commercial Properties [email protected] EHL Market Reports EHL market reports are updated regularly and provide a comprehensive evaluation and overview of the real estate market. “Indicators for office space demand in 2018 point towards a further strong year- on-year increase in momentum.