Dokorarbeit 06.04.2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Immersion Into Noise
Immersion Into Noise Critical Climate Change Series Editors: Tom Cohen and Claire Colebrook The era of climate change involves the mutation of systems beyond 20th century anthropomorphic models and has stood, until recent- ly, outside representation or address. Understood in a broad and critical sense, climate change concerns material agencies that im- pact on biomass and energy, erased borders and microbial inven- tion, geological and nanographic time, and extinction events. The possibility of extinction has always been a latent figure in textual production and archives; but the current sense of depletion, decay, mutation and exhaustion calls for new modes of address, new styles of publishing and authoring, and new formats and speeds of distri- bution. As the pressures and re-alignments of this re-arrangement occur, so must the critical languages and conceptual templates, po- litical premises and definitions of ‘life.’ There is a particular need to publish in timely fashion experimental monographs that redefine the boundaries of disciplinary fields, rhetorical invasions, the in- terface of conceptual and scientific languages, and geomorphic and geopolitical interventions. Critical Climate Change is oriented, in this general manner, toward the epistemo-political mutations that correspond to the temporalities of terrestrial mutation. Immersion Into Noise Joseph Nechvatal OPEN HUMANITIES PRESS An imprint of MPublishing – University of Michigan Library, Ann Arbor, 2011 First edition published by Open Humanities Press 2011 Freely available online at http://hdl.handle.net/2027/spo.9618970.0001.001 Copyright © 2011 Joseph Nechvatal This is an open access book, licensed under the Creative Commons By Attribution Share Alike license. Under this license, authors allow anyone to download, reuse, reprint, modify, distribute, and/or copy this book so long as the authors and source are cited and resulting derivative works are licensed under the same or similar license. -

The Watts Towers from Eyesore to Icon: Race and the Spaces of Outsider Art
The Watts Towers from Eyesore to Icon: Race and the Spaces of Outsider Art By Emma R. Silverman A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History of Art and the Designated Emphasis in Women, Gender, and Sexuality in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Julia Bryan-Wilson, Chair Professor Margaretta M. Lovell Professor Darcy Grimaldo Grigsby Professor Charles L. Briggs Summer 2018 Abstract The Watts Towers from Eyesore to Icon: Race and the Spaces of Outsider Art by Emma R. Silverman Doctor of Philosophy in History of Art and the Designated Emphasis in Women, Gender and Sexuality University of California, Berkeley Professor Julia Bryan-Wilson, Chair Starting around 1921, Sabato (Sam) Rodia (1879–1965) began to build an unusual environment in his backyard in the Watts neighborhood of Los Angeles. Although he had no formal training in art or architecture, Rodia used concrete-covered steel embellished with intricate mosaics of tile, shell, and glass to create a series of elaborate sculptures, including three central towers that rise nearly one hundred feet in height. For over three decades Rodia’s creation received scant public recognition, and in 1954 Rodia left Los Angeles, never to return. The story of how a single individual worked alone to create such a monumental structure is awe-inspiring; however, the life the site took on after Rodia’s departure is equally remarkable. In the postwar period California’s perceived provinciality relegated it to the fringes of the New York-centered art world. -
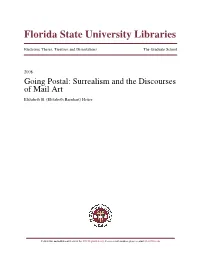
Florida State University Libraries
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2008 Going Postal: Surrealism and the Discourses of Mail Art Elizabeth B. (Elizabeth Barnhart) Heuer Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF VISUAL ART, THEATRE AND DANCE GOING POSTAL: SURREALISM AND THE DISCOURSES OF MAIL ART By ELIZABETH B. HEUER A Dissertation submitted to the Department of Art History in partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2008 Copyright © 2008 Elizabeth B. Heuer All Rights Reserved The members of the Committee approve the Dissertation of Elizabeth B. Heuer defended on September 26, 2008. __________________________ Karen A. Bearor Professor Directing Dissertation __________________________ Neil Jumonville Outside Committee Member __________________________ Adam Jolles Committee Member __________________________ Roald Nasgaard Committee Member Approved: ______________________________________________________ Richard K. Emmerson, Chair, Department of Art History ______________________________________________________ Sally E. McRorie, Dean, College of Visual Arts, Theatre and Dance The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii ACKNOWLEDGMENTS I wish to extend my sincerest thanks to all of the faculty and staff of the Department of Art History at Florida State University. I am very thankful for the generous financial support I received during the years of my course work and in the research and writing of this dissertation. I am especially indebted to Karen A. Bearor, the chair of my dissertation committee, for her guidance, patient advice, and encouragement throughout my graduate work. Special thanks to Neil Jumonville whose teaching has enriched my approach to the discipline of art history. -

An Inquiry Into Surrealism in The
LANDSCAPES OF REVELATION: AN INQUIRY INTO SURREALISM IN THE LANDSCAPE by MICAH S. LIPSCOMB (Under the Direction of Judith Wasserman) ABSTRACT This thesis explores landscapes in which visitors can become emotionally and perceptually disoriented and imagine they are in a dream-like space. The surreal landscapes discussed range from an Italian Renaissance garden, to contemporary landscapes designed by professionals, to environments created by visionary artists. These diverse landscapes share elements of the art and literary movement of surrealism, especially their goal of eliciting revelations. The purpose of this thesis is three-fold: first, to analyze the techniques and forms that help create a surreal landscape; second, to elucidate the relationship between surrealism and landscape architecture; and third, to demonstrate the relevance of some of the ideas of surrealism to contemporary landscape architecture. INDEX WORDS: Surrealism, Landscape Architecture, Visionary Art Environments, Labyrinths, Grottoes, Walled Gardens, Andre Breton, Martha Schwartz, Geoffrey Jellicoe LANDSCAPES OF REVELATION: AN INQUIRY INTO SURREALISM IN THE LANDSCAPE by MICAH S. LIPSCOMB B.A., Eckerd College, 1997 A Thesis Submitted to The University of Georgia Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTERS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ATHENS, GEORGIA 2003 ©2003 Micah S. Lipscomb All Rights Reserved LANDSCAPES OF REVELATION: AN INQUIRY INTO SURREALISM IN THE LANDSCAPE by MICAH S. LIPSCOMB B.A., Eckerd College, 1997 Major Professor: Judith Wasserman Committee: Ian Firth Henry Parker Art Rosenbaum Electronic Version Approved: Maureen Grasso Dean of the Graduate School The University of Georgia May 2003 DEDICATION To my wife, Suzannah, for her love and unwavering support during my education. -

Preserving America's Folk Art Environments
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Theses (Historic Preservation) Graduate Program in Historic Preservation 1996 Fixing Dreams: Preserving America's Folk Art Environments Jay Laurence Platt University of Pennsylvania Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/hp_theses Part of the Historic Preservation and Conservation Commons Platt, Jay Laurence, "Fixing Dreams: Preserving America's Folk Art Environments" (1996). Theses (Historic Preservation). 375. https://repository.upenn.edu/hp_theses/375 Copyright note: Penn School of Design permits distribution and display of this student work by University of Pennsylvania Libraries. Suggested Citation: Platt, Jay Laurence (1996). Fixing Dreams: Preserving America's Folk Art Environments. (Masters Thesis). University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/hp_theses/375 For more information, please contact [email protected]. Fixing Dreams: Preserving America's Folk Art Environments Disciplines Historic Preservation and Conservation Comments Copyright note: Penn School of Design permits distribution and display of this student work by University of Pennsylvania Libraries. Suggested Citation: Platt, Jay Laurence (1996). Fixing Dreams: Preserving America's Folk Art Environments. (Masters Thesis). University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. This thesis or dissertation is available at ScholarlyCommons: https://repository.upenn.edu/hp_theses/375 UNIVERSITY^ PENNSYL\^^NL\ UBKARIES FIXING DREAMS PRESERVING AMERICA'S FOLK ART ENVIRONMENTS Jay Laurence Piatt A THESIS in Historic Preservation Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE 1996 A(ML rvisor Reader David G. De Long Christa Wilmanns-Wells Professor of Architecture Lecturer in Historic Preservation Graduate Group Chair i Frank G. -

On Organizing the Labor of Artists
Black Blac Bla Bl B Re: Invitation to contribute a text to the journal Blackout Dear ____________, We are sitting here at ECAV in our current working place, which is the salle de réunion at the administration. Our fingers are typing this letter to invite you to contribute a text within the Art Work(ers) research project. We are thinking about how closing factories and the use of industrial ruins have affected our ways of working in the arts, and of the promises of creative economies. What narratives have been created to tell stories of art and industrial production as well as of deindustrialisation. Besides looking at historical examples such as EAT, Artist Placement Group, Equipo 57 & Grupo Y, Solidarnos & Ryszand Wasko, or Agricola Cornelia, whose work emerges in between art and (industrial) production modes, we are thinking of perruques (homers) and strategies to “reinterpret” the Taylorist use of machines with Situationist strategies. The question that we have in mind is less “why X has happened” but rather “why the alternatives Y did not take place”. Two sites have become particularly important during the research: Chippis (site of the former Aluminium factory, today Constellium) and Ivrea (site of the type- writing machine factory Olivetti). How differently two factories have shaped the cities, societies and cultural scenes in which they were situated with their idea of labour. 1 In our research, we observed the Blackout 0: Art Labour will be phrased involvement of artists and writers in the around the following contents: production of experimental publishing within industrial projects. Among them, 3 Editorial: Invitation to Contribute a Text poets such as Leonardo Sinisgalli would start the monthly magazine Civiltà delle 5 Two Paradoxes, One Reversal and an macchine (1953–79), while art historian Carlo Impasse: On Organizing the Labor of Ludovico Ragghianti initiated SeleARTE Artists (1952–65). -
DAVID PATRICK KELLY Outsider Architecture and Historic Preservation (Under the Direction of MARK EDWARD REINBERGER)
DAVID PATRICK KELLY Outsider Architecture and Historic Preservation (Under the Direction of MARK EDWARD REINBERGER) Outsider architecture is a type of architecture that features unique designs made by builders with no formal training. Outsider architecture also functions as the physical/architectural manifestation of the ideology of its builder, which is more often than not “eccentric” by conventional standards. What constitutes outsider architecture is of issue in this thesis, as is the history of outsider architecture and the historic preservation movement that accompanies it. This thesis also suggests ways to improve the outsider architecture preservation situation, and to use outsider architecture as a tool in improving both social welfare and the built environment. INDEX WORDS: Outsider architecture, Historic preservation, Amateur building, Simon Rodia, Pasaquan, Bottle houses, Eccentrics OUTSIDER ARCHITECTURE AND HISTORIC PRESERVATION by DAVID PATRICK KELLY B.A., The University of South Carolina, 1992 M. AS., The University of Alabama, 1998 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF HISTORIC PRESERVATION ATHENS, GEORGIA 2001 2001 David Patrick Kelly All Rights Reserved OUTSIDER ARCHITECTURE AND HISTORIC PRESERVATION by DAVID PATRICK KELLY Approved: Major Professor: Mark Reinberger Committee: Pratt Cassity Megan Bellue Henry Parker Electronic Version Approved: Gordhan L. Patel Dean of the Graduate School The University of Georgia December 2001 DEDICATION This thesis is dedicated to Erik Satie and Olivier Messiaen, whose music saw me through many unfulfilling hours at the computer keyboard. iv ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank Mark Reinberger, Pratt Cassity, Megan Bellue, and Henry Parker, the good folk who make up my thesis committee, for indulging me in some off- the-wall subject matter. -

Artichoke House George Charman
Artichoke House George Charman 1 2 3 4 Contents George Charman / p. 4 -15 Artichoke House Marsha Bradfield & Lucy Tomlins / p. 18-27 Both in Progress: Artichoke House and a Typology of Sculpture Sharon-Michi Kusunoki / p. 30-41 Edward James and the Poetry of the Imagination John Warren / p. 44-49 Notes and Sketches David R J Stent / p. 50-57 The Pavilions of Xilitla 5 Artichoke House George Charman 4 I first encountered the sketch for ‘Artichoke House’ while wandering along the purple landing above the Oak Hall in Edward James’s family home at West Dean, now West Dean College. The sketch, sandwiched between Salvador Dalí’s Mae West Lips Sofa (1938) (commissioned by James for Monkton House) and Leonora Carrington’s Sketches of the Sphinx (1966), firmly locates Artichoke House within the Surrealist idiom that was James’s life. My project started life as an idea for a mould of an object that never existed, taking inspiration from James’s original design for ‘Artichoke House’ and from the mould-making technique of ‘shuttering’ (wooden planks or strips used as a temporary structure to contain setting concrete) that James employed in the construction of his monumental concrete forms in Xilitla, Mexico. I developed a series of drawings playing on the idea that James’s design for ‘Artichoke House’ was the mould by which Xilitla was cast. As well as highlighting the role of Edward James as a significant contributor to the history of surrealist architecture, Artichoke House aims to explore how the pavilion in its many modes of existence—as idea, image and object—encourages us to see anew. -

Facteur Cheval
Ferdinand Cheval 1836 / 1924 Le rêve de pierres du facteur Cheval Joseph Ferdinand Cheval , plus connu sous le nom de facteur Cheval , né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse , mort le 19 août 1924 à Hauterives , dans la Drôme, est un facteur français célèbre pour avoir passé 33 ans de sa vie à édifier un palais qui se nomme « Palais idéal » et huit années supplémentaires à bâtir son propre tombeau , tous deux considérés comme des chefs-d'œuvre d' architecture naïve . « Après avoir terminé mon Palais de rêve à l'âge de 77 ans et 33 ans de travail opiniâtre, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la paroisse. Là encore, j'ai travaillé huit années d'un dur labeur, j'ai eu le bonheur d'avoir la santé pour achever à l'âge de 86 ans le “Tombeau du Silence et du Repos sans fin” ». Ferdinand Cheval . Reconnaissance Au début des années 1930, Ferdinand Cheval reçoit le soutien moral de plusieurs artistes tels que Pablo Picasso et André Breton . Max Ernst qui séjourne en Ardèche durant l'occupation est fasciné par l'œuvre et lui dédie un de ses tableaux ( « Le Facteur Cheval »). André Malraux appuie la procédure de classement au titre des monuments historiques avant son départ du gouvernement ; il déclare pour sa part qu'il considère le Palais idéal comme « le seul représentant en architecture de l'art naïf (…) Il serait enfantin de ne pas classer quand c'est nous, Français, qui avons la chance de posséder la seule architecture naïve du monde et attendre qu'elle se détruise … » . -

Exhibitions of Outsider Art Since 1947
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 9-2017 Exhibitions of Outsider Art Since 1947 Christina McCollum The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2393 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] EXHIBITIONS OF OUTSIDER ART SINCE 1947 by CHRISTINA MCCOLLUM A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2017 © 2017 CHRISTINA MCCOLLUM ii All Rights Reserved Exhibitions of Outsider Art Since 1947 by Christina McCollum This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ ____________________________________ Date Romy Golan Chair of Examining Committee _________________________________ ____________________________________ Date Rachel Kousser Executive Officer Supervisory Committee: Mona Hadler Katherine Manthorne Kent Minturn iii THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK ABSTRACT Exhibitions of Outsider Art Since 1947 by Christina McCollum Advisor: Romy Golan The search for a “raw art,” untouched by the corrupting effects of culture, led Jean Dubuffet and others to collect, under the heading Art Brut [Outsider art], art made by the mentally ill and otherwise disenfranchised, poor, uneducated, elderly, and/or physically disabled. Since Dubuffet’s codification of Art Brut around 1945, the Outsider has been identified by cultural isolation, mental distance and a requisite discovery by some cultural insider, paternal or exploitative. -

Creation Outside of the Norms
LA LETTRE ACADEMIE DES BEAUX-ARTS ART BRUT CREATION OUTSIDE OF THE NORMS 90 Number90 Summer 2019 Editorial • page 2 Installations under the Coupole: Jiři Kylián, Régis Campo, Muriel Mayette-Holtz • pages 3 to 5 Exhibition : “Mondrian figuratif – an Editorial To some, the term art brut (“gross art”) might evoke unknown story” Musée Marmottan Monet an impulse, a thoughtless gesture, like a cry. Obviously, many examples fit this definition, but what should then be said of Exhibition : The Académie des Beaux- Arts Pierre-David Weill Drawing Prize architectural creations designed and constructed entirely by a single man over Cité Internationale des Arts decades, such as Postman Cheval’s Ideal Palace or Simon Rodia’s Watts Towers ? • pages 6 to 9 These two approaches, forty years apart, are remarkably similar. Two men of modest origin, both with only rudimentary schooling, who spent 33 Subject file: “Art brut, creation outside years fulfilling their dream strictly on their own. of the norms” Simon Rodia, a rough character, was perhaps more of a protestor, almost an • pages 10 to 34 anarchist, whereas Cheval was more of a daydreamer. But both were controversial, as is evidenced in the report that officials of News: Symposium: “Can art live without the art market” the Ministry of Cultural Affairs wrote when the Ideal Palace was put up for News: classification as a historical monument: The“ whole thing is absolutely hideous. Creation of the Foundation for the Marc Ladreit de Lacharrière An appalling collection of insanities, scrambled in a lout’s brain...”. Fortunately, Photography Prize this did not prevent Edmond Michelet from completing the steps that André Publication: “Notre-Dame de Malraux had taken to classifying it in 1969. -

Anaïs Nin and the Synthesis of the Arts
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UCL Discovery “The Multimedia of Our Unconscious Life”: Anaïs Nin and the Synthesis of the Arts Sandra Rehme University College London PhD History of Art 1 I, Sandra Rehme, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Abstract This thesis explores Anaïs Nin’s idea of a synthesis of the arts in writing and its extension to different media through an analysis of her interdisciplinary collaborations with artists and composers in the United States of the 1950s and 1960s. I discuss these collaborations within the context of Nin’s unconventional understanding of the unconscious as multidimensional space and her interest in the sensory effects of different art forms, which are at the centre of Nin’s art theory. I look at the sources she drew on to formulate her ideas in Paris of the 1930s, including Symbolism, D.H. Lawrence’s writing, French Surrealism and various psychoanalytical models, and discuss how they relate to cultural and socio-political developments in America at mid-century. This includes a strong focus on Nin’s ambiguous negotiation of female identity and female creativity in her writing and the frictions it causes when it is translated into other media by her male collaborators. While Nin’s interest in different art forms and her attempt at imitating their sensuous effects in writing has been explored from a literary perspective, Nin’s extra-literary collaborations remain largely unexplored.