Sierra Leone Vom 6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MARCH NEWSLETTER.Pub
AFRICA GROUP I CONSTITUENCY A Newsletter from the Office of the Executive Director In This Issue • Message from the Executive Director • Feature Story: World Bank Group Response to the Financial Cri- sis • Voice and Participa- tion - Update • Executive Director’s Visits to Constituency Countries in West and Southern Africa March No. 01/2009 • Executive Directors’ Group Travel to Libe- ria • Welcoming Partici- pants of the 2009 Voice Secondment Program • Approved Projects (January-March 2009) • Upcoming Meetings Toga Gayewea McIntosh Executive Director The World Bank Africa Group I Constituency Newslet- ter is published quarterly by the Office of the Executive Director for Africa Group I. Table of Contents Executive Director Toga Gayewea McIntosh PAGE Alternate Executive Director Hassan Ahmed Taha The Office of the Executive Director for Africa Group I Constituency acts as the resident representative for its member countries. The office protects the individual and collective interests of its member countries in World Message from the Executive Director……………. 1 Bank Group affairs. The Office has a chair on the Board of the World Bank Group (IBRD/IDA. IFC and MIGA). World Bank Group Response to the Financial It is one of the twenty-four chairs on the Board. Crisis……………………………………………….. 3 Executive Directors are responsible for the conduct of the general operations of the Bank and exercise all the Voice and Participation - Update.…………….......7 powers delegated to them by the Board of Governors under the Articles of Agreement. Executive Directors Executive Director’s Visits to Constituency consider and approve or reject IBRD loan and guarantee Countries in West and Southern Africa …...……...8 proposals, IFC investments, as well as IDA credits, grant and guarantee proposals made by the President. -

Sierra Leone Understanding Land Investment Deals in Africa
Understanding Land investment deaLs in africa Country report: sierra Leone Understanding Land investment deaLs in africa Country report: sierra Leone acknowLedgements This report was researched and written by Joan Baxter under the direction of Frederic Mousseau. Anuradha Mittal and Shepard Daniel also provided substantial editorial support. We are deeply grateful to Elke Schäfter of the Sierra Leonean NGO Green Scenery, and to Theophilus Gbenda, Chair of the Sierra Leone Association of Journalists for Mining and Extractives, for their immense support, hard work, and invaluable contributions to this study. We also want to thank all those who shared their time and information with the OI researchers in Sierra Leone. Special thanks to all those throughout the country who so generously assisted the team. Some have not been named to protect their identity, but their insights and candor were vital to this study. The Oakland Institute is grateful for the valuable support of its many individual and foundation donors who make our work possible. Thank you. The views and conclusions expressed in this publication, however, are those of the Oakland Institute alone and do not reflect opinions of the individuals and organizations that have sponsored and supported the work. Design: amymade graphic design, [email protected], amymade.com Editors: Frederic Mousseau & Granate Sosnoff Production: Southpaw, Southpaw.org Photograph Credits © Joan Baxter Cover photo: Cleared land by the SLA project Publisher: The Oakland Institute is a policy think tank dedicated to advancing public participation and fair debate on critical social, economic, and environmental issues. Copyright © 2011 by The Oakland Institute The text may be used free of charge for the purposes of advocacy, campaigning, education, and research, provided that the source is acknowledged in full. -

Rebuilding Business and Investment in Post-Conflict Sierra Leone
REBUILDING BUSINESS AND INVESTMENT IN POST-CONFLICT SIERRA LEONE How the World Bank Group’s program Removing Administrative Barriers to Investment helped build a regulatory framework for easier business and investment in a post-conflict environment Investment Climate Advisory Services I World Bank Group In partnership with: REBUILDING BUSINESS AND INVESTMENT IN POST-CONFLICT SIERRA LEONE A Contents Preface Today, the last UN peacekeeping contingent left Freetown. Nine years after the end of hostilities, Sierra Leone is finally Preface 1 considered at peace again. And indeed, the streets of the capital are vibrant. Hope is visible in the faces of young Executive Summary 2 and old alike. There is no reason for Sierra Leone to be poor. It is rich in minerals, including gold, diamonds, and iron ore. It is a 00 - The Onset 5 magnificent country with vast uncultivated lands, beautiful beaches and a rare fauna. 01 - Registering a Business 11 While signs of war have mostly faded, it is not hard to imagine how much further along the country could be. We believe 02 - Tax 16 that vibrant, dynamic development with opportunities created through private initiative will provide an excellent weapon 03 - Public-Private Dialogue 21 against future conflicts. When new businesses are created, when people have jobs, and when families can pay for their 04 - Tourism and Agribusiness Investment 24 children’s food and education there is less incentive to pursue conflict. 05 - Lessons Learned 30 Our staff now has been in Sierra Leone for seven years. Our investment climate program in the country was one of our first 06 - The Next Chapter 34 in a conflict affected country. -
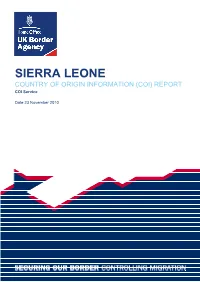
COI) REPORT COI Service
SIERRA LEONE COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION (COI) REPORT COI Service Date 23 November 2010 SIERRA LEONE NOVEMBER 2010 Contents Preface Paragraphs Background Information 1. GEOGRAPHY ............................................................................................................ 1.01 Map ........................................................................................................................ 1.04 2. ECONOMY ................................................................................................................ 2.01 3. HISTORY .................................................................................................................. 3.01 From 1787 to 2006 ................................................................................................ 3.01 Presidential and parliamentary elections, August 2007.................................... 3.07 Political violence in 2009 ..................................................................................... 3.08 Trials at the Special Court for Sierra Leone and The Hague ............................ 3.09 4. RECENT DEVELOPMENTS (JANUARY TO NOVEMBER 2010)........................................... 4.01 5. CONSTITUTION.......................................................................................................... 5.01 6. POLITICAL SYSTEM ................................................................................................... 6.01 Political parties.................................................................................................... -

Rapporto Sintetico
Ministero degli Affari Esteri DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA Roma, 27 luglio 2009 “COUNTRY PRESENTATION SENEGAL E SIERRA LEONE” Roma, 21 luglio 2009 ore 09.45 – Sala delle Conferenze Internazionali Piazzale della Farnesina 1 – Roma Il 21 luglio si è tenuta presso il Ministero degli Affari Esteri una “Presentazione Paese” dedicata congiuntamente al Senegal e alla Sierra Leone. L’iniziativa si inscrive all’interno di un ciclo di “Country Presentations” inauguratosi il 26 maggio con l’Angola e proseguito il 16 giugno con la Nigeria e che, considerato l’interesse riscosso, è destinato a continuare nel prossimo futuro. I lavori sono stati aperti dall’On.le Min. Franco Frattini e moderati dal Direttore Generale per i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana Giuseppe Morabito . Per la Sierra Leone erano presenti il Min. dell’ Industria e del Commercio David Carew , il Consigliere Speciale del Presidente della Repubblica Koroma, Oluniyi Robbin-Coker e il Direttore Generale dell’Agenzia per la Promozione degli Investimenti e delle Esportazioni (SLIEPA) Patrick Caulker . Il Senegal è stato rappresentato dal Min. del Commercio Amadou Niang , da due rappresentanti dell’Agenzia per la Promozione degli Investimenti (APIX) Amadou Saidou e Augustin Diouf , rispettivamente Vice Direttore e responsabile del settore agricoltura e agro-business e dal Consigliere Speciale del Presidente della Repubblica Wade, Moustapha Ndiaye . Da parte italiana, i relatori intervenuti all’incontro sono stati: Giancarlo Bertoni (SIMEST), Antonio Massoli Taddei (SACE), Ely Szajkowicz (AssaAfrica), Cristina Carbognani (ConfApi), Felice Maria Barlassina (CISAO, Camera di Commercio Italia Senegal e dell’Africa Occidentale) ed Enrico Cecchetti (Fondazioni4Africa). Nel suo discorso di apertura il Min. -

Justice Biobele Full Report
SECRET – VOLUME ONE: INVESTIGATION OF MDAs GOVERNMENT OF SIERRA LEONE COMMISSION OF INQUIRY NO. 64 SPECIAL COURT COMPLEX JOMO KENYATTA ROAD FREETOWN SIERRA LEONE REPORT OF THE HON SIR JUSTICE BIOBELE ABRAHAM GEORGEWILL, JCA, DSSRS, KSC CHAIRMAN AND SOLE COMMISSIONER VOLUME ONE MARCH,2020 Page 1 of 185 SECRET – VOLUME ONE: INVESTIGATION OF MDAs 1. APPRECIATION The privilege to be called upon and to have served this great Country of Sierra Leone has indeed been mine. Having brought this assignment to a successful conclusion, it is fitting to give thanks and praise first to God for his grace and mercy all through the assignment. I express my appreciation to H. E. Mohammadu Buhari, the President of the Federal Republic of Nigeria for approving my coming over to Sierra Leone to take up this assignment. I express my appreciation to H.E. Julius Maada Bio, the President of Sierra Leone for appointing and giving me the opportunity to serve this Country and the free hand to carry out this assignment. I thank the Vice President, Mohammed Juldeh Jalloh, the Speaker, Rt. Hon Dr. Abass Chenor Bundu, the Hon Attorney General and Minister of Justice, Dr. Priscilla Schwartz, the immediate past and current Ministers of Foreign Affairs of Sierra Leone, the Minister of Foreign Affairs of Nigeria, Hon Godfrey Onyeama, the former Minister for Foreign Affairs of Nigeria, Hon Odein Ajumogobia SAN, the High Commissioner of Nigeria to Sierra Leone, Dr. Habiss Ugbada, and his Staff, the Inspector General of Police, the Republic of Sierra Leone Armed Forces, the Bishop and Dean of Diocese of Freetown and the Anglican Communion, the Coordinator and Staff of the Commissions of Inquiry, Freetown. -

SW 376 Part I Introduction.Indd
When the State Fails SSW_376_Prelims.inddW_376_Prelims.indd i 110/29/20110/29/2011 12:48:5812:48:58 PMPM SSW_376_Prelims.inddW_376_Prelims.indd iiii 110/29/20110/29/2011 12:49:0012:49:00 PMPM WHEN THE STATE FAILS Studies on Intervention in the Sierra Leone Civil War Edited by Tunde Zack-Williams SSW_376_Prelims.inddW_376_Prelims.indd iiiiii 110/29/20110/29/2011 12:49:0012:49:00 PMPM First published 2012 by Pluto Press 345 Archway Road, London N6 5AA www.plutobooks.com Distributed in the United States of America exclusively by Palgrave Macmillan, a division of St. Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010 In cooperation with The Nordic Africa Institute PO Box 1703, SE-751 47 Uppsala, Sweden www.nai.uu.se Copyright © Tunde Zack-Williams 2012 The right of the individual contributors to be identified as the authors of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978 0 7453 3221 5 Hardback ISBN 978 0 7453 3220 8 Paperback Library of Congress Cataloging in Publication Data applied for This book is printed on paper suitable for recycling and made from fully managed and sustained forest sources. Logging, pulping and manufacturing processes are expected to conform to the environmental standards of the country of origin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Designed and produced for Pluto Press by Swales & Willis Simultaneously printed digitally by CPI Antony Rowe, Chippenham, UK and Edwards Bros in the United States of America SSW_376_Prelims.inddW_376_Prelims.indd iivv 110/29/20110/29/2011 12:49:0012:49:00 PMPM This book is dedicated to ‘real people of Sierra Leone’: the workers, peasant producers and the youth. -

Sierra Leone
Sierra Leone y http://www.countrywatch.com Acknowledgements There are several people without whom the creation of this year's edition of the CountryWatch Country Reviews could not have been Contributors accomplished. Robert Kelly, the Founder and Chairman of CountryWatch envisioned the original idea of CountryWatch Robert C. Kelly Country Reviews as a concise and meaningful source of Founder and Chairman country-specific information, containing fundamental demographic, socio-cultural, political, economic, investment and environmental Denise Youngblood-Coleman Ph. D. information, in a consistent format. Special thanks must be Executive Vice President and conveyed to Robert Baldwin, the Co-Chairman of CountryWatch, Editor-in-Chief who championed the idea of intensified contributions by regional specialists in building meaningful content. Today, the CountryWatch Mary Ann Azevedo M. A. Country Reviews simply would not exist without the research and Managing Editor writing done by the current Editorial Department at CountryWatch. The team is responsible for hundreds of thousands of pages of Julie Zhu current information on the recognized countries of the world. This Economics Editor Herculean task could not have been accomplished without the unique talents of Mary Ann Azevedo, Julie Zhu, Ryan Jennings, Ryan Jennings Cristy Kelly, Ryan Holliway, Anne Marie Surnson and Michelle Economics Analysts Hughes within the Editorial Department. These individuals faithfully expend long hours of work, incredible diligence and the highest Ryan Holliway degree of dedication in their efforts. For these reasons, they have my Researcher and Writer utmost gratitude and unflagging respect.A word of thanks must also be extended to colleagues in the academic world with whom Cristy Kelly specialized global knowledge has been shared and whose Research Analyst contributions to CountryWatch are enduring.