Heroische Weltsicht. Hitler Und Die Musik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Young Hitler I Knew -- August Kubizek
This material originally appeared at http://www.faem.com/books/ JR The Young Hitler I Knew -- August Kubizek Introduction -- H.R. Trevor-Roper Editor note: Roper was a jew reporter with close ties to British Intelligence. He came on the scene with his ridiculous claims about the "gas chambers" and "ovens" at Dachau. Thereafter, the British government stated that Dachau was not a "death camp" and no such facilities existed there. All the the so-called "extermination camps" curiously ended up in Soviet held territory. That should tell you something. This book deals with the darkest, perhaps the most formative, and therefore, in some sense, the most interesting period of Hitler's life. His public life is now fully-indeed oppressively-documented; his mature character, in its repellent fixity, is now fully known. But his crucial early years, the years between leaving school and joining the Bavarian army are, in the language of one of his biographers [Thomas Orr, Das War Hitler -- Revue, Munich, 1952, No. 42], "impenetrable." And yet those are the years in which that grim character, that unparalleled will power, that relentless systematic mind was formed. Any light on those undocumented years is welcome. The light shed by this book is more than that: it penetrates and reveals the character of the young Hitler as no other book has done. But before showing this let us examine the meagre framework of fact into which it is fitted. Hitler left school at Steyr in September 1905, and went to live with his widowed mother in Linz. He was then aged sixteen. -

Adolf Hitler, Begründer Israels
Hennecke Kardel ADOLF HITLER — Begründer Israels INHALTSVERZEICHNIS Einführung . 11 Unstet und flüchtig, mit Vater und Mutter . 19 Ein Gammler in Wien . 29 Wehrdienstverweigerer und Kriegsfreiwilliger . 50 «Ich aber beschloss Politiker zu werden» . 60 «Die Juden sind unser Unglück» . 82 «Mein Kampf», ein Stück aus Landsberg am Lech . 97 Sein Kampf, eine amerikanische Erfolgsgeschichte . 107 «Die Sozialisten verlassen die NSDAP» . 129 Machtübernahme mit Fackeln, keine Revolution . 139 Es läuft und läuft . 155 Morell, der Leibarzt und seine Folgen . 174 Keiner will Hitlers Juden haben . 180 Verrechnet: Es wird zurückgeschossen . 204 Einsatz des Germanenordens unter jüdischen Mischlingen 251 Die Endlösung Israel . 270 Anmerkungen . 275 EINFÜHRUNG Im Jahre 1973 lief dem Verfasser auf einer Insel im Atlantik ein Stabsoffizier über den Weg, mit dem er dreissig Jahre zu- vor Leningrad belagert hatte – gemeinsam mit Männern aus einem Dutzend europäischer Nationen. Seine Eltern, Wiener Juden, wurden bei Ausbruch des ersten Weltkrieges wäh- rend einer Seereise auf diesem Eiland zunächst interniert und später ansässig. «Amigo», fragte der Verfasser, als die ersten Whiskys im Kasino der Infanteriekaserne die Zungen gelockert hatten, «wie kannst Du als Volljude da diese drei Orden und Ehren- zeichen mit dem Hakenkreuz auf Deiner Brust tragen?» «Na schau», kam es im schönsten wienerisch, «dann kratz amal am Hitler. Wirst schon sehn, dass a Weaner Jud wie i zum Vorschein kommt.» Ein kleiner italienischer Frachter kam vorbei und zwei Wochen darauf stieg der Verfasser in Buenos Aires an Land. Von der einen Million Juden in dieser Stadt sprach er man- chen, am Mittagstisch und in der Cafeteria, und von den so- genannten Kriegsverbrechern hörte er beim abendlichen Um- trunk im Chaco ähnliche Seufzer: «Der Hitler ein österreichi- scher Judenmischling? Gott sei’s geklagt. -

Literaturliste – Bücher: Stand: 09.03.2014
Alex Brunner, Architekt HTL, Bahnhofstrasse 210, 8620 Wetzikon, www.brunner‐architekt.ch LITERATURLISTE – BÜCHER: STAND: 09.03.2014 „Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist ihr Komplize.“ Karlheinz Deschner, in Bissige Aphorismen, Rowohlt 1994, ISBN 349922061X, Seite 54 Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Geschichte in der Literatur nicht so genau niedergeschrieben wird. Und tatsächlich ist es zudem so, dass uns die Geschichte in der Schule nicht richtig, eigentlich ja überhaupt nicht, erklärt wird. Und wen man selbst beginnt, die Geschichte zu recherchieren, so stellt man fest, dass es kein leichtes Unterfangen ist, dies alleine zu bewerkstelligen; zu viele Bücher bieten Halbwissen oder noch weniger an und die Medien erklären uns in der Regel noch viel weniger. Meist beginnt man die Geschichte der letzten Jahrhunderte zu studieren, doch damit versteht man immer noch nicht, was die eigentlichen Beweggründe der Veränderungen sind. Auch wenn man beginnt, die Geschichte bis ins Altertum aufzuarbeiten, so kommt man deshalb nicht weiter. Deshalb muss man sich vom jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig (1881‐1942) belehren lassen: «Wer die Vergangenheit nicht versteht, versteht nichts wirklich.» Doch diese Vergangenheit zu verstehen, ist nicht einfach oder gar unmöglich, wenn man nicht Hilfe erhält, um die letzte Hürde der Metapher zu nehmen, mit der die Götter, die Religion und die Esoterik, aber auch unseren Materialismus erklärbar werden. Die nachstehende Liste ist lediglich ein zufälliges Sammelsurium und ganz bestimmt nicht vollständig. Zum Thema der tatsächlichen Geschichte im weiteren Sinn des Ablaufs allen Geschehens in Raum und Zeit und deren Behinderung steht durchaus eine umfangreiche Literatur zur Verfügung. Für den Inhalt kann keine Garantie übernommen werden, dass die tatsächliche Geschichte dargestellt wird oder zumindest versucht wird, die tatsächlichen Vorgänge zu erhellen. -
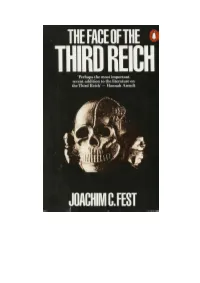
The Face of the Third Reich
* * * * Joachim C. Fest The Face of the Third Reich Translated from the German by Michael Bullock Scanned & Proofed By MadMaxAU * * * * Contents Foreword Part One: Adolf Hitler’s Path from Men’s Hostel to Reich Chancellery 1 The Incubation Period 2 The Drummer 3 The Führer 4 The Reich Chancellor 5 Victor and Vanquished Part Two: Practitioners and Technicians of Totalitarian Rule Hermann Göring—Number Two Joseph Goebbels: ‘Man the Beast’ Reinhard Heydrich—The Successor Heinrich Himmler—Petty Bourgeois and Grand Inquisitor Martin Bormann—The Brown Eminence Ernst Röhm and the Lost Generation Part Three: Functionaries of Totalitarian Rule Franz von Papen and the Conservative Collaboration Alfred Rosenberg—The Forgotten Disciple Joachim von Ribbentrop and the Degradation of Diplomacy Rudolf Hess: The Embarrassment of Freedom Albert Speer and the Immorality of the Technicians Hans Frank—Imitation of a Man of Violence Baldur von Schirach and the ‘Mission of the Younger Generation’ General von X: Behaviour and Role of the Officer Corps in the Third Reich ‘Professor NSDAP’: The Intellectuals and National Socialism German Wife and Mother: The Role of Women in the Third Reich Rudolf Höss-The Man from the Crowd Part Four: The Face of the Third Reich: Attempt at a Summing Up Notes Bibliography Index * * * * A forest takes a century to grow; it burns down in a night. Georges Sorel No nation will let its fingers be burnt twice. The trick of the Pied Piper of Hamelin catches people only once. Adolf Hitler Foreword The tree on which the owl of Minerva sits has many branches. The portraits in this book have, from a strictly scholarly viewpoint, a rather profane origin. -
Side Index Side Adolf Hitler Franz Von Papen Konstantin Von Neurath
Index Side Index Side Adolf Hitler 2 Julius Dorpmüller 166 Franz von Papen 44 Wilhelm Ohnesorge 169 Konstantin von Neurath 45 Richard Walther Darré 171 Joachim von Ribbentrop 47 Herbert Backe 176 Wilhelm Frick 49 Joseph Goebbels 87 Heinrich Himmler 50 Bernhard Rust 178 Lutz Graf Schwerin von 62 Fritz Todt 150 Krosigk Albert Speer 91 Alfred Hugenberg (DNVP) 63 Alfred Rosenberg 120 Kurt Schmitt 64 Hanns Kerrl 181 Hjalmar Schacht 70 Hermann Muhs 184 Hermann Göring 71 Otto Meißner 185 Walther Funk 76 Hans Lammers 188 Franz Seldte 78 Martin Bormann 123 Franz Gürtner (DNVP) 83 Karl Hermann Frank 173 Franz Schlegelberger 84 Rudolf Hess 132 Otto Georg Thierack 160 Ernst Röhm 145 Werner von Blomberg 158 Wilhelm Keitel 153 Freiherr von Eltz- 163 Rübenach 1 Hitlers og hans kabinet (30. januar 1933 – 30. april 1945) Adolf Hitler i 1938 Tysklands Führer Embedsperiode 2. august 1934 – 30. april 1945 Foregående Paul von Hindenburg (som præsident) Efterfulgt af Karl Dönitz (som præsident) Reichskanzler (Rigskansler) i Tyskland Embedsperiode 30. januar 1933 – 30. april 1945 Foregående Kurt von Schleicher Efterfulgt af Joseph Goebbels 2 Født 20. april 1889 Braunau am Inn, Østrig–Ungarn Død 30. april 1945 (56 år) Berlin, Tyskland Nationalitet Østriger (1889–1932) Tysker (1932–1945) Politisk parti Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP) Ægtefælle Eva Braun (gift 29. april 1945) Beskæftigelse Politiker, soldat, kunstner, forfatter Religion Opdraget som katolik Signatur Militærtid Troskab Tyske kejserrige Værn Reichsheer7 Tjenestetid 1914-1918 Rang Gefreiter Enhed 16. bayerske reserveregiment Slag/krige 1. verdenskrig Udmærkelser Jernkorset af 1. og 2. klasse Såretmærket Adolf Hitler (20. -

From Putsch to Purge. a Study of the German Episodes in Richard Hughes’S the Human Predicament and Their Sources
From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources Holmqvist, Ivo 2000 Link to publication Citation for published version (APA): Holmqvist, I. (2000). From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources. English Studies. Total number of authors: 1 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 Ivo Holmqvist From Putsch to Purge A Study of the German Episodes in Richard Hughes' s The Human Predieament and their Sources Ivo Holmqvist From Putsch to Purge A Study of the German Episodes in Richard Hughes's The Human Predieament and their Sources Lorentz Publishing, Skolgatan 21 S- 241 31 Eslöv, Sweden www.Lorentz.net ivo_ [email protected] Print: Symposion, Eslöv 2000. -
Lo S M a G O S D E L a G U E Rr A
Otros títulos publicados en Cúpula Enigmas La segunda guerra mundial fue la contienda más devastadora y sanguinaria de la historia. Sin embargo, lejos del frente, los servicios secretos de ambos bandos llevaron a cabo una lucha paralela, en la sombra, haciendo uso no sólo del espionaje, la propaganda negra o la desinformación, sino de otras técnicas menos habituales, en las que brillaron con luz propia personajes que han sido deliberadamente olvidados en los libros. El ocultismo, la astrología y la magia también tuvieron cabida en aquella lucha frenética a vida o muerte por conquistar el mundo. Óscar Herradón Ameal es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense En este libro se relatan cuáles fueron las «armas» secretas que de Madrid. Actualmente es redactor jefe permitieron al Partido Nazi pasar de ser una discreta organización de la revista Enigmas, editada por Prisma política a erigirse como la fuerza más poderosa de Europa Publicaciones (Grupo Planeta) y colaborador en pocos años; se desvela si Adolf Hitler se guió por los consejos Los magos magos Los habitual de Historia de Iberia Vieja, entre de un profeta y qué nalidad tenían los rituales secretos de la Los magos de la de guerra otras publicaciones, y de diversos programas Orden Negra. Además, se destapan las tácticas empleadas por Churchill para doblegar a los esbirros de la esvástica y qué de l a de radio y televisión. papel desempeñó la magia en el campo de batalla. Es autor de varios ensayos, entre ellos Ésta es la apasionante historia de un singular grupo de hombres El secreto judío de Cervantes (Espejo de Tinta, que desplegaron sus habilidades ocultas en los tenebrosos tiempos guerra 2005); Historia oculta de los reyes (Espejo del Tercer Reich. -

Informatio;^ Issued by the — Association of Jewish Refugees in Great Britain 8, Fairfax Mansions
ih Vol. II. No. li NOVEMBER 1947 INFORMATIO;^ ISSUED BY THE — ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN 8, FAIRFAX MANSIONS. LONDON. N.W.3 0^« and ContultJni Hpur$: 10 a.m,—I p.m., 3—6 p.m., Sunday 10 a.m.—'I p.m. Tt/ephont: MAIda VaU 9094 A WORLD CHALLENGE RESTITUTION IN GERMANY HE Palestine debate at U.N.O. has set a unique Tprecedent. For the first time since tliis inter national body was created, the views of the Amer For a long time, preparations for a legisla the special problem of Berlin, where about icans and Russians in a main political issue were tion on restitution have been going on. The one third of German Jewry lived, and which identical. Both the representative of the American " Council for the Protection of the Rights and is essentially administered by the Magistrat delegation, Mr. Herschel Johnson, and Mr. Tsarap- Interests of Jews from Germany " has been and controlled by the Allied Kommandatura. kin, the Soviet delegate, supported the proposal for very active in this matter. Discussions with The Magistrat is now also considering legis a Jewish State as outlined in the majority report, the authorities concerned in this country, in lation on restitution; again, however, Four and accepted the principle of partition. The, Germany and abroad have been taking place Power-agreement will have to be reached for opposition came mainly from the Eastern countries almost every day. giving effect to it, this time " on Komman led by the two new members of Pakistan and India, Refugees frequently put the question, why datura level." who linked up with the Arab States to a kind of the " Council " or the AJR does not take In the terminology of all the conversations Moslemic-Asiatic bloc. -

International Bulletin
INTERNATIONAL BULLETIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red: Gonda Scheffel-Baars, Nieuwsteeg 12, 4196 AM Tricht The Netherlands Tel: (+) 345 573190 e-mail: [email protected] [email protected] Sponsor: Stichting Werkgroep Herkenning www.werkgroepherkenning.nl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Issue 42, Spring 2016 INTRODUCTION The Dutch historian J. Presser who wrote a study on the Persecution and Murder of the Dutch Jews, wrote also poems. I translated one of them for the IB. In December 2015, a symposium was held in Vienna, to celebrate the 20th anniversary of The Austrian Encounter, a group of adult children of either victims of the Holocaust or offspring of Nazi's or bystanders. Samson Munn sent me a short report about the program and he gave me permission to make a summary of one of his presentations. Linked to his story about how The Austrian Encounter was initiated, I present to you some paragraphs of Bobbie Goldman's report on the first two meetings of TAE. Besides, I publish some lines on the start of KOMBI, the Dutch organization of war children of different backgrounds. I came accross two books which I read with much interest. On the internet I found a couple of book reviews and I chose to publish those which I feel draw best attention to the principal themes of these novels: The Absolutionist by John Boyne and The Seventh Cross by Anna Seghers. Boyne's story presents heroism versus cowardice, right versus wrong, guilt versus forgiveness. Seghers depicts poignantly the impact of dictatorship on the lives of the citizens. Ruth Barnett, one of the readers of the IB, wrote a book “Love, Hate and Indifference”. -

From Putsch to Purge. a Study of the German Episodes in Richard Hughes's the Human Predicament and Their Sources Holmqvist, Iv
From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources Holmqvist, Ivo 2000 Link to publication Citation for published version (APA): Holmqvist, I. (2000). From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources. English Studies. Total number of authors: 1 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 Ivo Holmqvist From Putsch to Purge A Study of the German Episodes in Richard Hughes' s The Human Predieament and their Sources Ivo Holmqvist From Putsch to Purge A Study of the German Episodes in Richard Hughes's The Human Predieament and their Sources Lorentz Publishing, Skolgatan 21 S- 241 31 Eslöv, Sweden www.Lorentz.net ivo_ [email protected] Print: Symposion, Eslöv 2000. -

Literaturliste Stand: 18.04.2020
Alex Brunner, Architekt HTL, Bahnhofstrasse 210, 8620 Wetzikon, www.brunner-architekt.ch LITERATURLISTE STAND: 18.04.2020 «Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist ihr Komplize.» Karlheinz Deschner, in Bissige Aphorismen, Rowohlt 1994, ISBN 349922061X, Seite 54 Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Geschichte in der Literatur nicht so genau niedergeschrieben wird. Und tatsächlich ist es zudem so, dass uns die Geschichte in der Schule nicht richtig, eigentlich ja über- haupt nicht, erklärt wird. Und wen man selbst beginnt, die Geschichte zu recherchieren, so stellt man fest, dass es kein leichtes Unterfangen ist, dies alleine zu bewerkstelligen; zu viele Bücher bieten Halbwissen oder noch weniger an und die Medien erklären uns in der Regel noch viel weniger. Meist beginnt man die Geschichte der letzten Jahrhunderte zu studieren, doch damit versteht man immer noch nicht, was die eigentlichen Beweggründe der Veränderungen sind. Auch wenn man beginnt, die Ge- schichte bis ins Altertum aufzuarbeiten, so kommt man deshalb nicht weiter. Deshalb muss man sich vom jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig (1881-1942) belehren lassen: «Wer die Vergangenheit nicht versteht, versteht nichts wirklich.» Doch diese Vergangenheit zu verstehen, ist nicht einfach oder gar unmöglich, wenn man nicht Hilfe erhält, um die letzte Hürde der Metaphern zu nehmen, mit der die Götter, die Religion und die Esoterik, aber auch unser Materialismus erklärbar werden. Die nachstehende Liste ist lediglich ein zufälliges Sammelsurium und ganz bestimmt nicht vollständig. Zum Thema der tatsächlichen Geschichte im weiteren Sinn des Ablaufs allen Geschehens in Raum und Zeit und deren Behinderung steht durchaus eine umfangreiche Literatur zur Verfügung. Für den Inhalt kann keine Garantie übernommen werden, dass die tatsächliche Geschichte dargestellt wird oder zumindest versucht wird, die tatsächlichen Vorgänge zu erhellen.