PDF-Dokument
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
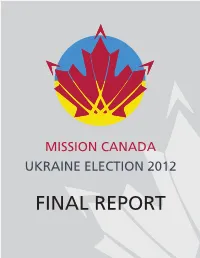
Final Report
MISSION CANADA UKRAINE ELECTION 2012 FINAL REPORT MISSION CANADA UKRAINE ELECTION 2012 FINAL REPORT This report is available at www.CANADEM.ca/MissionCanada2012 and at www.CANADEMMissions.ca/Ukraine_reports TABLE OF CONTENTS Foreword .......................................................................................................................5 Executive Summary .........................................................................................................7 Recommendations ..................................................................................................................... 8 Election Observation Standards ..................................................................................... 11 International Standards for Elections ........................................................................................... 11 Ukrainian Law ........................................................................................................................ 11 Mission Canada Practices, Mandate and Scope .......................................................................... 12 Legal Framework and Electoral System for Ukraine’s Parliamentary Elections ...................13 Political Context ............................................................................................................14 Delineation of Single-Mandate Districts ........................................................................................ 14 Election Administration .................................................................................................15 -

The Legal and Policy Framework Related to Equality
Patterns of Discrimination and Inequality 3. THE LEGAL AND POLICY FRAMEWORK RELATED TO EQUALITY This part of the report describes and analyses the legal and policy framework related to equality in Ukraine in order to assess its adequacy to address the patterns of inequality and discrimination highlighted in the preceding part. It examines both Ukraine’s international legal obligations and the do- mestic legal and policy framework which protects the rights to equality and non-discrimination. In respect of domestic law, it examines the Constitu- impacttion, specific on inequality, anti-discrimination before turning laws, to andan assessment non-discrimination of the enforcement provisions andin other implementation areas of law. of It existingalso examines laws and government policies aimed policies at ensuringwhich have equa an- - se functions are related to equality, the Ukrainian Parliament Commissioner lity, including an examination of the most significant specialised body who to discrimination. for Human Rights. Finally, this part reviews existing judicial practice related Throughout this part, Ukraine’s legal and policy framework is analysed in re- lation to the extent to which it complies with Ukraine’s international human rights obligations and international best practice on equality. In order to as- sess the full picture of the Ukrainian legal and policy framework as it relates to equality, this part should be read together with, and in the context of, the previous part, which contains an appraisal of laws that discriminate overtly 3.1or are Internationalsubject to discriminatory and Regional application. Law Ukraine has signed and ratified (or acceded to) a number of international treaties since its independence in 1991. -

Police Reform in Ukraine Since the Euromaidan: Police Reform in Transition and Institutional Crisis
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2019 Police Reform in Ukraine Since the Euromaidan: Police Reform in Transition and Institutional Crisis Nicholas Pehlman The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3073 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Police Reform in Ukraine Since the Euromaidan: Police Reform in Transition and Institutional Crisis by Nicholas Pehlman A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Political Science in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2019 © Copyright by Nick Pehlman, 2018 All rights reserved ii Police Reform in Ukraine Since the Euromaidan: Police Reform in Transition and Institutional Crisis by Nicholas Pehlman This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Political Science in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date Mark Ungar Chair of Examining Committee Date Alyson Cole Executive Officer Supervisory Committee: Julie George Jillian Schwedler THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Police Reform in Ukraine Since the Euromaidan: Police Reform in Transition and Institutional -

In the Spotlight 08/06/2012
ISSUE #30(99) IN THE SPOTLIGHT 08/06/2012 © Gorshenin institute August 2012 All rights reserved ISSUE #30(99) IN THE SPOTLIGHT 08/06/2012 Content 1. International political Ukraine-Russia Ukrainian parliament ratifies free trade deal with CIS…page 4. Russia to resume gas talks with Kiev after Ukrainian parliamentary election…page 4. Russia wants to upgrade Black Sea Fleet stationed in Ukraine…page 5. Ukraine-EU Germany reminds Ukraine about first anniversary of ex-premier's arrest …page 5. Paper says Polish consulate in Western Ukraine involved in visa fraud, human trafficking…page 6. Ukraine-USA USA points at problems with freedom of conscience in Ukraine…page 6. Ukraine-Chine Ukraine to borrow over 6bn dollars from China…page 6. 2. Domestic political Authorities Ukraine's chief political forces decide on candidates for parliamentary election…page 7. President approves cancellation of tenders for state companies…page 8. Ukrainian speaker signs controversial language law…page 8. UEFA thanks Ukraine for hosting Euro 2012…page 9. Traffic police say Ukrainian legislation sanctions violations of road rules by officials…page 9. Ukrainian president dismisses security service's counterintelligence head…page 10. Opposition Election campaign kicks off in Ukraine. Opposition complains of 2 © Gorshenin institute August 2012 All rights reserved ISSUE #30(99) IN THE SPOTLIGHT 08/06/2012 pressure…page 10. Court delays hearing on Ukrainian jailed ex-premier's energy business case …page 10. Ukrainian authorities to limit visitors' admission to jailed ex-premier…page 11. Ukrainian jailed ex-premier refuses to meet ombudsman…page 11. Ukrainian jailed ex- minister's litigation to continue on 10 August…page 12. -

Constitutional Stage of the Judicial Reform in Ukraine
NATIONAL SECURITY & DEFENCE CONTENT π 2-3 (139-140) JUDICIAL REFORM IN UKRAINE: CURRENT RESULTS, PROSPECTS AND RISKS OF THE CONSTITUTIONAL STAGE 2013 (The Razumkov Centre’s Аnalytycal Report) ......................................................... 2 Founded and published by: 1. COURT WITHIN THE SYSTEM OF STATE GOVERNANCE: INTERNATIONAL NORMS AND STANDARDS .......................................................... 3 INTERNATIONAL NORMS ENSURING THE HUMAN RIGHT TO A FAIR TRIAL AS WELL AS THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY AS AN IMPORTANT CONDITION FOR ITS IMPLEMENTATION (Annex) .................................................... 9 UKRAINIAN CENTRE FOR ECONOMIC & POLITICAL STUDIES 2. THE 2010 JUDICIAL REFORM: GOALS AND PROGRESS ...........................................15 NAMED AFTER OLEXANDER RAZUMKOV SEQUENCE OF EVENTS THAT PRECEDED THE JUDICIAL REFORM OF 2010 (Annex)... 29 Director General Anatoliy Rachok 3. SECOND (CONSTITUTIONAL) STAGE OF THE JUDICIAL REFORM: Editor Valeriya Klymenko PROSPECTS AND RISKS ..................................................................................... 35 Layout and design Oleksandr Shaptala 4. CONCLUSIONS AND PROPOSALS ........................................................................ 56 Technical support Volodymyr Kekukh EXPERT ASSESSMENTS THE JUDICIAL REFORM AND STATE OF THE JUDICIARY IN UKRAINE ......................... 62 This journal is registered with the State Committee NATIONWIDE SURVEY of Ukraine for Information Policy, COURTS AND JUDICIAL REFORM IN UKRAINE: PUBLIC OPINION .............................. -

The Role of the Institution of Ombudsman in Strengthening the Protection of Human Rights and Freedoms in Armenia, Moldova and Ukraine
Awarded Theses 2016/2017 Marianna Chobanyan The Role of the Institution of Ombudsman in Strengthening the Protection of Human Rights and Freedoms in Armenia, Moldova and Ukraine CES, The Master’s Programme in Human Rights and Democratisation in the Caucasus MARIANNA CHOBANYAN THE ROLE OF THE INSTITUTION OF OMBUDSMAN IN STRENGTHENING THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN ARMENIA, MOLDOVA AND UKRAINE MARIANNA CHOBANYAN BIOGRAPHY Marianna Chobanyan holds a BA in International Relations (Belarusian State University), a MA in History of International Relations and Foreign Policy (Belarusian State University) and MA in European Studies (Human Rights and Democratization) from Yerevan State University ABSTRACT «Օմբուդսմենի հաստատության դերը մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության ամրապնդման մեջ Հայաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում» «Роль института омбудсмана в укреплении защиты прав и свобод человека в Армении, Молдове и Украине» “The Role of the Institution of Ombudsman in Strengthening the Protection of Human Rights and Freedoms in Armenia, Moldova and Ukraine” Today the ombudsman institution is widely and actively used in state systems of protection of human rights and freedoms from arbitrariness of public authorities and from abuse of power by state officials. The world experience of the emergence and development of this institution demonstrates that it is an effective instrument of a democratic state tending to respect the rule of law. The main role of the ombudsman institution is to control the balance between the legislative, executive and judicial branches of power, observe the lawfulness of public authorities’ activities as well as protect the violated rights and interests of people because of action (inaction) of government bodies and officials. -

Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine
The Equal Rights Trust is an independent internation- Equal Rights Trust al organisation whose purpose is to combat discrimi- nation and promote equality as a fundamental human right and a basic principle of social justice. Nash Mir Center is a Ukrainian non-governmental or- ganisation, which aims to promote equal rights and protects the interests of Ukrainian LGBT people. Ukraine today is caught in the crosscurrents created by powerful forces junior partner of an increasingly antagonised Russia? fighting for its identity. Will it become an ally of the European Union, or a ▪ Country Report Series: ukraine Report Country This report finds that the main line dividing people in Ukraine today is not ethnic, religious, linguistic or regional, but political. Yet while it finds that ethno-linguistic discrimination was not a key cause of the conflict, division and disadvantage are among its consequences. Most prominently, issues of- language, and latterly ethnicity, have become key battlegrounds for those- promoting different visions of Ukraine’s future. LGBT rights have also be In the Crosscurrents come strongly politicised. Discrimination against ethnic, religious and sex ual minorities has increased in Crimea and the separatist-controlled areas,- while the conflicts in these regions have created an internally displaced Addressing Discrimination population which is vulnerable to discrimination. The report also con- cludes that long-standing patterns of discrimination persist in the midst of and Inequality in Ukraine conflict: Roma, women and persons with disabilities, for example, experi ence discrimination resulting largely from culturally entrenched attitudes.- There are grounds for hope, however. In just three years, the legal frame work on equality and non-discrimination has improved radically. -
Ukraine 2013 Human Rights Report
UKRAINE 2013 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Ukraine is a republic with a presidential-parliamentary system of government. The constitution provides for a directly elected president, a unicameral parliament (Verkhovna Rada), and a prime minister appointed by the president and confirmed by parliament. The October 2012 elections for the 450-seat parliament and parliamentary by-elections in December did not meet international standards for fairness or transparency. Authorities maintained effective control over the security forces. Security forces committed human rights abuses. “Berkut” riot police used batons and other forms of physical force on November 30 to clear 300 hundred protesters from Kyiv’s Independence Square (Maidan Nezhalezhnosti) who had peacefully assembled to express dissatisfaction with the government. On December 1, an estimated 500,000 people joined demonstrations in Kyiv’s city center in solidarity with the protesters. At year’s end the “EuroMaidan” civic movement continued to occupy Independence Square and several adjacent streets. The most serious human rights problem during the year was increased government interference with, and pressure on, media outlets, including government tolerance of increased levels of violence toward journalists. The second major human rights problem was intensified pressure on civil society, nongovernmental organizations (NGOs), and civic activists. The third major problem was the practice of politically motivated prosecutions and detentions, including the continued imprisonment of -
Table of Contents • International Criminal Court Demolishes Russia's Narrative on Crimean Annexation • Parliament Should
Table of Contents • International Criminal Court demolishes Russia’s narrative on Crimean annexation • Parliament should reject intrusive NGO measure • Over 490 women, 68 children killed in Donbas • Fake observers praise primaries in occupied territories in Eastern Ukraine • IDPs in the self-proclaimed Donetsk People’s Republic • School education in the self-proclaimed Donetsk People’s Republic • Ukraine and EU losing the souls of the inhabitants of Eastern Ukraine • Odesa smoking gun leads directly to Moscow • Corruption convictions statistics – A few answers and a few tools • Oleksii Goncharenko, a young Ukrainian MP from Odessa looks westwards… • Is the situation tense in Odessa? Analysis of a strange opinion survey • "Faked reform" on electronic declarations lets Ukrainian officials steal with impunity • Attempts to rush through Kremlin projects under religious guise are unacceptable - Victor Yelenskyy • Hybrid war ‘à la russe’ and disinformation • War in Eastern Ukraine brings lasting misery for elderly (Op-Ed) • Nadiya Savchenko: Russia frees Ukraine servicewoman • KHPG statement on the events linked with the ‘Myrotvorets’ site • Ukrainian blogger gets long sentence for expressing contentious views • Outrage as anti-militant website publishes list of journalists working in Donbas • 5 years for a red flag? Controversial decommunization law used against Ukrainian veterans • Is the 2nd May 2014 Odessa tragedy a massacre? • People's Council of Bessarabia: Russia's Trojan horse in Odessa Oblast • Two years after Odessa’s tragedy: about -

Local and Regional Democracy in Ukraine
25th SESSION Strasbourg, 29-31 October 2013 CG(25)8FINAL 31 October 2013 Local and regional democracy in Ukraine Monitoring Committee Rapporteurs: Mr Marc COOLS, Belgium (L, ILDG) 1; Mr Pascal MANGIN, France (R, EPP/CCE) Recommendation 348 (2013) ........................................................................................................................2 Explanatory memorandum ............................................................................................................................5 Summary This is the second report on the state of local and regional democracy in Ukraine since 2001. The report highlights the initiatives taken by the government in view of a substantial territorial reform that are considered positive and the fact that local authorities have been represented in this process by their associations through the consultation procedure. It notes, however, that the law limits local authorities’ autonomy of decision and management, that several cities, including the capital, have remained without a mayor for long periods of time, and that the financial autonomy of local authorities remains limited. The report also highlights the lack of a clear division of competences and administrative action between government departments and those of local authorities and, despite strong statements of intent made at the highest level of State for its implementation, the reform does not advance at the desired pace. It is recommended that the Ukrainian authorities review their legislation in order to remove the restrictions on the powers of local authorities and enable them to fully exercise their competences. The authorities are encouraged to organise, in the shortest possible time, elections in the cities where the post of mayor is vacant. The recommendation underlines the need to strengthen the financial autonomy of local communities and to improve the equalisation system for the purposes of fairness and transparency. -
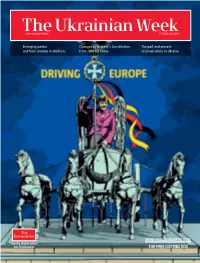
For Free Distribution
#7 (101) July 2016 Emerging parties Changes in Ukraine’s Constitution: The past and present and their chances in elections from 1991 till today of privatization in Ukraine WWW.UKRAINIANWEEK.COM Featuring selected content from The Economist FOR FREE DISTRIBUTION CONTENTS | 3 BRIEFING 32 The forced friendship: 4 Multiplication by division: How today’s Finland understands The prospects of two young liberal security and relations with Russia parties FOCUS 7 Brewing and ripening: 34 Looking to Mutti: An overview of new parties and Angela Merkel and her attempts to political projects in Ukraine give the EU new shape POLITICS 35 In a rut: 10 Putin on the squeeze: The woes of Deutsche Bank The anatomy of Yanukovych’s loan 36 Best of frenemies: from Russia How German-Russian relations 14 Constitutional confrontation: shaped the fate of Europe How Ukraine’s Constitution changed and Ukraine in the past 250 years in the past 25 years 40 A subtle balancing act: 18 Chaos and the law: Stephen Szabo of Transatlantic Law expert Ihor Koliushko on how Academy on the nature key reforms are reflected in the of German leadership in Europe Constitution and the world ECONOMICS SOCIETY 21 The fuel of transformations: 42 Double imprisonment: What the gas sector reforms are Ukrainian prisoners bringing in Crimea are being transferred 24 Of vouchers and men: to Russia, given Russian passports The role of privatization in the rise of and punished for rejecting them Ukraine’s oligarchy HISTORY 26 The burden of ownership: 45 The roads of underground capitalism Current state of publicly-owned assets in the USSR: in Ukraine and plans to privatize them The story of a Stalin-era shady businessman 30 Selling it all? An inventory of state enterprises up for sale CULTURE & ART 50 Readings with writers, contemporary NEIGHBOURS jazz and festivals: 31 Ihor Losev on history-related The Ukrainian Week offers initiatives of Polish MPs and Ukraine’s a selection of events to attend responses in August E-mail [email protected] www.ukrainianweek.com Tel. -

LGBT Rights Before and After Euromaidan
A Revolution of Dignity? LGBT Rights Before and After Euromaidan A Qualitative Study of LGBT Rights in Ukraine Silje Fines Wannebo Master thesis in European and AmeriCan Area Studies, Department of Literature Area Studies and European Languages, FaCulty of Humanities, UNIVERSITY OF OSLO September 2017 I II A Revolution of Dignity? LGBT Rights Before and After Euromaidan A Qualitative Study of LGBT Rights in Ukraine Silje Fines Wannebo Department of Literature, Area Studies and European Languages, Faculty of Humanities, University of Oslo September 2017 Supervisor: Geir Flikke III Copyright Silje Fines Wannebo 2017 A Revolution of Dignity? LGBT Rights Before and After Euromaidan; A Qualitative Study of LGBT Rights in Ukraine Silje Fines Wannebo http://www.duo.uio.no Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo IV V Summary This thesis seeks to examine legal and public perceptions of LGBT rights in Ukraine. Ukraine was the first post-soviet country to decriminalise homosexuality, but during Ukraine’s 25 years of independence, the development of expanding LGBT rights has moved rather slowly. In 2008, however, Ukraine increased its cooperation with the EU through the signing of the Visa Liberalisation Action Plan (VLAP) and in 2014, after the Euromaidan revolution and the Russian annexation of the Ukrainian peninsula Crimea, the president of Ukraine signed the Association Agreement. Both agreements include certain anti-discriminatory measures which Ukraine is recommended or even obliged to implement. Using a qualitative interpretative approach this thesis examines how LGBT activists and parliamentarians perceive the cooperation with the EU and Ukraine’s LGBT legislation. The data from in-depth interviews is analysed and presented using a thematic analysis.