40 Jahre Informatik in München 1967-2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
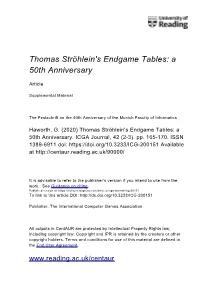
Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50Th Anniversary
Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50th Anniversary Article Supplemental Material The Festschrift on the 40th Anniversary of the Munich Faculty of Informatics Haworth, G. (2020) Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50th Anniversary. ICGA Journal, 42 (2-3). pp. 165-170. ISSN 1389-6911 doi: https://doi.org/10.3233/ICG-200151 Available at http://centaur.reading.ac.uk/90000/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Published version at: https://content.iospress.com/articles/icga-journal/icg200151 To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.3233/ICG-200151 Publisher: The International Computer Games Association All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online 40 Jahre Informatik in Munchen:¨ 1967 – 2007 Festschrift Herausgegeben von Friedrich L. Bauer unter Mitwirkung von Helmut Angstl, Uwe Baumgarten, Rudolf Bayer, Hedwig Berghofer, Arndt Bode, Wilfried Brauer, Stephan Braun, Manfred Broy, Roland Bulirsch, Hans-Joachim Bungartz, Herbert Ehler, Jurgen¨ Eickel, Ursula Eschbach, Anton Gerold, Rupert Gnatz, Ulrich Guntzer,¨ Hellmuth Haag, Winfried Hahn (†), Heinz-Gerd Hegering, Ursula Hill-Samelson, Peter Hubwieser, Eike Jessen, Fred Kroger,¨ Hans Kuß, Klaus Lagally, Hans Langmaack, Heinrich Mayer, Ernst Mayr, Gerhard Muller,¨ Heinrich Noth,¨ Manfred Paul, Ulrich Peters, Hartmut Petzold, Walter Proebster, Bernd Radig, Angelika Reiser, Werner Rub,¨ Gerd Sapper, Gunther Schmidt, Fred B. -

Mitteilungen Der Technischen Universität München Für Studierende, Mitarbeiter, Freunde, Erscheinen Im Selbstverlag Fünfmal Pro Jahr
MITTEILUNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT MÜNCHEN FÜR STUDIERENDE, MITARBEITER, FREUNDE 2007 3 Inhalt 0Titel 1Inhalt 2Impressum Report 3Neue Wege für exzellente Doktoranden 5Promotionsrecht für TUM Junior Fellows Partner: TUM und MAN 6Präsident Herrmann weiter an der Spitze der TUM Norbert Reithofer im Hochschul- und Verwaltungsrat 7Neuer Ärztlicher Direktor am Rechts der Isar 8Champion TUM 9Exzellenzinitiative: TUM-Informatik gut im Rennen 10 »Weiße Biotechnologie« für Bayern 13 Mehr Platz für neue Experimente 14 Eleganter Turm für den Campus 16 Die TUM – die »familiengerechte Hochschule« 17 Familienservice an der TUM Campus mit Babysitterservice 18 Neue Laborräume für die Kinderklinik 19 Lehre und Forschung verknüpfen 20 Auf dem Lehrplan: Bauklima 21 Do more, get more... 22 Soft Skills auf hohem Niveau 24 TUM goes Asia 25 Name gesucht 26 Kooperation mit der Royal University of Bhutan 28 TUM-Studierende auf der WorldMUN 2007 29 Moneten für die Promotion Sprachen lernen an der TUM 30 Prüfung bestanden! 31 TUM-Bibliothek: Super Service Chemie-Diamant Burghausen 32 Australian International Beer Awards 2007 Neu im Leitungsstab 33 35 Jahre, 6 Präsidenten, 1 Job 34 BMW Group + TUM = CAR@TUM isiNav weiß, wo es lang geht 35 EMBA – unternehmerische Praxis Wer, was, wo? 36 Mitteilungen 3-2007 Berufungen 37 Javier Esparza Gunther Friedl Tina Haase 38 Bernhard Hemmer Rafael Macián-Juan Annette Menzel 39 Ralf Metzler Aurel Perren Auszeichnungen 40 kurz berichtet 45 Forschung 46 Wie entwickelt sich ein Ökosystem? 47 SFB Wachstum und Parasitenabwehr -

Kontaktum 2/2019
KontakTUM Magazin Für Alumni der Technischen Universität München Herbst /Winter 2019/2020 Willkommen, Magnifizenz! Ein Heft zum Präsidentenwechsel Schutzgebühr 5,- Euro Campus1 . Engagement . Netzwerk ISSN 1868-4084 ICH UNTERSTÜTZE GERNE BEWUNDERNSWERTE ANSTRENGUNGEN, DIE FÜR DIE MENSCHEN NACHHALTIG NÜTZLICH SIND. Ehrensenator Friedrich N. Schwarz (TUM Alumnus 1964) Im Juli wurde die TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz in Berchtesgaden eröffnet. In dem nachhaltigen Holzgebäude wird die TUM das Ökosystem des Alpenraums erforschen und neue Formen des naturwissenschaftlichen Schulunterrichts erproben. Namensgeber ist TUM Alumnus Friedrich N. Schwarz, der mit seiner Zuwendung an die TUM Universitätsstiftung den Bau in den Bergen mit möglich machte. Friedrich N. Schwarz war Student der Elektro technik an der TUM und hat anschließend Unternehmens- karriere gemacht (Rohde & Schwarz). www.tum-universitätsstiftung.de 2 EDITORIAL Dr. Verena Schmöller und Dr. Sabrina Eisele von der KontakTUM-Redaktion Zwei Alumni FÜR DIE TUM Die TUM informiert Professor Wolfgang A. Herrmann hat 24 Jahre lang die Geschicke der TUM Wollen Sie auch zwischen gelenkt und gilt damit als der am längsten amtierende Präsident der deutschen den Ausgaben des Alumni- Hochschullandschaft. Zum 1. Oktober 2019 hat Professor Thomas F. Hofmann Magazins über aktuelle als Nachfolger seine Aufgaben übernommen. Er war in den vergangenen zehn Ver anstaltungen für Alumni Jahren Vizepräsident für Forschung und Innovation an der TUM. Beiden und Neuigkeiten aus der gemeinsam ist: Sie haben an der TUM studiert beziehungsweise promoviert, TUM informiert werden? sind also Alumni der TUM. Und sie engagieren sich bereits viele Jahre mit Herz Einmal im Monat versenden und Seele für ihre gemeinsame Alma Mater. wir elektronisch den News- letter „Die TUM informiert“. -

Kontaktum Magazine
KontakTUM Magazine For Alumni of the Technical University of Munich Autumn/Winter 2019/2020 Welcome, Magnificence!* An Issue on the Presidential Change *Traditional form of address at German-speaking universities: Nominal fee His / Her Magnificence – rector (president) of a university 5,- euro Campus1 . Commitment . Network ISSN 1868-4084 I ENJOY SUPPORTING ADMIRABLE EFFORTS THAT ARE OF A LASTING BENEFIT TO HUMANS. Honorary Senator Friedrich N. Schwarz (TUM Alumni 1964) In July the TUM Friedrich N. Schwarz Research Station in Bercht- esgaden was opened. In the sustainable wooden building TUM will explore the ecosystem of the Alps region and test new forms of teaching science. TUM Alumni Friedrich N. Schwarz, whose dona- tion to the TUM University Foundation helped to make construc- tion in the mountains possible, lent his name. Friedrich N. Schwarz was a student of Electrical Engineering at TUM and subsequently pursued a corporate career (Rohde & Schwarz). www.tum-universitätsstiftung.de 2 EDITORIAL Dr. Verena Schmöller and Dr. Sabrina Eisele from the KontakTUM editorial team Two Alumni FOR TUM TUM Updates For 24 years Professor Wolfgang A. Herrmann has guided the fortunes of TUM, You would also like to stay which makes him the longest serving president in German university history. informed about current As his successor Professor Thomas F. Hofmann took over his duties on the 1st events for alumni and TUM of October 2019. Over the past ten years, he has been Vice President for Re- news in between the Alumni search and Innovation at TUM. Both have one thing in common: they have studied Magazine issues? Once a at TUM or did their doctorate here, i.e.